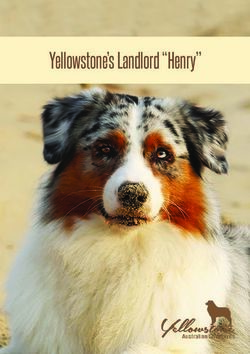Einsatz "künstlicher DNA" - Einschätzungen und Bewertungen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen
Einsatz „künstlicher DNA" –
Einschätzungen und Bewertungen
in verschiedenen
Bevölkerungsgruppen
A. Hartmann, D. Jeck, J. Lübben & C. Kestermann
Projektbericht
Januar 2012IPoS Vorwort i
__________________________________________________________________________________________
Vorwort
Der nachfolgende Evaluationsbericht beruht auf einem Forschungsauftrag der Polizei
Bremen. Der Vertrag wurde am 12.11.2010 zwischen der Polizei Bremen, vertreten durch
den seinerzeitigen Polizeipräsidenten und jetzigen Staatsrat Herrn Holger Münch, und dem
IPoS, vertreten durch Prof. Dr. Arthur Hartmann, geschlossen. Für die Durchführung der
Evaluation und die Erstellung des Berichtes wurde eine Vertragslaufzeit bis 31.01.2012
vereinbart.
Der Evaluationsauftrag umfasst die folgenden Leistungen:
• Recherche und Analyse der einschlägigen Literatur sowie fremder, insbesondere
ausländischer Studien zum Einsatz künstlicher DNA.
• Bevölkerungsbefragung in den Pilotregionen in Bremen und Bremerhaven.
• Befragung inhaftierter Straftäter.
• Auswertung und Bericht
Die unter Ziffer 1 genannte Literaturrecherche soll insbesondere Dokumente und Berichte zu
bisher schon durchgeführten Untersuchungen über Einsatz und Wirkung künstlicher DNA
recherchieren und hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Validität und Stichhaltigkeit kritisch
analysieren und bewerten.
Mittels der Bevölkerungsbefragungen in den Pilotregionen in Bremen und Bremerhaven soll
überprüft werden, ob das Projekt „künstliche DNA" in der vorgesehenen Weise umgesetzt
werden konnte und wie es von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Pilotregionen
angenommen und bewertet wird.
Die Befragung inhaftierter Straftäter zielt darauf, nähere Kenntnisse über die abschreckende
Wirkung des Einsatzes „künstliche DNA" zu erlangen. Die Befragung soll sowohl im Bremer
Strafvollzug als auch in einer auswärtigen Anstalt durchgeführt werden, um Straftäter mit
unterschiedlichen Vorkenntnissen über die „künstliche DNA" befragen und auf diese Weise
die abschreckende Wirkung der bisher erfolgten Öffentlichkeitsarbeit besser einschätzen zu
können.
Gemäß der Projektkonzeption sollen mit dem Einsatz der „künstlichen DNA" bei der Polizei
Bremen zum Einen potentielle Straftäter insbesondere im Bereich Wohnungseinbruchdieb-
stahl abgeschreckt werden (kriminalpräventiver Effekt) und zum Anderen das Sicherheitsge-
fühl in der Bevölkerung gestärkt werden (Wiechert 2009). Diese mit dem Einsatz „künstlicher
DNA" angestrebten Effekte können im Rahmen des vereinbarten Evaluationsauftrages nur in
begrenztem Umfang untersucht werden.
Dies hängt damit zusammen, dass der Evaluationsauftrag erst während der Projektlaufzeit
erteilt wurde und damit insbesondere hinsichtlich des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung der
Ausgangszustand nicht mehr erhoben werden konnte. Auch eine Untersuchung der
präventiven Wirkung des Einsatzes „künstlicher DNA" erfordert grundsätzlich mindestens
zwei Messungen z.B. der Häufigkeit einschlägiger Delikte in den Pilotregionen vor dem
Einsatz „künstlicher DNA" und danach. Diesbezüglich lassen sich zwar die Hellfelddaten fürIPoS Vorwort ii
__________________________________________________________________________________________
einschlägige Delikte in den Pilotregionen auch im Nachhinein aus polizeilichen Datenbanken
recherchieren. Auch eine Opferbefragung hinsichtlich der Kriminalitätsbelastung im
Dunkelfeld wäre mit eingeschränkter Validität grundsätzlich auch nachträglich noch möglich
gewesen. Eine große methodische Hürde für die Untersuchung präventiver Effekte besteht
aber darin, dass eine Veränderung der Kriminalitätsbelastung in den Pilotregionen nicht ohne
weiteres auf den Einsatz der „künstlichen DNA" zurückgeführt werden kann, da die
Kriminalitätsbelastung unabhängig vom Einsatz „künstlicher DNA" aufgrund anderer
Umstände und Ursachen einer ständigen Veränderung unterliegt. Eine Evaluation des
präventiven Effektes macht deshalb die parallele Untersuchung einer Kontrollgruppe bzw. -
region erforderlich, in der „künstliche DNA" nicht eingesetzt wird, die aber ansonsten mit der
Pilotregion weitgehend identisch ist und denselben Einflüssen unterliegt.
Seitens des IPoS wurden deshalb zunächst eine sog. quasiexperimentelle Untersuchung von
Straßenzügen, in denen „künstliche DNA" im Rahmen des Projektes kostenlos zur
Verfügung gestellt wurde, vs. vergleichbarer Straßenzüge, in denen „künstliche DNA" nicht
zur Verfügung gestellt wurde, und eine quasiexperimentelle Untersuchung einer Stichprobe
von Gewerbetreibenden, die „künstliche DNA" einsetzen vs. vergleichbarer Gewerbetreiben-
der, die „künstliche DNA" nicht einsetzen, angeboten. Darüber hinaus sollte zur Absicherung
der Ergebnisse eine Analyse relevanter Bereiche der Hellfeldkriminalität im Verlauf des
Projektes „Einsatz der künstlichen DNA" vorgenommen werden. Aufgrund der damit verbun-
denen erheblichen Mehrkosten wurden diese Untersuchungsteile nicht in den Evaluations-
auftrag einbezogen, was im Hinblick auf die aktuelle Diskussion um die Entwicklung der
Einbruchskriminalität in Bremen und Bremerhaven freilich sehr bedauerlich ist.
Anhand der in den Pilotregionen durchgeführten Bevölkerungsbefragungen und der
Befragung inhaftierter Straftäter ist es allerdings möglich, den Effekt des Einsatzes
„künstlicher DNA" auf das Sicherheitsempfinden und auf die Verhinderung von Straftaten von
den Befragten einschätzen zu lassen. Da die Wohnbevölkerung in den Pilotregionen und die
inhaftierten Straftäter als „Experten/innen“ für das Sicherheitsempfinden bzw. die
abschreckende Wirkung von Präventionsmaßnahmen betrachtet werden dürfen, erlauben es
die Einschätzungen und Wertungen der Befragten, plausible und in gewissem Grad
abgesicherte Rückschlüsse auf die Auswirkungen des Einsatzes „künstlicher DNA" zu
gewinnen. Darüber hinaus wurde eine differenzierte Bewertung der „künstlichen DNA" sowie
der damit zusammenhängenden Polizeiarbeit durch die Bevölkerung der Pilotregionen
erhoben, so dass im folgenden Bericht differenzierte Aussagen dazu präsentiert werden
können, wie der Einsatz „künstlicher DNA" von den Bewohnerinnen und Bewohnern der
Pilotregionen angenommen wird.
Der Bericht ist in vier Teile gegliedert, die jeweils eigenständige Untersuchungen enthalten.
Deshalb ist jeder Teil separat paginiert und mit eigenem Inhaltsverzeichnis und eigenen
Anhängen wie z.B. Literaturverzeichnis und Forschungsinstrumenten versehen. Zur
leichteren Orientierung sind den Seitenzahlen deshalb jeweils die den Untersuchungsteil
kennzeichnenden Großbuchstaben vorangestellt, z.B. A-1, A-2, A-3 …, B-1, B-2, B-3 ...
• In Teil A wird der theoretische Hintergrund und Bezugsrahmen, auf dem die
Untersuchung basiert, näher erläutert. Darüber hinaus werden in Teil A die
Ergebnisse der Literaturrecherche und –analyse, mit der das IPoS beauftragt war,
dargestellt.IPoS Vorwort iii
__________________________________________________________________________________________
• Teil B umfasst die Auswertung und Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung in den
Pilotregionen
• Teil C behandelt die Befragung inhaftierter Straftäter, die darauf beruhenden
Auswertungen und deren Ergebnisse
• Teil D enthält eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Befunde der in den
Teilen A, B und C im Detail vorgestellten Untersuchungen. Teil D kann damit
selbständig als „executive summary“ Verwendung finden.
Abschließend sei der Polizei Bremen, insbesondere Herrn Goritzka für die gute Kooperation
bei dieser Untersuchung gedankt. Dies gilt sowohl für die fruchtbare Diskussion bei der
Konzeption der Bevölkerungsbefragung als auch dafür, dass uns ein Adressdatensatz aus
dem aktuellen Register des Einwohnermeldeamtes für die Pilotregionen zur Verfügung
gestellt wurde.
Zu danken haben wir auch den Justizvollzugsanstalten in Bremen und Uelzen sowie dem
Senator für Justiz in Bremen, dem Staatsministerium für Justiz und dem kriminologischen
Dienst in Niedersachsen für deren Kooperation und Unterstützung bei der Befragung der
Inhaftierten.
Schließlich sei an dieser Stelle nicht vergessen, dass unser Dank auch den Befragten in den
Pilotregionen und in den Justizvollzugsanstalten in Bremen und Uelzen gilt.
Bremen, 31. Januar 2012
Institut für Polizei und Sicherheitsforschung (IPoS)
Doventorscontrescarpe 172c
28195 Bremen
Prof. Dr. Arthur Hartmann arthur.hartmann@hfoev.bremen.deIPoS Inhaltsübersicht iv
__________________________________________________________________________________________
Vorwort i-iii
Teil A Theoretische Betrachtungen
A. Hartmann, J. Lübben & D. Jeck
1. Ausgangslage A-1
2. Das Bremer Pilotprojekt A-2
2.1 Ziele des Projektes A-2
2.2 Umsetzungsstrategie A-3
3. Forensische Markierungstechnik A-3
3.1 Historischer Vergleich A-3
3.2 Künstliche DNA A-4
3.2.1 Markierungsflüssigkeit A-5
3.2.2 Markierungsspray (DNA-Dusche) A-5
3.2.3 Trapcar A-6
4. Hintergründe / Begründungen für das Projekt bzw. die Strategie A-6
4.1 Erfahrungen im Ausland A-6
4.2 Sicherheitsgefühl der Bevölkerung A-9
4.3 Theoretische Verortung des Konzeptes Sicherheitsgefühl A-10
Literaturverzeichnis
Teil B Bewertung des Einsatzes „künstlicher DNA" in den
Pilotregionen
A. Hartmann, J. Lübben & D. Jeck
1. Allgemeines - Rücklauf B-1
2. Auswahl der Erhebungsmethode B-1
3. Beschreibung des Messinstrumentes B-2
4. Beschreibung der Sozialstruktur B-3
5. Inhaltliche Dimensionen des Fragebogens B-4
5.1 Bekanntheit des Projektes B-4
5.2 Aktive Teilnahme am Projekt B-6IPoS Inhaltsübersicht v
__________________________________________________________________________________________
5.3 Eingeschätzte Wirksamkeit der „künstlichen DNA“ B-7
5.3.1 Abschreckungswirkung B-8
5.3.2 Wiedererlangung von entwendetem Eigentum B-9
5.3.3 Verhinderung von Eigentumsdelikten B-10
5.3.4 Gesamteinschätzung der Wirksamkeit B-12
5.4 Aufklärungsarbeit der Polizeibeamten/innen B-12
5.5 Sicherheitsgefühl B-16
5.6 Viktimisierungserfahrungen B-21
6. Abschließendes Fazit und Diskussion B-24
Anhang
Teil C Befragung im Strafvollzug: Subjektive Wirksamkeits-
einschätzung des Einsatzes „künstlicher DNA“
C. Kestermann & D. Jeck
1. Allgemeines C-1
2. Erhebungsinstrument C-1
3. Untersuchungsdurchführung C-2
4. Beschreibung der Stichprobe der JVA Bremen und der JVA Uelzen C-2
4.1 Alter C-3
4.2 Bildungsabschluss C-3
4.3 Staatsangehörigkeit / Herkunft C-3
4.4 Drogenabhängigkeit und Grund der Inhaftierung C-4
4.5 Expertenstatus: Selbstattribuierte Kenntnisse delinquenten Verhaltens C-5
5. Darstellung der Ergebnisse C-7
5.1 Bekanntheit „künstlicher DNA“ C-7
5.2 Subjektive Einschätzung von Verwendungszweck und Wirkung
„künstlicher DNA" sowie des Warn-/Hinweisschildes „Diebstahlschutz
durch DNA“ C-9
5.3 Wissensvermittlung zur „künstlichen DNA" und weitere
Abschreckungseffekte C-12
5.4 Eingeschätzte Wirksamkeit des Einsatzes „künstlicher DNA" C-18
Anhang: FragebogenInstitut für Polizei- und Sicherheitsforschung Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen
Theoretische Betrachtungen
A. Hartmann, D. Jeck & J. Lübben
Teil AIPoS Theoretische Betrachtungen Inhalt Theoretische Betrachtungen A. Hartmann, J. Lübben & D. Jeck Inhalt 1. Ausgangslage A-1 2. Das Bremer Pilotprojekt A-2 2.1 Ziele des Projektes A-2 2.2 Umsetzungsstrategie A-3 3. Forensische Markierungstechnik A-3 3.1 Historischer Vergleich A-3 3.2 Künstliche DNA A-4 3.2.1 Markierungsflüssigkeit A-5 3.2.2 Markierungsspray (DNA-Dusche) A-5 3.2.3 Trapcar A-6 4. Hintergründe / Begründungen für das Projekt bzw. die Strategie A-6 4.1 Erfahrungen im Ausland A-6 4.2 Sicherheitsgefühl der Bevölkerung A-9 4.3 Theoretische Verortung des Konzeptes Sicherheitsgefühl A-10 Literaturverzeichnis
IPoS Theoretische Betrachtungen A-1 Theoretische Betrachtungen Die folgenden Ausführungen sollen einen kurzen Abriss über die Grundlage und den Verlauf des Projektes geben. Gleichzeitig wird die „künstliche DNA“ als Möglichkeit der forensischen Markierung skizziert und der Versuch unternommen, anhand von praktischen Erfahrungswerten aus bereits durchgeführten Untersuchungen im Ausland, in denen „künstliche DNA“ bereits eingesetzt wurde, und theoretischen Darstellungen den Nutzen und die Effizienz dieser Methode darzustellen. 1. Ausgangslage Gleichbleibend hohe bzw. sogar weiter steigende Fallzahlen im Bereich der Eigentumskriminalität waren im Bundesland Bremen in den letzten Jahren zu verzeichnen. Der Anteil der Diebstahlsdelikte an der Gesamtkriminalität des Landes Bremen beträgt 2008 53 % (Senator für Inneres und Sport 2009), so wurden im Jahr 2008 insgesamt 49.506 Fälle von Diebstahl bekannt. Dies bedeutete zwar ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von 10 %, insgesamt liegen die Zahlen jedoch weiterhin auf sehr hohem Niveau (Senator für Inneres und Sport 2009) Auffallend in der Betrachtung der Zusammensetzung der einzelnen Diebstahlsdelikte ist die hohe Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle. 2008 wurden im Land Bremen insgesamt 2399 Einzeldelikte registriert. Damit nimmt das Land Bremen auch im bundesweiten Vergleich der Häufigkeitszahlen (Fälle pro 100.000 Einwohner) einen Spitzenplatz ein. Aufgeklärt werden insgesamt nur etwa 9 Prozent aller registrierten Einbruchsdiebstähle, das bedeutet im Umkehrschluss auch, in 91 Prozent der Fälle bleibt der Täter unentdeckt. Diese beiden Faktoren gleichbleibend hohe bzw. sogar steigende Fallzahlen und geringe Aufklärung bestimmen die hohe Relevanz, die das Thema „Verhinderung von Einbruchskriminalität“ bei den beteiligten Behörden - insbesondere der Polizei - einnimmt. Die aktuell in der Presse veröffentlichten Zahlen: 3064 Anzeigen wegen Wohnungseinbruch in 2011 davon allein 500 polizeilich registrierte Anzeigen im Monat Dezember (Weserkurier 2012) zeigen, dass es gerade im vergangenen Jahr zu einer dramatischen Verschärfung der Problematik gekommen ist und dieses Thema in der öffentlichen Wahrnehmung eine immens hohe Relevanz besitzt. Denn gerade der Deliktsbereich Einbruchsdiebstahl ist mit großen Ängsten und Befürchtungen in der Bevölkerung besetzt und auch mit oft dramatischen Folgen für die Betroffenen verbunden. Viele Menschen fürchten sich davor, selbst irgendwann einmal Opfer eines Einbruchs werden zu können, außerdem treten für diejenigen Personen, die tatsächlich Opfer eines Einbruchsdiebstahls werden, oft hohe immateriellen Schäden und Belastungen auf. Der schwere Eingriff in die Privatsphäre führt bei den Betroffenen oft zu psychischen Belastungen, die auch noch lange nach der eigentlichen Tat das Leben nachhaltig stören können. Typische Befunde sind z.B. Schock über die Tat, Schmerz über den Verlust von Wertgegenständen und nicht zuletzt Furcht, dass sich das Geschehen wiederholen könnte (DFK 2003). Empirisch gestützt werden diese Befunde auch durch eine Reihe von Befragungen, beispielhaft sei hier eine in Wiesbaden durchgeführte Opferbefragung (Schmelz 2000) genannt. 87 Prozent der dort befragten Opfer von Einbruchsdiebstählen gaben beispielsweise an, dass sie Angst hätten, erneut Opfer eines
IPoS Theoretische Betrachtungen A-2
Einbruchs zu werden, das Sicherheitsgefühl verschlechterte sich massiv (9 % unsicher
vor der Tat, danach 56% unsicher). Die Betroffenen suchten nach der Tat oft Wege, sich
durch eigenes Verhalten (bessere Sicherung von Wohnungstür und Fenstern) oder durch
gemeinschaftliche Unternehmungen (Verbesserung des nachbarschaftlichen
Verhältnisses) vor weiterer Viktimisierung zu schützen und das eigene Sicherheitsgefühl
zu verbessern1 (Schmelz 2000).
Auch diese Erkenntnisse bestärkten die Verantwortlichen der Bremer Polizei nach neuen
Konzepten zu suchen, um die hohen Einbruchsquoten und die damit verbundene
Verunsicherung der Bevölkerung wirksam zu bekämpfen.
Angeregt durch verschiedene Erfolgsberichte aus dem europäischen Ausland
(Niederlande und Großbritannien) und nach einer detaillierten Bestandsaufnahme
entschied sich die Leitung der Kriminalpolizei in Bremen einen bis dato in Deutschland
völlig neuen Weg der Kriminalprävention zu beschreiten, nämlich eine Methode der
forensische Markierung - die so genannte „künstliche DNA“ - einzusetzen. Als
Kooperationspartner für das Projekt „Forensische Markierung durch künstliche DNA –
Prävention durch Abschreckung“ wurde der gewerbliche Anbieter SelectaDNA
International Limited gewonnen, eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde am
17.Juli 2009 zwischen der Polizei Bremen und der Firma SelectaDNA unterzeichnet
(Wiechert 2009).
2,. Das Bremer Pilotprojekt
Das Projekt „Künstliche DNA – Prävention durch Abschreckung“ verfolgt einen
präventiven Ansatz. Kriminalprävention wird vom Bundesministerium der Justiz wie folgt
definiert: „Kriminalprävention umfasst alle Maßnahmen, die der Verhütung von Straftaten,
der Begrenzung des durch Straftaten entstehenden Schadens und der Eindämmung der
Verbrechensfurcht der Bevölkerung dient.“ (BMJ 2010). Diese globalen Formulierungen
werden in der Zielbeschreibung des Bremer Projektes aufgegriffen bzw. konkret auf die
Ausgangslage im Land Bremen bezogen und mit genauen Zahlenwerten hinterlegt.
2.1 Ziele des Projektes
Das Projekt “Künstliche DNA – Prävention durch Abschreckung“ verfolgt im Wesentlichen
zwei Ziele:
• Im Rahmen der Projektphase sollen die Fallzahlen im Bereich der Einbruchs-
und Überfallkriminalität in den Pilotregionen um 50 Prozent reduziert werden
(speziell in den Bereichen Einbruchsdiebstahl inkl. Tageswohnungseinbruch und
Kfz-Aufbruch, sowie Raubdelikte im Bereich der gewerblichen Unternehmen)
• Das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung soll durch den Einsatz der
„künstliche DNA“ deutlich verstärkt werden (Wiechert 2009).
1
Die Variable persönliches Sicherheitsgefühl als besonderer Aspekt wird im weiteren Verlauf der
Ausführungen nochmals aufgegriffen und unter Punkt 4.2 etwas differenzierter betrachtet.IPoS Theoretische Betrachtungen A-3 Es sollen demnach neben messbaren (harten) Fallzahlen auch eher subjektiv wahrgenommene Einstellungsänderungen (Sicherheitsgefühl) aus den nachfolgend beschriebenen Maßnahmen resultieren. 2.2 Umsetzungsstrategie - Projektablauf Das Projekt startete offiziell im Oktober 2009, anfangs wurden - in Zusammenarbeit mit der Senatorin für Bildung und Wissenschaft und dem Schulamt Bremerhaven - alle allgemeinbildenden Schulen im Land Bremen mit der „künstlichen DNA“ ausgestattet. So konnte relativ schnell ein großer Personenkreis angesprochen werden und der Bekanntheitsgrad des Projektes wurde enorm erhöht. Im November 2009 startete das Projekt in seine zweite Phase. Bereits ab Juli 2009 wurden in Bremen in der Süder-Vorstadt und in Bremerhaven Geestendorf zwei Pilotregionen mit je 1000 bis 1500 Wohneinheiten bzw. je 3000 Einwohnern eingerichtet und ab dem 09.11.2009 mit kostenlosen Markierungssets ausgestattet. Die darin enthaltene „künstliche DNA“ sollte von den Bewohnern der Pilotregionen verwendet werden, um eigene Wertgegenstände zu markieren. Gleichzeitig wiesen Aufkleber und Hinweisschilder auf den Einsatz der „künstlichen DNA“ hin. In einem nächsten Schritt kamen auch die so genannten DNA-Duschen an zunächst zwei Bremer Tankstellen zum Einsatz, schließlich auch die Trapcars. Der gewählte stufenartige Projektablauf bewirkt eine stetige Presseberichterstattung, durch die wiederholten Nachrichten in den verschiedensten Medien steigert sich der Bekanntheitsgrad des Projektes innerhalb der Bevölkerung sprunghaft. Die verwendete „künstliche DNA“ kann als eine Art „Markierung“ bezeichnet werden. Markierungen werden im forensischen Bereich bereits seit geraumer Zeit eingesetzt und sollen nachfolgend kurz dargestellt werden, wobei der Schwerpunkt auf der Beschreibung der „künstlichen DNA“ liegen soll. 3. Forensische Markierungstechnik 3.1 Historischer Vergleich Markierungen unterschiedlichster Arten und Formen dienen seit jeher zum Kenntlichmachen von Eigentum. Strafverfolgungsbehörden nutzen seit geraumer Zeit verschiedene Möglichkeiten, Gegenstände chemisch oder physikalisch zu markieren, um mit Hilfe dieser Markierungen Ermittlungshinweise zu generieren und möglicherweise auch Täter überführen zu können. Beispielsweise wird seit vielen Jahren Silbernitrat, ein Salz der Salpetersäure, zur Präparation von Geldscheinen eingesetzt, um z.B. nach einem Banküberfall oder einer Lösegeldübergabe den Täter identifizieren zu können. Nach dem Hautkontakt mit den präparierten Geldscheinen dringt das Silbernitrat in die oberen Hautschichten ein und reagiert dort mit Chlorid aus dem menschlichen Schweiß zu Silberchlorid. Unter dem Einfluss von Sonnenlicht bilden sich dann kleine Partikel aus metallischem Silber, die in der Haut schwarz erscheinen. Diese Färbung in den oberen Hautschichten lässt sich
IPoS Theoretische Betrachtungen A-4 mechanisch (z.B. durch Waschen) nicht entfernen, erst im Zuge der Hauterneuerung wächst die Färbung quasi heraus (Gessner 2007) Eine andere einfache Möglichkeit Eigentum zu markieren und somit eindeutig einen Gegenstand einer Person - den Eigentümer - zuordnen zu können, ist das Auftragen von Farbe. Im privaten Bereich ist es weit verbreitet, bestimmte Dinge mit dem eigenen Namen zu versehen, um beispielsweise das Vertauschen identischer Gegenstände zu verhindern oder bei Verlust das gefundene Gut schnell wieder dem Eigentümer zuordnen zu können. Farbe als Markierungsmöglichkeit findet inzwischen jedoch nicht nur im privaten Gebrauch Anwendung, vielmehr hat sich ihre Verwendung stark weiterentwickelt. Beispielhaft seien hier die Sprühvorrichtungen an Tankstellen oder Spielcasinos genannt, die an Ein- und Ausgängen angebracht, bei Bedarf (z.B. nach einem Überfall bei Flucht der Täter) per Knopfdruck ausgelöst werden. Sie versprühen dann einen feinen Farbnebel und “markieren“ den flüchtenden Täter. Allerdings bietet dieses Szenario einige grundlegende Problematiken, z.B. ungenaue Sprühvorrichtungen durch die andere Personen möglicherweise zufällig “mitmarkiert“ werden, das Problem der geringen Beständigkeit der Farbanhaftungen und - nicht zu vergessen – das Risiko einer Situationseskalation, denn das Besprühen mit Farbe kann die Gereiztheit und Aggression des Täters weiter verschärfen. Farbe ist als Möglichkeit der forensischen Markierung insgesamt also eher weniger gut geeignet. Insofern stellt die so genannte „künstliche DNA“ als farblose, lang anhaftende Markierungsflüssigkeit, die mit bloßem Auge kaum sichtbar ist, eine Optimierung der forensischen Markierung dar. 3.2 „Künstliche DNA“ „Künstliche DNA“ ist ein synthetisch hergestellter Stoff, farblos und mit bloßem Auge kaum sichtbar. Analog zur menschlichen enthält auch die künstliche DNA einen individuellen Nukleotid-Code und ist deshalb einzigartig2. Gebunden wird die künstliche DNA in einer Flüssigkeit, die als Klebstoff (Acryl-Urethan auf Wasserbasis) hart und transparent trocknet. Von den meisten Oberflächen lässt sich der getrocknete Klebstoff nur schwer wieder entfernen. Zusätzlich sind in jeder einzelnen Markierungsflüssigkeit noch mehrere Hundert kleine Kunststoffplättchen enthalten. Diese so genannten Microdots sind ca. 0,5 bis 1mm groß und jeweils mit eingelaserten Individualcodierungen versehen. Diese Identifizierungsnummern sind ebenso einzigartig wie die Nukleotid-Codes und dienen so als weitere Zuordnungsmöglichkeit3. Die Microdots lassen sich mit Hilfe eines Mikroskops auslesen (SelectaDNA 2010). Darüber hinaus enthält die Markierungsflüssigkeit einen UV-Indikator, der unter speziellem UV-Licht blau fluoresziert, die Substanz somit deutlich erkennbar macht. Die Vorteile der forensischen Markierung mittels „künstlicher DNA“ liegen also in der Einzigartigkeit jeder Markierung und in ihrem „Nicht-sofort-sichtbar-sein“. „Künstliche 2 Diese Eigenschaft ermöglicht eine spätere exakte Zuordnung des markierten Gegenstandes und seines Besitzers, dessen Daten in einer Datenbank hinterlegt sind. 3 Die Identifizierungsnummer wird ebenfalls in der Datenbank hinterlegt.
IPoS Theoretische Betrachtungen A-5 DNA“ kann in einer Reihe von unterschiedlichen Produkten eingesetzt werden, z.B. ist hier die Markierungsflüssigkeit selbst zu nennen, das Markierungsspray, Markierungsgel und die Trapcars. Die im Bremer Projekt verwendeten Produkte sollen kurz skizziert werden. 3.2.1 Markierungsflüssigkeit Die bereits dargestellte Markierungsflüssigkeit ist mit der einzigartigen Nukleotid- Codierung und zusätzlich enthaltenen Microdots ausgestattet. Die Flüssigkeit kann mit Hilfe eines Applikators (Kunststoffstäbchen mit Schaumstoffende) auf wertvolle Gegenstände, insbesondere sind hier für potentielle Einbrecher interessante Gegenstände, wie z.B. Laptop, PC, Handys, technische Geräte zu nennen, aufgetragen werden um sie so vor möglichen Diebstählen zu schützen. Die Flüssigkeit sollte an unebenen Stellen, Vertiefungen oder in Rillen aufgetragen werden, damit diese durch den häufigen Gebrauch nicht abnutzt bzw. ein Beseitigungsversuch erschwert wird. Bei Markierung von Schmuck oder Uhren sollte ein späterer Hautkontakt mit den Markierungen vermieden werden, um Beeinträchtigungen durch Schweißabsonderungen zu verhindern (Behr, 2010). Nach etwa zehn Minuten sollte die Markierung getrocknet, nach dreißig Minuten ausgehärtet und transparent sein (SelectaDNA 2010) Die Markierungsflüssigkeit war im Bremer Projekt Bestandteil des so genannten Markierungssets, dieses wurde innerhalb der Pilotregion kostenlos an alle Haushalte abgegeben. Neben der Markierungsflüssigkeit enthielt jedes Set – und dies ist wohl einer der wichtigsten Bestandteile – verschiedene Aufkleber „Diebstahlschutz durch DNA“. Diese sollten gut sichtbar an Fenstern, Türen und am markierten Gerät selbst angebracht werden, um so potentielle Täter abzuschrecken. 3.2.2 Markierungsspray (DNA-Dusche) Durch eine Sprühanlage an den Ein- und Ausgangstüren sollen insbesondere Geschäfte, Kioske, Tankstellen und Spielotheken vor Diebstählen und Überfällen geschützt werden. In den Sprühvorrichtungen befindet sich eine mit künstlicher DNA gefüllte Kartusche, die im Auslösemoment den vermeintlichen Täter beim Verlassen des Tatortes besprüht. Die Vorrichtung kann durch Betätigung des Alarmknopfes ausgelöst werden oder aber an eine Einbruchmeldeanlage gekoppelt werden. Passiert der Täter nach Scharfstellung den Bewegungsmelder der Anlage, so wird ein feiner Sprühnebel ausgelöst. Dieser setzt sich auf der Kleidung, der Haut und den Haaren des Täters ab, eine Entfernung des Sprays ist kaum möglich (SelectaDNA 2010). Auch nach mehrfachem Duschen ist es bis zu sechs Wochen unter UV-Licht nachweisbar (Wiechert 2009).
IPoS Theoretische Betrachtungen A-6 3.2.3 Trapcar Die so genannten Trapcars sind präparierte Fahrzeuge („Fallenautos“). Diese werden mit einer beweglichen, drehbaren DNA-Sprühvorrichtung ausgestattet. Außerdem ist das Fahrzeug mit einer Alarmanlage versehen, die im Falle einer unberechtigten Öffnung die Sprühvorrichtung scharf schaltet (SelectaDNA 2010). Trapcars ermöglichen zum einen die Ergreifung von Tätern und zum anderen die Abschreckung möglicher Autoaufbrecher. Potentielle Täter sollen verunsichert werden, ob es sich bei dem von ihnen anvisierte Kfz möglicherweise um solch ein Trapcar handeln könnte. Die Ausrichtung beim Einsatz dieser „Fallenautos“ liegt also eindeutig in der Prävention durch Abschreckung. 4. Hintergründe / Begründungen für das Projekt bzw. die Strategie Im Folgenden soll nochmals eine praktische und theoretische Einbettung des Pilotprojektes „Prävention durch Abschreckung – Forensische Markierung durch künstliche DNA“ vorgenommen werden. Inwieweit erscheinen die Projektziele realistisch und nachvollziehbar, in welchem theoretischen Rahmen lässt sich das Projekt verorten? Begonnen werden soll jedoch mit einer Darstellung der bisher (im Ausland) gesammelten Erfahrungswerte. 4.1 Erfahrungen im Ausland Bezogen auf den Einsatz „künstlicher DNA“ gibt es in Großbritannien und den Niederlanden einige erfolgreiche Projekte, auf die die Bremer Polizei aufmerksam wurde Die dortige Polizei wendet dabei ähnliche Strategien an, arbeitet jedoch mit unterschiedlichen Herstellern der „künstlichen DNA“ zusammen. In Großbritannien kooperiert die Polizei mit dem Anbieter „SmartWater“, in den Niederlanden verwenden die dortigen Behörden Produkte der Firma SelectaDNA. Auf den Internetseiten beider Unternehmen finden sich lange Listen von verzeichneten Erfolgen, die aus dem Einsatz der durch sie gelieferten und im Projekt eingesetzten „künstlichen DNA“ resultiere. Beispielhaft sei die aktuelle Seite des Anbieters SmartWater dargestellt:
IPoS Theoretische Betrachtungen A-7
Tab. 1: Reduktion von Einbrüchen / Diebstahlsdelikten nach Nutzung „künstlicher DNA“ in
Großbritannien (SmartWater 2012)
SmartWater Scheme Police Reportet Crime Reduction
Statistics
Bexley, London (Metropolitan) 75,5 % reduction in domestic burglary (2010)
Halton, Widnes (Cheshire) 68 % reduction in domestic burglary (2010)
Swale (Kent) 93 % reduction in domestic burglary (2010)
Winshill, Burton (Staffordshire) 69 % reduction in domestic burglary (2010)
Stapenhill, Burton (Staffordshire) 59% reduction in vehicle theft (2010)
Wokingham (Thames Valley) 29.5 % reduction in domestic burglary (2010)
Darlington (Durham) 40 % reduction in school burglary (2010)
Lings & Lumbertubs (Northamptonshire) 70 % reduction in domestic burglary (2010)
Thorplands (Northamptonshire) 70 % reduction in domestic burglary (2010)
Wellingborough (Northamptonshire) Only 1 recorded commercial break-in in a year
(2010)
Sittingbourne (Kent) 94 % reduction in domestic burglary (2009)
Littleworth & Berry Hill, Mansfield 84 % reduction in domestic burglary (2009)
(Nottinghamshire)
Fulham, London (Metropolitan) 43 % reduction in burglary (2009)
Galley Common (Warwickshire) 82 % reduction in domestic burglary (2009)
Rochdale (Greater Manchester) 40 % reduction in domestic burglary (2009)
G4S Cash Services, Manchester 24 % reduction in Cash in Transit Robbery
(2009)
Bradford (West Yorkshire) 30 % reduction in vehicle crime (2008)
Scunthorpe (Humberside Only 1 burglary amongst 8000 SmartWatered
homes (2008)
Cumbria 33 % reduction in quad bike thefts (2008)
Basingstoke (Hampshire) 76 % reduction in domestic burglary (2008)
Cannock (Staffordshire) 77 % reduction in school burglary (2007)
Gloucestershire 56.8 % reduction in school burglary (2007)
Cheshire 40 % reduction in school burglary (2007)
Für die dargestellten Regionen wird also eine teils beträchtliche Senkung der Fallzahlen
berichtet. Als Extrembeispiel sei der oben dargestellte Rückgang des Einbruches in Swale
(Kent) um 94 % genannt. Leider sind in kaum einem der dargestellten Fälle genaue
weiterführende Informationen einsehbar. Vereinzelt werden einige wenige statistischeIPoS Theoretische Betrachtungen A-8 Informationen bereitgestellt, so dass zumindest die Vergleichszeiträume und die Stichprobengröße bekannt sind (siehe Abb.1) Devon and Cornwall Constabulary, Torbay Date/Period of Project: Dec 08 – Dec 09 Compared to previous Year burglary: Dec 07–Dec 08 Number of homes given kits: 150 Burglaries before: 23 Burglaries after: 7 Burglary reduction: 69,6% West Midlands Police (Dudley MBC) Date/Period of Project: Oct 08 – Oct 09 Compared to previous Year burglary: Oct 07– Oct 08 Number of homes given kits: 505 Burglaries before: 27 Burglaries after: 13 Burglary reduction: 51,9% Abb. 1: Beispiele für erfolgreiche Nutzung der „künstlichen DNA“ (SmartWater 2011) Ähnlich positive Ergebnisse werden aus den Niederlanden berichtet. So gibt z.B. die Firma SelectaDNA an, dass in den Gebieten, in denen das Produkt „künstliche DNA“ eingesetzt wird, eine Senkung der Fallzahlen für Wohnungseinbruchsdelikte von bis zu 85 % zu verzeichnen war. Ebenfalls gesunken und zwar um 60 % seien die Diebstähle in / aus Kraftfahrzeugen (SelectaDNA 2010). Diese und weitere „Erfolgsmeldungen“ lassen sich im Internet nachlesen. Inzwischen ist der Einsatz „künstlicher DNA“ nicht mehr einzig auf Europa begrenzt auch beispielsweise aus Neuseeland wurden positive - auf den Einsatz künstlicher DNA zurückgeführte - Effekte vermeldet: „New Zealand DNA Trial Reduces Burglary by 61%“ (SelectaDNA 2010). Eine offizielle Evaluation unter objektiven wissenschaftlichen Kriterien für einzelne Projekte in Großbritannien oder in den Niederlanden hat jedoch noch nicht stattgefunden oder es liegen darüber keine belastbaren Informationen vor. So bleiben die sehr positiv erscheinenden Zahlen bzw. die hohen Rückläufe der Fallzahlen nur auf den ersten Blickaussagekräftig. Ohne Informationen zum Ablauf der Projekte, zu den Auftraggebern, zur Durchführung, zu weiteren mit der Markierung von Wertgegenständen einhergehenden präventiven Maßnahmen wie z.B. dem Einbau von Sicherheitstüren oder der Verstärkung der Fenster etc. können die Zahlen nicht zweifelsfrei auf den Einsatz von künstlicher DNA zurückgeführt werden. Studien zu einer Evaluierung der präventiven Effekte, die wissenschaftlichen Kriterien bei der Durchführung und der Publikation der Ergebnisse genügen, ließen sich trotz intensiver Recherche in der gesichteten Literatur nicht auffinden.
IPoS Theoretische Betrachtungen A-9 Auf einen weiteren Kritikpunkt an den dargebotenen Zahlen weist bereits Kerstin Fischer im Rahmen ihrer Bachelor-Thesis (2010) hin: Die angegebenen Zahlenwerte zu Umfang und Häufigkeit von z.B. Einbruchsdiebstählen stimmen teilweise nicht mit den offiziellen statistischen Erhebungen überein, es ergeben sich teils gravierende Diskrepanzen. Beispielsweise wurden in der offiziellen Kriminalstatistik Englands für die Hafenstadt Hartlepool für das Jahr 2002 insgesamt 2.718 und im Jahr 2005 insgesamt 1.317 Einbrüche verzeichnet. Dies wäre ein Rückgang der Fallzahlen um 51,55%. Durch smartWater (2010) wurde jedoch ein Rückgang der Einbruchszahlen um 78% berichtet (Fischer 2010). Die Diskrepanz zwischen offiziellen Zahlen und der Berichterstattung des Anbieters beträgt für dieses Beispiel also ca. 20 Prozentpunkte. Dieser hohe Wert bekräftigt sicher nochmals, dass es einer gewissen Vorsicht bei Übernahme der durch Hersteller der „künstlichen DNA“ gelieferten Fallzahlen bedarf und verdeutlicht außerdem erneut die Notwendigkeit einer genauen wissenschaftlichen Effektevaluierung. Diese steht bislang noch aus, so bleibt insgesamt zu konstatieren, dass sich die Literaturrecherche zum Einsatz und Nutzen der „künstlichen DNA“ als sehr wenig ergiebig erwies. Einer großen Anzahl von regionalen Pressemitteilungen zu einzelnen „Erfolgsmeldungen“ stehen keine belastbaren und transparenten Untersuchungen zu Wirkungsweise und Effekten der „künstlichen DNA“ gegenüber. Mangels eines entsprechenden Auftrags kann auch die hier vorgelegte Evaluationsstudie diese Lücke nicht schließen, obwohl der Polizei Bremen ein entsprechender Vorschlag unterbreitet worden war. Untersucht wird allerdings, ob dem Einsatz „künstlicher DNA“ zu mindestens auf der Einstellungsebene seitens der Täter eine abschreckende Wirkung zugeschrieben wird. Hierzu wurden in den Strafvollzugsanstalten in Bremen und Uelzen Befragungen der Inhaftierten durchgeführt. 4.2 Sicherheitsgefühl der Bevölkerung Eines der durch die Projektverantwortlichen beschriebenen Ziele, die mit dem initiierten Pilotprojekt erreicht werden sollen, besteht in der „Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung“ (Goritzka 2009). Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist – analog zum Thema Kriminalitätsfurcht – sehr stark in der kriminologischen Forschung verwurzelt. Es wurde zunächst im Ausland beforscht, ist jedoch seit den späten 70-er Jahren auch in Deutschland ein Thema, dessen kriminalpolitische Relevanz stetig steigt. Insofern ist es nachvollziehbar, dass Fragen zum Sicherheitsgefühl der Bevölkerung auch unmittelbar Bezug auf die tägliche polizeiliche Arbeit nehmen: „Die Polizei hat sich bei ihrem Tätigwerden nicht nur an der Sicherheitslage, sondern auch am Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu orientieren.“ (PDV 100 1999, S. 11). Die offiziellen Daten der bekannten Statistiken, die ein objektives Lagebild der Kriminalität und des Risikos der Viktimisierung abbilden, entsprechen oft nicht den durch Befragungen ermittelten Aussagen und Beurteilungen zur subjektiven empfundenen Sicherheit der Bevölkerung. Denn wie „die Semantik des Wortes vorgibt - Sicherheitsgefühl ist ein Kompositum aus den Begriffen Sicherheit und Gefühl – [geht es]
IPoS Theoretische Betrachtungen A-10
um das Gefühl von Sicherheit“ (Schewe 2009, S. 18), also um die emotionale Bewertung
der eigenen, subjektiv empfundenen Sicherheit. Anders ausgedrückt ist es die „subjektive,
emotionale und individuelle Antwort auf die Frage, ob sich ein Mensch sicher fühlt“
(Schewe 2009, S.18). Im Gegensatz zur meist nur sehr abstrakt wahrnehmbaren
objektiven Sicherheit / der objektiven Gefährdung ist deshalb das eigene persönliche
Sicherheitsgefühl also eine sehr präsente, tagtäglich emotional spürbare Größe für jeden
einzelnen Bürger (Schewe 2009).
Objektive Sicherheitslage und subjektives Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sind also
zwei Dimensionen, die – wie oben erwähnt – nicht immer synchron abbildbar sind,
sondern sich teilweise in ihren Ausprägungen stark unterscheiden4. Erklärbar werden
diese Unterschiede möglicherweise, indem der theoretische Bezugsrahmen für das
Konzept Sicherheitsgefühl näher beleuchtet wird.
4.3 Theoretische Verortung des Konzeptes Sicherheitsgefühl
Was genau ist unter dem Sicherheitsgefühl zu verstehen, meinen und messen die
teilweise synonym verwendete Begriffe, z.B. Kriminalitätsfurcht, Verbrechensfurcht oder
Angst vor Straftaten Gleiches oder in wieweit lassen sich die einzelnen Begriffe
voneinander abgrenzen und in welchen theoretischen Rahmen lässt sich das Konstrukt
subjektives Sicherheitsgefühl verorten? Dies sind Fragestellungen, die nachfolgend
angerissen werden sollen.
Trotz der Fülle an Untersuchungen in den letzten zwei Jahrzehnten und dem damit
vorhandenen Datenmaterial steht eine umfassende theoretische Fundierung der
Konstrukte Kriminalitätsfurcht und Sicherheitsgefühl noch immer aus. Denn die
empirischen Ergebnisse werden teilweise wenig differenziert beurteilt, vielmehr
vereinfacht und dramatisierend dargestellt (Boers & Kurz 1997). Beispielhaft sei hier
angeführt, dass Kriminalität und Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung als „zentrale
Elemente im Begründungsmuster einer an law and order orientierten und in der Regel auf
eine Dramatisierung des Kriminalitätsproblems hinauslaufenden Kriminalpolitik“ (Boers
1995, S.4) angeführt werden. Dieses Begründungsmuster lautet im Wesentlichen wie
folgt:
Die Bevölkerung und insbesondere Opfer von Straftaten seien über die wachsende Kriminalität
beunruhigt und verlangten deshalb nach härteren Strafen. Hierauf müsse die Politik reagieren. Durch
eine konsequentere Strafverfolgung könne die Kriminalität gesenkt und ein Rückgang der
Kriminalitätsfurcht [und damit eine Erhöhung des Sicherheitsgefühles] herbeigeführt werden (Boers
1995, S.4).
Diese möglicherweise auf den ersten Blick noch plausibel erscheinenden Aussagen
erwiesen sich als zu schlicht, sie konnten in weiteren empirischen Untersuchungen der
4
Dieser Tatsache wird von den Projektverantwortlichen durch die Formulierung zweier Projektziele:
a) Reduzierung der Fallzahl und b) Erhöhung des Sicherheitsgefühls Rechnung getragen.IPoS Theoretische Betrachtungen A-11
folgenden Jahre nicht bestätigt werden. So muss von einer viel komplexeren sozialen
Wirklichkeit ausgegangen werden (die unterschiedlichen, teils konträren
Untersuchungsergebnisse der empirischen Studien zeigen dies), so dass einfache
kausale Aussagen (siehe obiges Beispiel) zu kurz greifen und die Zusammenhänge nicht
hinreichend erklären können (Boers & Kurz 1997).
Inwieweit lässt sich nun aber das Sicherheitsgefühl - nicht einzig auf eine empirische
Studie gestützt - theoretisch einbetten? Die Forschung zum subjektiven Wohlbefinden
könnte hier einen angemessenen Bezugsrahmen bieten. Das subjektive Wohlbefinden
setzt sich nach Mayring (1991) aus vier Komponenten zusammen, die –
faktorenanalytisch gewonnen – auch theoretisch gut begründbar sind:
• Freiheit von subjektiver Belastung
• Zufriedenheit (kognitiver Faktor)
• Freude (kurzfristige, aktuelle und situationsspezifische positive Gefühle)
• Glück (emotionales Glückserleben und langfristiges Lebensglück).
Im Rahmen des Kriminalitätsfurchtkonzeptes kommt dem Faktor Fehlen subjektiver
Belastungen besondere Bedeutung zu. Die Kriminalität wirkt als bedrohlicher, starker
möglicher Stressor.
Crime is one of the most important issues that concern the public and policymakers as
well. In fact, crime has been considered a more important issue than unemployment and
environmental pollution according to major public opinion surveys (DiIulio 1996, zit. nach
Lee & Pinto 2009)
Als Stressor wirksam wird die Kriminalität, indem sie durch Beeinträchtigung des
persönlichen Sicherheitsgefühls negativ auf das subjektive Wohlbefinden eines
Individuums einwirken kann. Werden dann Bezüge zu Stress- und Copingforschung
hergestellt, ist die Möglichkeit „der konzeptuellen Verortung von Kriminalitätsfurcht
gegeben“ (Bilsky 1996, S. 358). Persönliches Sicherheitsgefühl (Abb. 2) wird dabei
definiert als allgemeines Konstrukt, das „das Ausmaß persönlichen Bedrohungserlebens
durch eine Vielzahl möglicher Stressoren aus unterschiedlichsten Lebensbereichen
umfasst“ (Bilsky, Wetzels, Mecklenburg & Pfeiffer 1995, S.75f).
Der dargestellte Abbildungssatz ist zurückführbar auf das von Levy & Guttman (1989
zitiert nach Bilsky 1996) vorgestellte facettentheoretische Modell adjustiven Verhaltens. In
diesem Modell sind Wohlbefinden, Stress und Coping unmittelbar aufeinander bezogen
und z.B. durch die gemeinsamen Facetten des sozialen Umfeldes (primäres vs.
sekundäres Umfeld) und zentraler Lebensbereiche (Arbeit, Finanzen, Soziales, etc.)
näher spezifiziert (Bilsky 1996). Soziales Umfeld und Lebensbereiche wurden auch in
früheren Untersuchungen (Bilsky, Pfeiffer & Wetzels 1993) als Determinanten des
persönlichen Wohlbefindens identifiziert.IPoS Theoretische Betrachtungen A-12
Schädigungen
(materielle )
Person (x) fühlt sich durch mögliche (physische ) Schädigungen
(psychische )
Umfeld
infolge von Ereignissen in ihrem (primären ) sozialen Umfeld
(sekundären )
Lebensbereich RBelastung
(Gesundheit ) (hohe )
(Arbeit ) ( ... )
im Lebensbereich (Finanzen ) belastet Æ (geringe ) Belastung
(Soziales )
(Wohnung )
Abb. 2: Abbildungssatz „Persönliches Sicherheitsgefühl“ (Bilsky et al. 1995, S. 76)
Das persönliche Sicherheitsgefühl (Abb.2) beruht also auf den auch für die Beschreibung
des subjektiven Wohlbefindens relevanten Facetten soziales Umfeld und zentrale
Lebensbereiche. Der Vorteil dieser allgemeinen, nicht nur auf Kriminalität bezogenen
Konzeptualisierung liegt eindeutig in der Möglichkeit des Vergleiches der verschiedenen,
das persönliche Sicherheitsgefühl bedrohenden Faktoren. So können
Beziehungsstrukturen zwischen krimineller Viktimisierung und anderen nicht-kriminellen
Stressoren aufgezeigt werden, gleichzeitig ist eine Einschätzung des Stellenwertes der
persönlichen Bedrohung durch Kriminalität im Vergleich mit anderen belastenden
Umweltfaktoren möglich (Bilsky et al. 1995). Somit ist das Verlassen des einfachen
Erklärungsweges: - je mehr Kriminalität erlebt wird, desto mehr sehen sich die Menschen
in ihrem persönlichen Sicherheitsgefühl bedroht – möglich und es wird eine Einbeziehung
der weiteren relevanten Faktoren, die eben auch durch ihr Einwirken die empfundene
Bedrohung beeinflussen, möglich.
Insofern bietet die Nutzung des facettentheoretischen Ansatzes neben der Einbettung der
Kriminalitätsfurcht in einen theoretischen Rahmen auch die Möglichkeit der weiteren
Ausdifferenzierung des Konstruktes. Beispielsweise kann nicht vermutet werden, dass
„Befürchtungen, die sich auf die vermutete Bedrohung der Gesellschaft und solche, die
sich auf die eigene Person beziehen, vergleichbar oder auch nur ähnlich sind“ (Bilsky et
al. 1995, S. 74). Deshalb wird eine Differenzierung in soziale und personale
Kriminalitätseinstellungen vorgenommen. Erstere beschreiben hauptsächlich die
gesellschaftlichen Anschauungen und politischen Auffassungen, wie z.B. Einschätzung
der Wirksamkeit von Strafe bzw. von Maßnahmen der Kriminalprävention, erfassen alsoIPoS Theoretische Betrachtungen A-13
insgesamt Einschätzungen bezüglich der Bedrohung des Gemeinwesens (Bilsky et al.
1995).
Die persönliche Kriminalitätsfurcht ist davon klar abgrenzbar, denn hiermit wird die
subjektiv wahrgenommene Bedrohung der eigenen Person durch gegen sie gerichtete
strafrechtlich relevante Akte erfasst (Bilsky 1996). Persönliche Befürchtungen bzw.
empfundene Bedrohungen, die persönliche Risikoabschätzung, Opfer von Kriminalität zu
werden, und aus diesen Vorannahmen heraus getroffene Vorsichtsmaßnahmen können
als weitere Differenzierungsmöglichkeiten der persönlichen Kriminalitätsfurcht dienen
(Schwind & Gosling 2002).
Von einigen Autoren (Schwind, Ahlborn & Weiß 1978, Schwind & Gossling 2002) werden
die oben dargestellten Facetten persönliche Kriminalitätsfurcht und
gesellschaftsbezogene allgemeine Besorgnis nicht strikt voneinander getrennt, sondern in
ein Modell integriert (Abb.3). Hier wird Kriminalitätsfurcht bzw. Bedrohtheitsgefühl als
zusammengesetztes Konstrukt wahrgenommen, das aus drei Faktoren - konkret aus
affektiver, kognitiver und konativer Komponente – besteht. Zu beachten ist hier, dass die
einzelnen Faktoren nicht mehr als Komponenten personaler Kriminalitätsfurcht, sondern
allgemein als Kriminalitätsfurchtkomponenten gesehen werden. Diese, in Deutschland
erstmals 1978 im Rahmen der Bochum I – Untersuchung von der Forschungsgruppe um
Schwind (Schwind et al. 1987) beschriebenen Faktoren sollen im Folgenden kurz skizziert
werden:
• Affektive (gefühlsbezogene) Komponente
Sie kommt am ehesten in einer globalen Aussage über das allgemeine Gefühl
der in der tagtäglichen Umgebung erlebten Sicherheit bzw. Unsicherheit zum
Ausdruck (Schwind et al. 1978). Neben diesem – eher deliktunspezifischen –
(Un)sicherheitsgefühl gehört zu dieser Komponente auch die unter
Viktimisierungsfurcht erfasste Besorgnis, innerhalb eines definierten Zeitraumes
selbst Opfer einer bestimmten Straftat zu werden (Schwind et al. 1978; Schwind
& Gossling 2002)
• Kognitive (verstandesbezogene) Komponente
Dieser Aspekt der Kriminalitätsfurcht wird ebenfalls auf zwei Ebenen erfasst.
Zum einen durch eine allgemeine Einschätzung der Kriminalitätsentwicklung5,
zum anderen durch die Viktimisierungserwartungen, d.h. die Wahrnehmung und
Bewertung von persönlichen Viktimisierungsrisiken. Dazu zählt beispielsweise
die Erwartung, innerhalb eines festgelegten Zeitraumes selbst Opfer einer
(spezifizierten) Straftat zu werden.
• Konative (verhaltensbezogene) Komponente
Diese Facette beschreibt die von einem Individuum auf Grund seiner
persönlichen Viktimisierungserwartungen bzw. seiner Unsicherheitsgefühle
getroffenen Maßnahmen, die vor möglichen Straftaten schützen sollen. Hier
lassen sich eher aktive Abwehrmaßnahmen (z.B. Sichern der Wohnung,
5
Durch den Einbezug dieses Faktors wird explizit auch die gesellschaftliche Besorgnis bezüglich
der Entwicklung der Kriminalität erhoben, somit ist eine Integration von gesellschaftsbezogenen
Unsicherheiten und persönlicher Kriminalitätsfurcht gelungen und die Ausdifferenzierung des
Gesamtkonstruktes Kriminalitätsfurcht in die drei hier dargestellten Faktoren erscheint plausibel.IPoS Theoretische Betrachtungen A-14
Anschaffung eines Wachhundes oder Anwendung der künstlichen DNA) und
eher passives Vermeidungsverhalten unterscheiden. Letzteres umfasst den
Versuch, möglichen Gefahren auszuweichen oder sich diesen nicht auszusetzen
z.B. durch Meiden bestimmter Gebiete, bestimmter Personengruppen oder
Situationen z.B. dadurch, dass bei Dunkelheit das Haus nicht mehr verlassen
wird.
Komponenten des Bedrohtheitsgefühls bzw.
der Kriminalitätsfurcht
affektive kognitive konative
(gefühlsbezogene) (verstandesbezogene) (verhaltensbezogene)
Komponente Komponente Komponente
↓ ↓ ↓
- Unsicherheitsgefühl - Einschätzung der -Vermeidungsverhalten
- Viktimisierungsfurcht Kriminalitätsentwicklung - Abwehrverhalten
- Viktimisierungserwartung
Abb. 3: Zusammensetzung der Kriminalitätsfurcht aus drei Komponenten (Schwind & Gossling 2002)
In den Ausführungen wird deutlich, dass Sicherheitsgefühl als eine Facette im Konzept
Kriminalitätsfurcht darstellbar ist. Das Ausmaß der empfundenen Sicherheit, also die
„subjektive, emotionale und individuelle Antwort auf die Frage, ob sich ein Mensch sicher
fühlt“ (Schewe 2009, S. 18) bedingt also zu einem nicht unerheblichen Teil die
empfundene Kriminalitätsfurcht mit. Menschen orientieren sich in ihrer persönlichen
Bewertung nicht nur an objektiv messbaren Deliktshäufigkeiten (dargestellt beispielsweise
in der PKS), die emotionalen (affektiven) Bewertungen spielen ebenso eine große Rolle
und führen möglicherweise durch konkrete Handlungen bzw. das Vermeiden dieser
Handlungen (konative Ebene) zu negativen Auswirkungen auf die empfundene
Lebensqualität der Betroffenen. Insofern verwundert es nicht, dass das Sicherheitsgefühl
der Bevölkerung in den letzten Jahren verstärkt in den Blickpunkt der polizeilichen Arbeit
geraten ist und verstärkt Maßnahmen getroffen werden, dieses zu erhöhen: „Die Polizei
ergreift vermehrt Maßnahmen, die nicht nur der Abwehr von Gefahren für die objektive
Sicherheit, sondern – zumindest teilweise – dem Zweck dienen, das Sicherheitsgefühl der
Bevölkerung zu verbessern. Der Bürger soll sich wieder sicher fühlen (Schewe 2009, S.
22; vgl. auch PDV 100) Und genau dies ist eines der beiden für das von der Bremer
Polizei in Kooperation mit SelectaDNA durchgeführte Pilotprojekt „Forensische
Markierung mit künstlicher DNA – Prävention durch Abschreckung“ formulierten
Projektziele. Wie bereits eingangs erläutert, sind Einbruchsdiebstähle aus verschiedenenIPoS Theoretische Betrachtungen A-15 Gründen (z.B. Häufigkeit, geringe Aufklärungsquote, Eindringen in den intimsten Raum der Betroffenen, wenig Erkenntnisse über wirksame Präventionsstrategien) neben den Sexualdelikten eine der am meisten gefürchteten Straftaten in Deutschland. In einer Umfrage der R+V-Versicherung im Jahr 2002 gaben 16 % der Befragten an, sie hätten große Angst davor, Opfer eines Einbruchs zu werden, dagegen hatten nur 14 % der Befragten Angst, Opfer eines Raubüberfalles zu werden (DFK 2003). Diese exemplarisch genannten Zahlen entsprechen nicht der tatsächlichen Bedrohungslage, zeigen aber einmal mehr, wie stark die subjektive Komponente, also die emotionalen Befindlichkeiten (Ängste, Furcht) die objektive Einschätzung bzw. die Wahrnehmung des objektiven Viktimisierungsrisikos beeinflussen. Nochmalig Bezug nehmend auf die PDV 100, in der es heißt, dass sich die Polizei auch am Sicherheitsempfinden der Bürger zu orientieren hat (PDV 100), sind hier Strategien gefragt, die beide Bereiche (objektive Falleinschätzung und subjektive (Un)sicherheit, Furcht vor Einbruchsdiebstählen) ansprechen. Das Pilotprojekt “Künstliche DNA“ – Prävention durch Abschreckung verbindet beide Elemente. Durch Abschreckung der potentiellen Täter sollen Einbruchsdiebstähle verhindert werden und somit die Fallzahlen für dieses Delikt sinken, dies soll zur wahrgenommenen Reduzierung des jeweils eigenen Viktimisierungsrisikos in der Bevölkerung führen und schließlich soll durch die Beschäftigung mit der Thematik und den daraus resultierenden Verhaltensweisen z.B. eben auch durch die Markierung der eigenen Wertgegenstände mit „künstlicher DNA“ (aktives Abwehrverhalten) im konativen Bereich ein Beitrag zur Vergrößerung des Sicherheitsgefühls geleistet werden. Die Messung und Darstellung der Veränderung im wahrgenommenen Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist – sicher auch in Anbetracht der dargestellten theoretischen Verortung und Verwurzelung im Kriminalitätsfurchtkonzept - ein schwieriges Unterfangen. Dies betrifft sowohl die Frage, wie Kriminalitätsfurcht valide gemessen werden kann, als auch die Frage, ob eine Veränderung der Kriminalitätsfurcht kausal auf eine Ursache wie z.B. die Verwendung der „künstlichen DNA“ zurückgeführt werden kann. Eine Untersuchung der zuletzt genannten Frage wurde nicht in den vorliegenden Evaluationsauftrag aufgenommen. Die Messung der Veränderung der Kriminalitätsfurcht hätte vorausgesetzt, dass vor Beginn des Projektes der Ausgangswert in den Pilotregionen in Bremen und Bremerhaven valide erfasst worden wäre. Da der Auftrag zur Evaluierung des Projektes erst nach Projektbeginn erteilt wurde, war eine Messung des Ausgangswertes nicht mehr möglich. Allerdings können mittels der im Rahmen der Untersuchung durchgeführten Bevölkerungsbefragung einzelne Aspekte des Konzeptes „Sicherheitsgefühl“ wie etwa die Nutzung der „künstlichen DNA“ als aktives Vermeideverhalten oder die subjektive Bewertung dieser Nutzung als individuelle oder gesellschaftliche Präventionsstrategie untersucht werden. Daraus lassen sich auf der Grundlage der hier erörterten theoretischen Aspekte des „Sicherheitsgefühls“ plausible Aussagen über mögliche Wirkungen des Einsatzes der „künstlichen DNA“ ableiten.
Sie können auch lesen