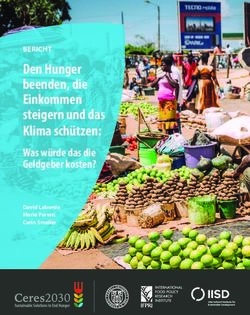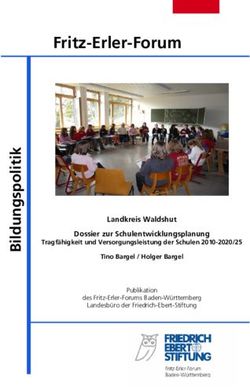Energie- und Klimaschutzkonzept - Dresden.de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Energie- und Klimaschutzkonzept Verfasser: Brendel Ingenieure Dresden GmbH Hermannstraße 2 01219 Dresden Tel.: 0351 – 27127 0 Fax: 0351 – 27127 66 E-Mail: dresden@brendel-ing.de Dresden, den 06.10.2020
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Inhaltsverzeichnis Einleitung ..................................................................................................... 5 Beschreibung des Vorhabens ...................................................................... 6 Gebäudehülle und Energieeffizienz ............................................................. 9 Analyse des Energiebedarfs ...................................................................... 11 Wärmebedarf ......................................................................................... 11 Kälte- und Hilfsenergiebedarf ................................................................ 13 Strombedarf ........................................................................................... 14 Vorgaben für die Energieversorgung ..................................................... 15 Energieversorgungskonzepte .................................................................... 16 Potenziale für Einsatz Erneuerbarer Energien ....................................... 16 Potenziale für Quartiersversorgung oder dezentrale Versorgung .......... 21 Auswahl der Technologien zur Energieversorgung ............................... 22 Bau- und Versorgungskonzepte ............................................................ 22 Konzept A: Fernwärmeanschluss + Stromnetz .................................. 22 Konzept B: BHKW + Gas-Brennwertgerät + Stromnetz ..................... 24 Bewertung der Bau- und Versorgungskonzepte ........................................ 28 Methodik der Bewertung ........................................................................ 28 Vergleich der Konzepte.......................................................................... 29 Auswahl der Vorzugslösung .................................................................. 39 Optimierung der Fernwärme ...................................................................... 40 CO2-Emission der Varianten .................................................................. 42 Kosten der Varianten ............................................................................. 44 Schlussfolgerungen.................................................................................... 46 Seite: 2
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Abbildung 1 Lageplan BP 3029 [TSSB] ......................................................... 6 Abbildung 2 Räumlicher Geltungsbereich BP 3029 [TSSB] ........................... 7 Abbildung 3 Ausschnitt Fernwärmenetz Dresden [DREWAG-FW]................. 8 Abbildung 4 Schaubild Erneuerbare Energien [EE] ....................................... 16 Abbildung 5 Themenstadtplan Erdwärme [DDTS_EW] .................................. 17 Abbildung 6 Vergleich der Energiebedarfswerte ............................................ 29 Abbildung 7 Gegenüberstellung der CO2-Emissionen der Varianten ............ 38 Tabelle 1 Wärmebedarfsberechnung Heizlast [BI] ......................................... 11 Tabelle 2 Wärmebedarfsberechnung Trinkwarmwasserbereitung [BBSR] .... 12 Tabelle 3 Strombedarfsberechnung ............................................................... 14 Tabelle 4 Entzugsleistung Erdwärme am Standort [UmweltSachsen]............ 17 Tabelle 5 Potenzial PV-Anlage ...................................................................... 20 Tabelle 6 Energiebilanzierung Variante A ...................................................... 23 Tabelle 7 CO2-Bilanzierung Variante A .......................................................... 23 Tabelle 8 Anteile Energiebilanzierung Variante B .......................................... 25 Tabelle 9 Energiebilanzierung Variante B ...................................................... 26 Tabelle 10 CO2-Bilanzierung Variante B ........................................................ 27 Tabelle 11 Investitionskosten der Varianten .................................................. 30 Tabelle 12 Kapitalgebundene Annuität der Varianten (Grundlagen) .............. 31 Tabelle 13 Kapitalgebundene Annuität der Varianten .................................... 32 Tabelle 14 Bedarfsgebundene Kosten (Grundlagen) ..................................... 33 Tabelle 15 Bedarfsgebundene Kosten ........................................................... 34 Tabelle 16 Betriebsgebundene Kosten der Varianten (Grundlagen) .............. 35 Tabelle 17 Betriebsgebundene Kosten der Varianten .................................... 36 Tabelle 18 Annuität der Jahresgesamtzahlungen der Varianten .................... 37 Tabelle 19 Gegenüberstellung der Ergebnisse .............................................. 39 Tabelle 20 Übersicht Fernwärmeoptimierung ................................................ 41 Seite: 3
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Tabelle 21 Rohrleitungslängen Tiefgarage .................................................... 42 Tabelle 22 Thermische Verlustleistung .......................................................... 42 Tabelle 23 Wärmeverluste aus Zirkulation ..................................................... 43 Tabelle 24 Energieverbräuche thermisch....................................................... 43 Tabelle 25 CO2-Emission der Systeme .......................................................... 44 Tabelle 26 Investitionskosten der Varianten .................................................. 45 Tabelle 27 Bedarfsgebundene Kosten der Varianten..................................... 45 Seite: 4
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Einleitung Die Landeshauptstadt Dresden hat es sich zum Ziel gesetzt, die spezifischen Treibhausgasemissionen aller fünf Jahre um mindestens zehn Prozent zu senken. Bis 2030 soll, ausgehend vom Wert im Jahr 2005 (9,9 Tonnen pro Einwohner), die CO2-Emission pro Einwohner auf 5,8 Tonnen im Jahr reduziert werden. Weiterhin wird das Ziel der Bundesregierung einer Klimaneutralität bis 2050 angestrebt. Dies beinhaltet eine Reduktion der Emission zwischen 85 - 95 % gegenüber dem Jahr 2016. Um dieses Ziel zu erreichen wurde ein gesamtstädtisches Konzept erstellt. Über 50 Maßnahmenpakete wurden in der Stadt verabschiedet. Eine Umsetzung muss allerdings auch in Einzelprojekten und Quartiersbauten erfolgen. Hier beschloss der Stadtrat im Jahr 2019, dass zu Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen Energie- und Klimaschutzkonzepte zu erstellen sind. Die eingesetzte Energie soll effizienter verwendet und mit der größtmöglichen Menge an regenerativer Technik kombiniert werden. Bilanzierungs- und Beurteilungsgröße ist die CO2-Emission der Varianten. Die Auswahl des Versorgungskonzeptes findet zusätzlich anhand der ermittelten Kosten statt. Alle Untersuchungen werden standortbezogen durchgeführt. In diesem Konzept wird eine Empfehlung für die Energieversorgung eines Bauvorhabens im Westteil des Stadtbezirks Neustadt erstellt und begründet. Das Ergebnis berücksichtigt die Punkte CO2-Emission sowie Investitions- und Betriebskosten im geforderten Maße. Insgesamt ist der Bebauungsplan durch eine vielfältige Nutzungsstruktur geprägt. Er wird sowohl Gewerbe- und Büroeinheiten enthalten als auch einen Schwerpunkt auf die Wohnnutzung legen. Seite: 5
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Beschreibung des Vorhabens Der Bebauungsplan beinhaltet vier Blöcke aus mehreren Gebäuden [Abbildung 1], wobei drei über eine gemeinsame Tiefgarage verbunden sind. Der vierte Block an der angrenzenden Lößnitzstraße erhält eine eigenständige Tiefgarage. Dem Bestand zugehörig liegt ein Lokschuppen am südlichen Ende des Bebauungsgebiets. Aufgrund der bisher ungeklärten Nachnutzung wird dieser in den weiteren Teilen des Konzepts ausgeklammert. Grundsätzlich ist eine Anbindung an die Medienversorgung der restlichen Blöcke bzw. eine kongruente Versorgung denkbar. Auch an dieser Stelle sollte eine klimafreundliche Energieversorgung erfolgen. D A C B Abbildung 1 Lageplan BP 3029 [TSSB] Das Bebauungsgebiet wird vorwiegend für den Bau von Wohnungen genutzt. Hinzu kommen Gewerbeeinheiten verschiedener Größe. Basis der weiteren Betrachtungen ist der angestrebte Effizienzhausstandard der Gebäude nach EnEV 2013 mit Verschärfung nach EnEV 2016. Alle Bauten werden entsprechend den gültigen EnEV-Anforderungen zum Zeitpunkt der Planung ausgeführt. Erhöhte Standards der thermischen Gebäudehülle sind nicht geplant. Seite: 6
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Standortanalyse Der Neubau des „Bogenviertels“ an der Hansastraße ist im westlichen Teil der Dresdner Neustadt verortet. [Abbildung 2] Um eine bessere Verständlichkeit zu gewährleisten wird das Bauvorhaben im Weiteren mit „BVH“ für Bogenviertel Hansastraße abgekürzt. Das Planungsgebiet wird umgrenzt vom Neustädter Bahnhof in südlicher Lage, dessen Schienennetz zusätzlich den östlichen Teil der Fläche einrahmt. Im Norden befinden sich als Begrenzung Bestandwohngebäude an der Lößnitzstraße sowie letztendlich die Lößnitzstraße selbst. Den westlichen Abschluss bildet die Hansastraße. Abbildung 2 Räumlicher Geltungsbereich BP 3029 [TSSB] Es ist eine Gasdruckregelstation im Bestand vorhanden. Diese wird nach dem aktuellen Bebauungsplan an einer anderen Stelle auf dem Grundstück wiederaufgebaut. Außerdem ist das BVH vom Stromnetz der DREWAG umgeben. Geplant ist der Neubau einer Trafostation am südlichen Ende. Das Areal liegt im Ausbaugebiet des Fernwärmenetzes Dresden. [Abbildung 3] Eine Anbindung an dieses Netz sollte nicht zuletzt aufgrund des vorteilhaften Primärenergiefaktors (0,23) bevorzugt betrachtet werden. [DREWAG-FW] Seite: 7
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Abbildung 3 Ausschnitt Fernwärmenetz Dresden [DREWAG-FW] Eine vollständige Aufstellung der Medienversorgung im Bestand kann dem Leitungsplan im Bestand von [IPRO] entnommen werden. Seite: 8
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Gebäudehülle und Energieeffizienz Das Energiekonzept setzt sich aus den Maßnahmen der Technischen Ausrüstung sowie den baulichen (Dämm-)Maßnahmen an der Gebäudehülle zusammen. Der energetische Nachweis des Gebäudes und der Anlagentechnik erfolgt auf der Basis von Berechnungen nach der Energieeinsparverordnung EnEV 2013 unter Beachtung des EEWärmeG 2011. Ein KfW-Effizienzhaus-Standard wird seitens des Grundstückseigentümer nicht gewünscht. Die Gebäude sind – abgesehen vom Gewerbeflächenanteil – als neu zu errichtende, normal beheizte Wohngebäude nach § 3 EnEV 2013 mit Innentemperaturen ≥ 19 °C zu betrachten. Die seit 01.01.2016 geltende Verschärfung der Anforderungen für Neubauten ist zu beachten. Für die Gebäudehülle ist der Höchstwert des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissions- wärmeverlustes H’T zu begrenzen. Diese Zahl entspricht einem mittleren Wärmedurchgangswert (U-Wert) der Gebäudehülle. Für die Vorbetrachtungen können zunächst die U-Werte der Referenzausführung nach EnEV, Anlage 1, Tabelle 1 herangezogen werden. Die Auslegung der Außenbauteile erfolgt dabei unter Beachtung des Faktors von 0,75 (Verschärfung seit 01.01.2016). Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt die entsprechenden Anforderungen im Vergleich zu einem KfW-Effizienzhaus 55 nach Referenzwerten: Auszug aus „Anlage zum Merkblatt Energieeffizient Bauen – Technische Referenzausführung Mindestanforderungen“ (KfW-Kredit Programm 153); Temp. Wohnhaus nach EnEV (mit (Warmwasser) Verschärfung) Dachflächen, oberste Geschossdecke, Dachgauben: U ≤ 0,14 W/(m²K) 0,15 W/(m²K) Fenster und sonstige transparente Bauteile Uw ≤ 0,90 W/(m²K) 1,00 W/(m²K) Dachflächenfenster Uw ≤ 1,0 W/(m²K) 1,05 W/(m²K) Außenwände, Geschossdecken nach unten gegen U ≤ 0,20 W/(m²K) 0,21 W/(m²K) Außenluft Sonstige opake Bauteile (Kellerdecken, Wände und Decken zu unbeheizten Räumen, Wand- und Bodenflächen gegen U ≤ 0,25 W/(m²K) 0,26 W/(m²K) Erdreich, etc.) Türen (Keller- und Außentüren) UD ≤ 1,2 W/(m²K) 1,35 W/(m²K) Vermeidung von Wärmebrücken ΔUWB ≤ 0,035 W/(m²K) 0,050 W/(m²K) n50 ≤ 1,5 h-1 Luftdichtheit der Gebäudehülle analog KfW q50 ≤ 2,5 h-1 Seite: 9
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Es ist erkennbar, dass der Unterschied bei Neubauten zwischen aktuellen Anforderungen der EnEV im Vergleich zu einem KfW Effizienzhaus 55 bei den Anforderungen an die Flächenbauteile nur im Bereich zwischen 5 - 10 % liegt. Die Anforderungen an die Wärmebrücken gewinnen beim KfW-Effizienzhaus rechnerisch deutlich an Bedeutung. Bei einer üblichen Ausführung nach den Beispielen in Beiblatt 2 zu DIN 4108-2 bestehen jedoch auch hier keine signifikanten Unterschiede zwischen EnEV-Neubaustandard und KfW- Effizienzhaus 55. Bei Ausführung der Gebäudehülle nach den aktuellen gesetzlichen Mindestanforderungen – nach den Referenzwerten eines EnEV- Wohngebäudes – wird ein sehr hoher Dämmstandard umgesetzt. Eine weitere Verbesserung in Richtung eines Effizienzhauses (z.B. KfW 55) entsteht kein nennenswerter Energieeffizienzgewinn, der die deutlich höheren Baukosten rechtfertigen würde. Da die Primärenergieanforderung für ein KfW-Effizienzhaus 55 durch die Fernwärmeversorgung per se erfüllt wird, geht es an dieser Stelle ausschließlich um die Bewertung der Gebäudehülle. Es handelt sich um den Vergleich der Bauteilanforderungen (U-Werte) und nicht um einen prozentualen Vergleich des Energiebedarfs. Ein direkter Zusammenhang zwischen U-Werten und Energieeinsparung wird nicht hergeleitet. Die KfW-Anforderung an den Energiebedarf bezieht sich auf den Primärenergiebedarf QP im Verhältnis zu QP,REF und nicht auf den Endenergiebedarf. Es kann daher aus dieser Größe kein direkter Vergleich des Energiebedarfs bzw. eine Energieeinsparung / Klimarelevanz abgeleitet werden. Da von Bauherrenseite ein KfW-Effizienzhausstandard keine Zielgröße ist, erfolgen hierzu auch keine weiteren planerischen Untersuchungen. Seite: 10
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Analyse des Energiebedarfs Wärmebedarf In diesem Kapitel soll die Grundlage für weitere versorgungstechnische Betrachtungen der Gebäude gelegt werden. Der Wärmebedarf der Objekte wird im Rahmen der Heizlastberechnung für die Auslegung der Wärmeerzeugung bestimmt. Eine detaillierte Heizlastberechnung wird in der Leistungsphase 3 der HOAI nach DIN EN 12831 erfolgen. Aus diesem Grund bezieht sich die Berechnung der Heizlast in dieser Phase auf flächen- bezogene Bedarfskennzahlen aus Referenzprojekten, Studien und anerkannten Größen der Technik. Als Referenz (Ref) wird ein ähnliches Wohnbauprojekt in Dresden gewählt, welches sich bei Brendel Ingenieure derzeit in der Leistungsphase 4 befindet. Die Heizlastberechnung ist abgeschlossen und die flächenbezogenen Kennwerte können Verwendung finden. Zur Verdeutlichung der Eignung des Referenzobjekts sind in Tabelle 1 allgemeine flächenbezogene Grundlagen aufgelistet. Dabei wird die durchschnittliche, spezifische Heizlast pro Fläche aus der Heizlastberechnung der Referenz auf die Fläche des BVH angewandt. Zu besseren Verständlichkeit sind die dargestellten Ergebnisse gerundet. Grundlage ist der Stand der Architektur von 02.06.2020. Tabelle 1 Wärmebedarfsberechnung Heizlast [BI] Heizung Ref BVH Grundlagen Anzahl Wohneinheiten/ Boarding St 200 254 Anzahl Gewerbe St 3 13 Fläche Wohneinheiten m² 11.292 19.637 Fläche Gewerbe m² 324 2.256 beheizte Fläche m² 11.600 21.900 Gebäudetechnische Werte spezifische Heizlast W/m² 30 30 Heizlast kW 330 660 Vollbenutzungsstunden1 h/a 1.800 1.800 Jahreswärmeenergie Heizung MWh/a 590 1.190 1 empirisch anerkannte Größe der Planungspraxis (VDI 2067:1993-12) Der Anteil zur Trinkwarmwassererzeugung wird anhand eine Formel zur Abschätzung des nutzflächenbezogenen Trinkwarmwasserwärmebedarfs Seite: 11
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen)
Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße
berechnet. Als Quelle dient eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt-
und Raumforschung aus dem Jahr 2017 über den „Nutzenergiebedarf für
Warmwasser in Wohngebäuden“. [BBSR] In der Publikation wurden mehrere
Datenquellen verwendet, um eine möglichst genaue Abbildung der Realität
zu erreichen. Darunter fallen auch Daten aus den abrechnungsrelevanten
Messwerten von über 2 Mio. Mehrfamilienhäusern. Im Ergebnis wurde eine
allgemein anwendbare Näherungsgleichung (1) erzeugt, die zur Berechnung
des Trinkwarmwasserbedarfs verwendet wird. [BBSR]
1 ℎ
= {15 − ( , , ∙ 0,04 2
)} (1)
² ∙
... Nutzflächenbezogener Trinkwarmwasser-
wärmebedarf in kWh/m²·a
, , ... Mittlere Nutzfläche der Wohneinheiten in m²
wobei:
, , = /
... Nutzfläche des Gebäudes in m²
... Anzahl der Wohneinheiten
Nebenbedingung:
ℎ
≥ 7
² ∙
Grundlage ist der Stand der Architektur von 02.06.2020. Wird die Formel
entsprechend angewandt, ergibt sich folgendes Ergebnis:
Tabelle 2 Wärmebedarfsberechnung Trinkwarmwasserbereitung [BBSR]
Trinkwarmwasser BVH
Grundlagen
Anzahl Wohneinheiten St 254
Anzahl Gewerbe St 13
Summe der Einheiten (nWE) St 267
Fläche Wohneinheiten m² 19.637
Fläche Gewerbe m² 2.256
beheizte Fläche (AN ) m² 21.900
Gebäudetechnische Werte
AN,WE,m m² 82
qtw kWh/m²·a 11,7
Jahreswärmeenergie Warmwasser MWh/a 260
Seite: 12B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Der Mittelwert aus der Studie des Bundesinstituts bestätigt den an dieser Stelle errechneten Wert mit 11,7 kWh/m²·a. Aus den Anteilen der Jahreswärmeenergie Heizung und Warmwasser lässt sich in Summe der Jahreswärmeenergiebedarf des gesamten Komplexes berechnen. An dieser Stelle ergibt sich für das Bauvorhaben Bogenviertel Hansastraße ein Gesamtjahreswärmeenergiebedarf von 1.450 MWh/a. Aus dieser Kenngröße lässt sich die zu installierende Heizleistung über die Vollbenutzungsstunden überschlägig ermitteln. Damit resultiert eine zu installierende Heizleistung von ca. 810 kW. Kälte- und Hilfsenergiebedarf Eine zentrale aktive Kühlung ist im Wohnungsbau derzeit nicht üblich. Es wird ein Kältebedarf ausschließlich für die Gewerbeeinheiten erforderlich. Das vielfältige Nutzungskonzept umfasst 13 Gewerbeeinheiten. Aus der Lage und Größe im Objekt ist zu schließen, dass diese sowohl Kleingewerbe als auch den Lebensmitteleinzelhandel bzw. Drogerie umfassen können. Da zum jetzigen Zeitpunkt keine definierte Nutzung vorliegt, kann der technische Kältebedarf nicht bestimmt werden. Die benötigte Einrichtung wird gegebenenfalls vom jeweiligen Mieter in einer dezentralen Variante gestellt und installiert. Aus diesem Grund wird der Bedarf an Kälte in diesem Energie- und Klimakonzept vernachlässigt. Es wird davon ausgegangen, dass die gewerblichen Kleinkälteanlagen in die nutzerspezifische Wärmerück- gewinnung einbezogen werden. Der Anteil an Hilfsenergie wird in die Betrachtung des Strombedarfs der einzelnen Einheiten inkludiert. Dazu zählt auch die gegebenenfalls notwendige, dezentrale Einzelraumlüftung. Eine detailliertere Betrachtung ist aufgrund des derzeitigen Planungsfortschritts nicht möglich. Seite: 13
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Strombedarf Neben dem Wärmebedarf ist auch der Strombedarf eine Grundlage für die Betrachtung der Energiebedarfe und CO2-Emissionen. Anhand der Flächenaufteilung zum Bebauungsplan wurden die Jahresstromverbräuche getrennt für Gewerbe und Wohneinheiten berechnet. [TSSB] Basis ist der durchschnittliche Stromverbrauch für den Einzelhandel sowie die Angaben der [DREWAG-STROM] zu angesetzten Jahresstromverbräuchen für Wohnungen nach Personenanzahl. Die elektrische Leistung ergibt sich nach DIN 18015:2013-09. Grundlage ist der Stand der Architektur von 02.06.2020. Tabelle 3 Strombedarfsberechnung spez. Jahres- Jahres- el. Leistungs- Strom Anzahl 1 Ø-Größe 1 Personen2 stromverbrauch3 stromverbrauch bedarf4 St m² Per/WE kWh/BZE·a kWh/a kWel Nebenräume Gewerbe 13 - - 8.041 104.500 81 Boarding 35 31,2 0,7 791 27.700 - Sonstiges 3 - - 90 300 0 Summe 51 - 8.920 132.500 80 Wohneinheiten 1-Raumwohnung 13 34 0,7 849 11.000 - 2-Raumwohnung 38 59 1,2 1.500 57.000 - 3-Raumwohnung 89 81 1,7 1.791 159.400 - 4-Raumwohnung 59 101 2,1 2.250 132.700 - 5-Raumwohnung 20 134 2,8 2.261 45.200 - Summe 219 - - - 405.300 150 Gesamtsumme 270 - - - 537.800 230 1 [TSSB] 2 Durchschnittliche Einw ohnerzahl pro 90 m² Wohneinheit Statistikstelle Landeshauptstadt Dresden 3 BZE = Bezugseinheit; [FRAUNHOFER]; [BI]; berechnet nach dem Anteil durchschnittlicher Einw ohneranzahl in Mehrfamilienhäusern (1,9 EW/90m²WE) Statistikstelle Landeshauptstadt Dresden und Verbrauchsdaten [DREWAG-STROM] 4 [DIN18015:2013-09] Der elektrische Leistungsbedarf liegt somit bei 230 kWel mit einem jährlichen Stromverbrauch von ca. 537.800 kWh/a. Seite: 14
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Vorgaben für die Energieversorgung Von Seiten des Grundstückseigentümers liegt aus der Erfahrung mit anderen Bauvorhaben das Interesse an einer Versorgung über das Fernwärmenetz. Dieser Ansatz entspricht zudem den Empfehlungen der Stadt Dresden. Geplant ist die Wärmeversorgung der Wohnungen über eine Niedertemperatur-Flächenheizung. Zur Vermeidung übermäßigen technischen Aufwands wird die Tiefgarage außerhalb der thermischen Hülle der Gebäude angesiedelt. Damit kann gegebenenfalls eine natürliche Be- und Entlüftung der Tiefgarage sowie eine Entrauchung über bauliche Öffnungen erreicht werden. Dies sollte in einem gesonderten Gutachten nachgewiesen werden. An dieser Stelle wird vorerst von einer natürlichen Lüftung der Tiefgarage ausgegangen. Damit ist kein zusätzlicher energetischer Bedarf anzurechnen. Seite: 15
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Energieversorgungskonzepte Potenziale für Einsatz Erneuerbarer Energien Es ist möglich, fünf Formen an erneuerbaren Energien auf unterschiedliche Weise zu nutzen. In Abbildung 4 sind die fünf verfügbaren Energiequellen dargestellt. Doch nicht immer sind alle Formen am jeweiligen Standort vorhanden bzw. können technisch sinnvoll sowie wirtschaftlich genutzt werden. Abbildung 4 Schaubild Erneuerbare Energien [EE] Aus diesem Grund dient das folgende Kapitel zur Evaluierung der Nutzung erneuerbarer Energien zur Versorgung des Standorts. In diesem Zusammenhang wird für jede Energieform die Verfügbarkeit und technische Umsetzung am Standort geprüft. Einflussgrößen sind das Verhältnis von Energiebedarf/-verfügbarkeit und Flächenbedarf/-verfügbarkeit. Ein weiteres Kriterium nach dem Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz – EEWärmeG) ist die Wahrung der wirtschaftlichen Vertretbarkeit. Das heißt, die Nutzung erneuerbarer Energien ist nur dann möglich, wenn diese ohne Gefährdung der Gesamtwirtschaftlichkeit des Bauvorhabens eingesetzt werden können. In diesem Abschnitt werden Empfehlungen zur sinnvollen Nutzung von erneuerbaren Energien ausgesprochen. Die Einhaltung des EEWärmeG ist Aufgabe des Erstellers des Gebäudeenergieausweises in einer späteren Planungsphase. Erdwärme Die dem Erdboden entnommene Wärme ist eine Form der erneuerbaren Energien, die vor allem von der geologischen Beschaffenheit des Standorts bestimmt wird. Zur Prüfung der Verfügbarkeit dienen in dieser Seite: 16
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Planungsphase Karten, welche die wasserrechtlichen Vorgaben in dem Gebiet ausweisen. [DDTS_EW] Abbildung 5 Themenstadtplan Erdwärme [DDTS_EW] In Abbildung 5 ist erkennbar, dass der Standort in einem hydrogeologisch kritischen Gebiet angesiedelt ist. Zur Genehmigung der Nutzung von Erdwärme ist ein Erlaubnisverfahren notwendig. Aufgrund der geplanten Überbauung des Grundstücks (Abbildung 1) existieren kaum Möglichkeiten zur Bohrung in freien Bereichen. Bohrungen unter der Bodenplatte sind mit einem höheren planerischen und ausführungstechnischen Aufwand verbunden. Die Berechnung der möglichen Entzugsleistung anhand der Bohrungen unter Berücksichtigung der Mindestabstände und der spezifischen Entzugsleistung für den Standort erfolgt in Tabelle 4. [UmweltSachsen] Tabelle 4 Entzugsleistung Erdwärme am Standort [UmweltSachsen] Erdwärme BVH Bohrungen St 25 spez. Entzugsleistung (100m) W/m 50 Tiefe m 100 Entzugsleistung kW 125 Seite: 17
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Die mögliche Anzahl an Bohrungen deckt den benötigten Wärmeanteil zu 17 %. Zieht man den technologischen und genehmigungsrechtlichen Aufwand sowie die entstehenden Investitionskosten hinzu, stellt sich die Verwendung von Geothermie als Grundlastdeckung als nicht ausreichend dar. Bioenergie Bioenergie, also die Energie aus organischen Stoffen steht in der Realität oft in Konkurrenz mit einer stofflichen Nutzung. Im Bereich der Gebäudebeheizung sind Holzheizsysteme am meisten verbreitet. Sie können mono- und bivalent einen Einsatz finden. Allerdings sind die Bedingungen am Standort genauestens zu überprüfen. Denn die Feuerung mit Biomasse ist vor allem sinnvoll, wenn ein großer Holzbestand in der Nähe genutzt bzw. der Brennstoff aus Abfallprodukten gewonnen werden kann. Im jetzigen Projekt kann die Verwendung von Biomasse ausgeschlossen werden, da keine Nutzung durch Abfallprodukte (z.B.: aus einer Produktion) am Standort vorliegen. Eine Verwendung von Stückholz bzw. Holzhackschnitzeln steht dem Bedarf an Baustoffen entgegen, der Transport des Brennstoffs in dieser Größenordnung dem Gedanken der CO2-Reduktion. Wasserkraft Die Energieumwandlung aus der kinetischen Energie von Wasser wird vor allem durch Großproduzenten von Strom zur Versorgung ganzer Städte und Gemeinden genutzt. Die Anwendung im privaten Bereich und zur Versorgung einzelner Wohnquartiere ist in der Region nicht üblich. Besonders im innerstädtischen Bereich liegt der Schwerpunkt an der Anbindung an vorhandene Versorgungsnetze. Diese können unter Umständen ganz oder zum Teil aus Wasserkraft gespeist werden. Die notwendigen topographischen Gegebenheiten müssen dafür vorliegen. Die Lage und Größe des Bauvorhabens schließt die Nutzung von Wasserkraft grundsätzlich aus. Windenergie Für die Gewinnung von Strom aus Windenergie existieren in Sachsen bisher keine Abstandsempfehlungen. [FAWE] Allerdings wir die Genehmigung auch vom Bundesimmissionsschutzgesetz bedingt. Dieses schützt die umliegenden Bürger vor übermäßigen Lärm. Aus diesem Grund und bedingt durch die Beeinflussung des städtischen Bildes ist die Planung großtechnischer Windkraftanlagen nicht angedacht. Die Verwendung von Klein-Windkraftanlagen kann durch die Abschwächung des Windes im urbanen Raum vernachlässigt werden. [CREST] Seite: 18
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Zusätzlich ist die Errichtung von Windkraftanlagen mit dem Stadtratsbeschluss vom 20. Juni 2013 im gesamten Dresdner Stadtgebiet abgelehnt. Solarenergie Die Nutzung der Strahlungsenergie ist auch im städtischen Bereichen eine weit verbreitete Ressource. Die Verortung auf Gebäudedächern ermöglicht eine optimale Verwendung der anfallenden Strahlungsleistung. Im weiteren Verlauf beschränkt sich dieses Konzept in Absprache mit dem Stadtplanungsamt auf die Betrachtung von Photovoltaikanlagen. Mit dieser Vorgabe erübrigt sich die Flächenkonkurrenz zwischen Photovoltaik und Solarthermie. Entsprechend des Entwurfs 2020 des Grünordnerischen Fachbeitrags zum BP 3029, ist jedes Flachdach mit einer extensiven Begrünung zu versehen. Eine Kombination mit PV-Anlagen ist möglich. Es gelten die im Fachbeitrag festgeschriebenen Rahmenbedingungen zu Abstand zum Substrat (>0,30 m), Neigungswinkel >15°und Abstand der Elementreihen mindestens 0,60 m. [Blaurock] Die Berechnung des möglichen Ertrags auf den begrünten Flachdächern kann aus standardisierten Testbedingungen abgeschätzt werden. Der Flachdachanteil ergibt sich aus den städtebaulichen Vorgaben als Ergebnis des Werkstattverfahrens. In diesem Verfahren waren überwiegend geneigte Dächer gewünscht. Entsprechend Tabelle 5 ergibt sich ein Deckungspotenzial von 23 % des Jahresstromverbrauchs. Seite: 19
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Tabelle 5 Potenzial PV-Anlage BVH Grundlagen el. Leistungsbedarf kWel 230 Flachdachfläche1 m² 1.050 PV-Modul Modulfläche2 m² 1,7 Peak-Leistung Modul (STC)2 Wp 305 spez. Peak-Leistung kWp/m² 0,18 PV-Anlage PV-Fläche m² 680 Peak-Leistung kWp 120 Regionaler Durchschnitt3 kWh/kWp·a 1.053 Jährlicher Ertrag kWh/a 126.400 1 [Blaurock] 2 [SOLARWATT] 3 [PV-Erträge] Damit ist die Umsetzung einer PV-Anlage aus ökologischer Sicht durchaus sinnvoll. Die erhöhten technischen Anforderungen durch die Vereinzelung der Bereiche stehen in einem akzeptablen Verhältnis zum Ertrag. Im Sinne des Auftraggebers kommt eine Eigenstromerzeugung durch PV-Anlagen nicht in Frage, da er daraus keinen wirtschaftlichen Vorteil erhält. Der Mieter ist nicht verpflichtet den Strom aus der Eigenerzeugung zu beziehen. Gegebenenfalls schreckt der notwendige, zusätzliche Vertrag für die Versorgung des Restanteils von Strom ab. Auch wenn der Vermieter sich als Zwischenhändler in Kombination mit gekauften Strom für eine Gesamtdeckung anbietet, ist der Mieter frei in seiner Wahl des Stromanbieters. Damit besteht immer ein Risiko der unvollständigen Abnahme aus Eigenerzeugung. Der Verkauf des Stroms aus der PV-Anlage ist aufgrund entfallener Zuschüsse nicht mehr wirtschaftlich. In einem Pachtmodell hätte der Vermieter keinen Investitionsaufwand, jedoch ist auch in diesem Modell eine Eigenstromnutzung nicht verpflichtend. Sodass die Wirtschaftlichkeit für den Hausbesitzer nicht gesichert ist. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Nutzung einer PV-Anlage aus ökologischer Sicht durchaus sinnvoll, jedoch nicht wirtschaftlich sicher darstellbar ist. Damit wird in den weiteren Varianten die Eigenerzeugung von Strom aus PV-Anlagen vernachlässigt. Seite: 20
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Potenziale für Quartiersversorgung oder dezentrale Versorgung Unabhängig von den erneuerbaren Energien liegen im urbanen Bereichen meist bestehende Versorgungsnetze vor. Am Standort ist eine Anbindung an das Erdgasnetz und Fernwärmenetz möglich. Damit ergeben sich Möglichkeiten hinsichtlich der zentralen Versorgung des Quartiers zum Beispiel über eine KWK-Anlage oder ein Fernwärmeanschluss. Eine dezentrale Lösung kann die Versorgung über Gasbrennwertkessel für jeden Block sein. Aufgrund der relativ engen Lage der Blöcke ist jedoch eine zentrale Versorgung sinnvoll. Der Aufwand der Verteilung unterliegt den Investitions- und Ausführungsaufwand von mehreren Heizungszentralen. Seite: 21
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Auswahl der Technologien zur Energieversorgung In den vorhergehenden Kapiteln wurden verschiedene Energieformen und Technologien zur Versorgungen des Bauvorhabens betrachtet. Dabei konnten einige Möglichkeiten klar ausgeschlossen werden. Andere Formen der Versorgung sind standortbezogen sinnvoll umsetzbar und werden in den weiteren Untersuchungen genauer betrachtet. In Bezug auf die bisher angestellten Ausführungen konnten die folgenden drei Versorgungskonzepte herausstechen: A. Wärmeversorgung durch Fernwärme, Stromversorgung aus Stromnetz B. Wärmeversorgung und Stromversorgung aus KWK-Anlage mit Gas- Brennwertgerät zur Spitzenlastunterstützung, Stromversorgung aus Stromnetz Bau- und Versorgungskonzepte Konzept A: Fernwärmeanschluss + Stromnetz Das erste Konzept bedient sich der vorhandenen Infrastruktur des Fernwärmenetzes. Mit einem Primärenergiefaktor von 0,23 ist die Versorgung aus diesem Netz aus ökologischer Sicht sehr vorteilhaft und kann den Klimazielen der Stadt Dresden gerecht werden. Der Anschluss der Blöcke kann über einen zentralen Hausanschlussraum erfolgen. Der Strombedarf wird über die vorhandene Netzinfrastruktur im Stadtbereich gedeckt. Der Endenergiebedarf aus den vorherigen Kapiteln dient nun zur Berechnung des benötigten Primärenergiebedarfs. Dazu werden sogenannte Primärenergiefaktoren genutzt. Der Primärenergiebedarf berücksichtigt die gesamte Kette von Erzeugung, Transport und Verbrauch. In Variante A stellen sich die Bedarfswerte nach Tabelle 6 dar. Seite: 22
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Tabelle 6 Energiebilanzierung Variante A Energiebedarf - Variante A BVH Wärme Endenergiebedarf MWh/a 1.450 Primärenergiefaktor1 0,23 Primärenergiebedarf MWh/a 330 Strom Endenergiebedarf MWh/a 538 Primärenergiefaktor2 1,8 Primärenergiebedarf MWh/a 1.000 1 [DREWAG-FW] 2 [DINV18599:2018-09] Es existieren derzeit keine Förderungen in Dresden zur Bezuschussung dieser Technik. Aufgrund der Errichtung nach dem Mindeststandard der aktuellen EnEV, ist eine Förderung durch einen KfW-Kredit bzw. -Zuschuss für Bauen, Umbauen und sanieren nicht möglich. Die CO2-Emission kann annähernd auf Basis des errechneten Endenergiebedarfs nach Tabelle 7 ermittelt werden. Tabelle 7 CO2-Bilanzierung Variante A CO2-Emission - Variante A BVH Wärme CO2-Faktor1 g/kWh 54,6 CO2-Emission t/a 80 Strom CO2-Faktor2 g/kWh 402,9 2 CO2-Emission t/a 220 1 [DREWAG-FW] 2 [IINAS] Seite: 23
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Konzept B: BHKW + Gas-Brennwertgerät + Stromnetz Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) nutzt das vorhandene Gasnetz, um in einer Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sowohl Strom als auch Wärme zu erzeugen. In Wohnbauten bietet sich meist ein wärmegeführtes System an. Dabei wird die Laufzeit und Auslastung der Anlage über den Wärmebedarf bestimmt. Die Stromerzeugung richtet sich nach diesem Bedarf. Da ein BHKW vor allem mit einer hohen Vollbenutzungsstundenanzahl lohnenswert ist, muss im Besonderen auf die Dimensionierung der nachgeschalteten Puffermöglichkeit geachtet werden. Eine übermäßige Taktung der Anlage sollte vermieden werden. Der zusätzlich erzeugte Strom kann in Eigennutzung eine Verwendung finden oder verkauft werden. Der restliche Strombedarf wird über die vorhandene Netzinfrastruktur im Stadtbereich gedeckt. Die Energiebilanzierung definiert sich über die Primärenergiefaktoren in Tabelle 9. Der Wärmeanteil unterteilt sich in der Versorgung durch das Gas- Brennwertgerät und das BHKW mit jeweils unterschiedlichen Primärenergiefaktoren. Um einen konstanten Betrieb des BHKW mit den notwendigen Vollbenutzungsstunden im Jahr zu gewährleisten, wird das BHKW zur Deckung des Bedarfs an Trinkwarmwasser eingesetzt. Hinzu kommt die Anforderung durch das EEWärmeG zur Deckung von 50 % des Bedarfs über die KWK-Anlage. Ausgehend von einer Vollbenutzungsstundenanzahl von 7.000 h/a ergibt sich eine zu installierende Wärmeleistung von 104 kW über das BHKW. Damit wird eine Leistung von 706 kW über die Gas-Brennwertgeräte gefordert. Für den Primärenergiebedarf Strom wird von einer reinen Eigennutzung des erzeugten Stroms ausgegangen. Über die heute übliche Stromkennzahl von BHKW´s im Bereich von 0,63 - 0,65 kann der Anteil erzeugter Strom durch das BHKW bestimmt werden. Der Restbetrag wird über das Energieversorgungsunternehmen bezogen und erhält den Primärenergiefaktor nach DIN V 18599. Seite: 24
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Tabelle 8 Anteile Energiebilanzierung Variante B Anteile Energiebilanzierung BVH Wärme benötigte Leistung kW 810 Leistung BHKW kW 104 Energiemenge BHKW MWh/a 725 Leistung Gas-Brennwertgerät kW 706 Energiemenge Gas-Brennwertgerät MWh/a 725 Strom benötigte Leistung kW 230 Leistung BHKW kW 65 Energiemenge BHKW MWh/a 460 Leistung EVU1 kW 165 Energiemenge EVU1 MWh/a 80 1 EVU = Energieversorgungsunternehmen Über die ermittelte Verteilung der Energieerzeugung können nun mittels der entsprechenden Primärenergiefaktoren der Primärenergiebedarf berechnet werden. Seite: 25
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Tabelle 9 Energiebilanzierung Variante B Energiebedarf - Variante B BVH Wärme Endenergiebedarf Gas-KWK MWh/a 725 Primärenergiefaktor Gas-KWK1 0,7 Endenergiebedarf Gas-Brennwert MWh/a 725 1 Primärenergiefaktor Gas-Brennwert 1,1 Primärenergiebedarf Gas-KWK MWh/a 510 Primärenergiebedarf Gas-Brennwert MWh/a 800 Primärenergiebedarf MWh/a 1.310 Strom Endenergie KWK MWh/a 460 Primärenergiefaktor KWK1 2,8 Endenergiebedarf Rest MWh/a 80 Primärenergiefaktor1 1,8 Primärenergiebedarf KWK MWh/a 1.290 Primärenergiebedarf Rest MWh/a 140 Primärenergiebedarf MWh/a 1.400 1 [DINV18599:2018-09] Zunächst müssen KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung unter 1 MW weiterhin nur 40 % der EEG-Umlage zahlen. Dies bewirkt eine Preissenkung und damit eine gesteigerte Attraktivität zur Eigennutzung. Des Weiteren werden KWK-Anlagen von 50 kWel bis 2 MWel über das KWK-Gesetz mit 0,08 €/kWh unterstützt. Außerdem ist im Rahmen der Förderung des Projekts mit Mitteln des Bundes, Landes oder KfW-Krediten eine Aufstockung der Förderung über ein SAB-Förderungsergänzungsdarlehen möglich. Da die Gebäude nicht als Effizienzhaus mit dem Standard 55, 40 oder 40 Plus errichtet werden, sind KfW-Kredite nicht in dieser Auswahl vertreten. Die CO2-Emission wird auch in dieser Variante anhand des Primärenergiebedarfs und dem spezifische CO2-Ausstoß in Tabelle 10 berechnet. Seite: 26
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Tabelle 10 CO2-Bilanzierung Variante B CO2-Emission - Variante B BVH Wärme CO2-Faktor1 g/kWh 253 CO2-Emission t/a 330 Strom CO2-Faktor KWK 2 g/kWh 860 CO2-Emission KWK t/a 400 3 CO2-Faktor Rest g/kWh 402,9 CO2-Emission t/a 30 CO2-Emission t/a 430 1 [GEMIS] 2 [IINAS] 3 [DINV18599:2018-09] Seite: 27
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Bewertung der Bau- und Versorgungskonzepte Methodik der Bewertung Damit das vorteilhafteste System für den Bebauungsplan ermittelt werden kann, müssen die Varianten anhand verschiedener Kriterien verglichen werden. Die ausschlaggebenden Eigenschaften sind der Primär- und Endenergiebedarf, Investitionskosten inkl. Förderungsmöglichkeiten, Betriebs- und Wartungskosten und die CO2-Emission. Nach der direkten Gegenüberstellung wird eine begründete Auswahl der Vorzugslösung erfolgen. Der Primär- und Endenergiebedarf sowie die CO2-Emissionen wurden bereits in den vorhergehenden Kapiteln berechnet und der Rechenweg erläutert. Die Ergebnisse werden im Vergleich herangezogen und in einer aussagekräftigen Darstellung übermittelt. Zur Berechnung der Kosten dienen Referenzwerte aus anderen Projekten sowie Kostenschätzungen der Systeme. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Installationstechnik ab dem Hausanschlussraum identisch ist und somit nicht in den Kosten berücksichtigt werden muss. Seite: 28
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Vergleich der Konzepte In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus beiden Varianten für verschiedene Eigenschaften miteinander verglichen. Dabei erfolgt eine reine Gegenüberstellung der Ergebnisse, die gegebenenfalls mit Begründungen untermauert werden. Im nächsten Abschnitt kommt der Vergleich zur Anwendung und es wird eine Auswahl durchgeführt. Energiebilanz Im ersten Schritt erfolgt die Gegenüberstellung anhand der Energiebedarfe in Abbildung 6. Abbildung 6 Vergleich der Energiebedarfswerte Nachvollziehbar ist, dass der Endenergiebedarf Wärme für beide Varianten gleich ist. Zusätzlicher, technischer Aufwand, der sich zwischen den Varianten leicht unterscheiden kann, ist in dieser Näherung nicht berücksichtigt. Die Endenergie Strom liegt in Variante B niedriger. Dies resultiert aus der großen Menge an eigenerzeugten Strom, der auch innerhalb des Bilanzkreises der Gebäude Verwendung findet. Die Primärenergie Wärme unterscheidet sich stark aufgrund der unterschiedlichen Energieträger. Die Fernwärmeversorgung hat durch Ihren hohen Anteil an Kraft-Wärme-Kopplung einen sehr niedrigen Primärenergiefaktor. Die Variante B errechnet den Primärenergiebedarf anhand der Aufteilung zwischen BHKW und Gas-Brennwertgerät mit den Seite: 29
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße gegebenen Primärenergiefaktoren. Der Primärenergiebedarf Strom der Variante B ist gegenüber der Fernwärme größer. Wirtschaftlichkeit Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird anhand einer dynamischen Kostenberechnung über die Annuitätsmethode der VDI 2067 durchgeführt. Mithilfe dieses Verfahrens können einmalige Zahlungen und wiederkehrende Zahlungen in einem festgelegten Zeitraum zusammengefasst werden. In diesem Konzept wird eine Differenzkostenbetrachtung durchgeführt. Zahlungen, die für beide Varianten gleich sind, werden nicht berücksichtigt. Der Betrachtungszeitraum beläuft sich auf 20 Jahre. Zunächst wurden die reinen Investitionskosten als statischer Teil bestimmt. Dafür dienen Referenzprojekte von Brendel Ingenieure. Tabelle 11 Investitionskosten der Varianten Menge spez. Investitionskosten Varianten Erzeugungsart in BZE (Netto) in € Variante A Wärme BHKW 0 0 Gas-Brennwertgerät 0 0 Fernwärmestation 810 18.500 Kaminanlage 0 0 Pufferspeicher 12 18.000 MSR 1 30.000 Gesamtkosten 66.500 Variante B Wärme BHKW 104 124.800 Gas-Brennwertgerät 706 56.480 Fernwärmestation 0 0 Kaminanlage 2 56.000 Pufferspeicher 12 18.000 MSR 1 32.000 Gesamtkosten 287.280 Im nächsten Schritt werden diese Kosten zur Ermittlung der kapitalgebundenen Annuität verwendet. Dabei werden Preisänderungs- faktoren und Restwerte bei der Abschreibung mitberücksichtigt. Seite: 30
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Tabelle 12 Kapitalgebundene Annuität der Varianten (Grundlagen) Preis- Nutzungs- änderungs- Annuitäts- Ersatz- Komponenten Investition dauer Zinsfaktor faktor faktor beschaffungen Fernwärme q r a n A0 TN € a - - - St BHKW 0 15 1,03 1,03 0,067 1 Gas-Brennwertgerät 0 20 1,03 1,03 0,067 0 Fernwärmestation 18.500 20 1,03 1,03 0,067 0 Kaminanlage 0 50 1,03 1,03 0,067 0 Pufferspeicher 18.000 30 1,03 1,03 0,067 0 MSR 30.000 10 1,03 1,03 0,067 1 Gesamt 66.500 Preis- Komponenten Nutzungs- änderungs- Annuitäts- Ersatz- BHK + Gas- Investition dauer Zinsfaktor faktor faktor beschaffungen Brennwertgerät A0 TN q r a n € a - - - St BHKW 124.800 15 1,03 1,03 0,067 1 Gas-Brennwertgerät 56.480 20 1,03 1,03 0,067 0 Fernwärmestation 0 20 1,03 1,03 0,067 0 Kaminanlage 56.000 50 1,03 1,03 0,067 0 Pufferspeicher 18.000 30 1,03 1,03 0,067 0 MSR 32.000 10 1,03 1,03 0,067 1 Gesamt 287.280 Seite: 31
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Tabelle 13 Kapitalgebundene Annuität der Varianten Preis- dynamischer Annuität der Komponenten Restwert Barwertfaktor kapitalgebundenen Kosten Fernwärme b Rw AN,K € - €/a BHKW 0 19 0 Gas-Brennwertgerät 0 19 0 Fernwärmestation 0 19 1.200 Kaminanlage 0 19 0 Pufferspeicher 3.300 19 1.000 MSR 0 19 4.000 Gesamt 6.200 Preis- Komponenten dynamischer Annuität der BHK + Gas- Restwert Barwertfaktor kapitalgebundenen Kosten Brennwertgerät Rw b AN,K € - €/a BHKW 71.800 19 12.000 Gas-Brennwertgerät 0 19 3.800 Fernwärmestation 0 19 0 Kaminanlage 18.600 19 2.500 Pufferspeicher 3.300 19 1.000 MSR 0 19 4.300 Gesamt 23.600 Seite: 32
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Ein weiterer Anteil sind die bedarfsgebundenen Kosten. Darunter zählen die Kosten aus Bedarf an Energieträgern. An dieser Stelle werden gegebenenfalls Förderanteile mitberücksichtigt. Tabelle 14 Bedarfsgebundene Kosten (Grundlagen) Komponenten Energie- aufwand Arbeitspreis1 Leistung Grundpreis1 kWh/a €/kWh kW €/BZE·a Fernwärme Wärme 1.450.000 0,07 810 53 Strom 537.800 0,28 - 103 Förderung Gesamtkosten 1 [DREWAG] Komponenten Energie- aufwand Arbeitspreis3 Leistung Grundpreis3 kWh/a €/kWh kW €/BZE·a 4 BHKW Wärme 725.000 0,06 - 179 1 Strom 460.000 0,24 - - Förderung Kosten Gas-Brennwertgerät Wärme 725.000 0,06 - 179 2 Strom 80.000 0,28 - 103 Förderung Kosten Gesamtkosten 1 aus BHKW; 40 % der EEG-Umlage fällig 2 Restw ert Strom: Bedarfsmenge abzüglich der erzeugten Menge aus BHKW 3 [DREWAG] 4 BZE: Bezugseinheit Seite: 33
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Tabelle 15 Bedarfsgebundene Kosten Bedarfs- Preis- Annuität der gebundene Annuitäts- dynamischer bedarfsgebundenen Komponenten Kosten 1. Jahr faktor Barwertfaktor Kosten AV1 a bV AN,V €/a - - €/a Fernwärme Wärme 139.500 0,067 19 182.100 Strom 150.000 0,067 19 195.800 Förderung - Gesamtkosten 377.900 1 [DREWAG] Bedarfs- Preis- Annuität der gebundene Annuitäts- dynamischer bedarfsgebundenen Komponenten Kosten 1. Jahr faktor Barwertfaktor Kosten AV1 a bV AN,V €/a - - €/a BHKW Wärme 41.600 0,067 19 54.300 1 Strom 109.600 0,067 19 143.000 Förderung -7.800 Kosten 189.500 Gas-Brennwertgerät Wärme 41.600 0,067 19 54.300 Strom2 22.400 0,067 19 29.200 Förderung - Kosten 54.300 Gesamtkosten 243.800 1 aus BHKW; 40 % der EEG-Umlage fällig 2 Restw ert Strom: Bedarfsmenge abzüglich der erzeugten Menge aus BHKW 3 [DREWAG] 4 BZE: Bezugseinheit Seite: 34
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße In den betriebsgebundenen Kosten werden entstandene Kosten während des Lebenszyklus im betrachteten Zeitraum angegeben. Diese beinhalten Instandsetzungskosten sowie Kosten für die Inspektion und Wartung. An dieser Stelle wurde mit Erfahrungswerten von Brendel Ingenieure gearbeitet. Tabelle 16 Betriebsgebundene Kosten der Varianten (Grundlagen) Aufwand Aufwand Preis- Preis- der Instand- Wartung/ änderungs- Annuitäts- dynamischer Komponenten Investition setzung Inspektion Zinsfaktor faktor1 faktor Barwertfaktor1 Fernwärme A0 fInst fW+Insp q rB / rIN a bB / bIN € - - - - - - BHKW 0 0,06 0,02 1,03 1,01 0,067 16 Gas-Brennwertgerät 0 0,01 0,02 1,03 1,01 0,067 16 Fernwärmestation 18.500 0,02 0,01 1,03 1,01 0,067 16 Kaminanlage 0 0,01 0,02 1,03 1,01 0,067 16 Pufferspeicher 18.000 0,00 0,01 1,03 1,01 0,067 16 MSR 30.000 0,10 0,02 1,03 1,01 0,067 16 Gesamt 66.500 1 Annahme: Preisänderungsfaktor sow ie preisdynamischer Barw ertfaktor für betriebsgebundene Kosten und Instandhaltung gleich 2 [BI] Aufwand Aufwand Preis- Preis- Komponenten der Instand- Wartung/ änderungs- Annuitäts- dynamischer BHKW + Gas- Investition setzung Inspektion Zinsfaktor faktor1 faktor Barwertfaktor1 Brennwertgerät A0 fInst fW+Insp q rB / rIN a bB / bIN € - - - - - - BHKW 124.800 0,06 0,02 1,03 1,01 0,067 16 Gas-Brennwertgerät 56.480 0,01 0,02 1,03 1,01 0,067 16 Fernwärmestation 0 0,02 0,01 1,03 1,01 0,067 16 Kaminanlage 56.000 0,01 0,02 1,03 1,01 0,067 16 Pufferspeicher 18.000 0,00 0,01 1,03 1,01 0,067 16 MSR 32.000 0,10 0,02 1,03 1,01 0,067 16 Gesamt 287.280 1 Annahme: Preisänderungsfaktor sow ie preisdynamischer Barw ertfaktor für betriebsgebundene Kosten und Instandhaltung gleich 2 [BI] Seite: 35
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Tabelle 17 Betriebsgebundene Kosten der Varianten betriebs- Kosten 1.Jahr gebundene Annuität der Komponenten Instandhaltung Kosten 1.Jahr2 betriebsgebundenen Kosten Fernwärme AIN AB1 AN,B € - € BHKW 0 4.000 4.400 Gas-Brennwertgerät 0 5.000 5.500 Fernwärmestation 555 2.500 3.300 Kaminanlage 0 250 270 Pufferspeicher 180 100 310 MSR 3.600 1.200 5.200 Gesamt 19.000 1 Annahme: Preisänderungsfaktor sow ie preisdynamischer Barw ertfaktor für betriebsgebundene Kosten und Instandhaltung gleich 2 [BI] betriebs- Komponenten Kosten 1.Jahr gebundene Annuität der BHKW + Gas- Instandhaltung Kosten 1.Jahr2 betriebsgebundenen Kosten Brennwertgerät AIN AB1 AN,B € - € BHKW 9.984 4.000 15.200 Gas-Brennwertgerät 1.694 5.000 7.300 Fernwärmestation 0 2.500 2.700 Kaminanlage 1.680 250 2.100 Pufferspeicher 180 100 310 MSR 3.840 1.200 5.500 Gesamt 33.100 1 Annahme: Preisänderungsfaktor sow ie preisdynamischer Barw ertfaktor für betriebsgebundene Kosten und Instandhaltung gleich 2 [BI] Seite: 36
B-Plan 3029 (Vertragsgebiet zwischen Hansastraße und DB-Gleisanlagen) Nr. 43 Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße Die Annuität der Jahresgesamtzahlungen über einen Zeitraum von 20 Jahren ergibt sich dann in Tabelle 18. Tabelle 18 Annuität der Jahresgesamtzahlungen der Varianten BHKW + Gas- Einheit Fernwärme Brennwertgerät Annuität der €/a 6.200 23.600 kapitalgebundenen Kosten Annuität der €/a 377.900 243.800 bedarfsgebundenen Kosten Annuität der €/a 19.000 33.100 betriebsgebundenen Kosten Annuität der sonstigen Kosten €/a 0 0 Annuität der Jahresgesamt- €/a 403.100 300.500 zahlungen Seite: 37
Sie können auch lesen