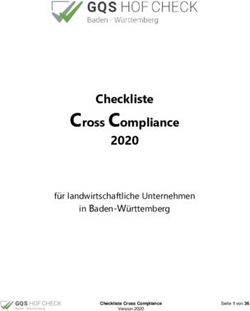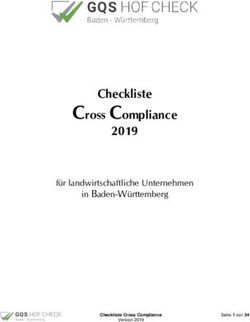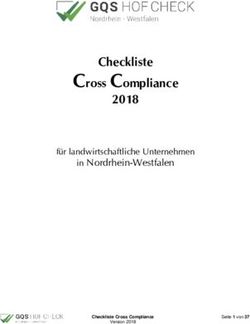Ergänzungssatzung "Am Weinberg Südwest" - FFH - Erheblichkeitsabschätzung Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung - sachsen.de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung
Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung
Auftraggeber: Stadtverwaltung Dahlen
Markt 4
04774 Dahlen
Auftragnehmer: IB Hauffe GbR
Büro für Landschaftsplanung
Am Eichberg 4
04769 Mügeln / Neubaderitz
Tel.: 034362 / 33572
Fax: 034362 / 379986
e-Mail: info@ib-hauffe.de
web: www.ib-hauffe.de
Datum: 23.04.2021Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
Inhaltsverzeichnis
1. Allgemeine Angaben ....................................................................................................... 3
2. Projektbeschreibung und Aufgabenstellung .................................................................... 4
3. Bestandsaufnahme ......................................................................................................... 5
4. FFH - Erheblichkeitsabschätzung ................................................................................... 7
4.1 Beschreibung und Bedeutung des betroffenen Schutzgebietes ............................... 7
4.1.1 Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse .................................................. 8
4.1.2 Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse ......................................................... 9
4.1.3 Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse ................................................................. 9
4.2. Erhaltungsziele und Schutzzweck des Gebietes ...................................................... 9
4.3. Auswirkung des Projektes auf Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem
Interesse.................................................................................................................11
4.3.1 Beschreibung wesentlicher projektbezogener Wirkfaktoren........................................ 11
4.3.2 Auswirkungen auf Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse................... 12
4.3.3 Auswirkungen auf Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse unter
Hervorhebung prioritärer Arten .................................................................................... 12
4.3.4 Auswirkungen auf Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse unter Hervorhebung
prioritärer Arten ............................................................................................................ 12
4.4. Einschätzung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung
möglicher Synergieeffekte ......................................................................................16
5. Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und -kompensation..............................................17
6. Eingriffsbeschreibung und –bewertung mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung.................26
7. Zusammenfassung / Ergebnisse ....................................................................................29
Anhang: # Anlage 1 - Literaturverzeichnis
# Anlage 2 - Fotodokumentation
# Anlage 3 - Plan 1: Flächennutzungs- und Biotoptypen sowie Ge-
hölzbestand
2Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
1. Allgemeine Angaben
Auftraggeber: Stadtverwaltung Dahlen
Markt 4
04774 Dahlen
Auftragnehmer: IB Hauffe GbR
Büro für Landschaftsplanung
Am Eichberg 4
OT Neubaderitz
04769 Mügeln
Bearbeitung: Dipl.-Ing. agr. Heiko Hauffe
Dipl.-Ing. (Landschaftsarchitektur) Susann Köhler
Standort des Untersuchungsgebietes:
Land: Sachsen
Landkreis: Nordsachsen
Stadt: Dahlen
Gemarkung: Dahlen
Flurstücke: 3084; 3085 Teile von: 3086, 3039/1, 1208
Plangebietsgröße: 3.392 m²
Abb. 1: Die Lage des Plangebietes (ohne Maßstab).
3Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
2. Projektbeschreibung und Aufgabenstellung
Mit der Aufstellung der Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“ gemäß § 34 Abs. 4 Satz
1 Nr. 3 BauGB sollen einzelne Außenbereichsflächen städtebaulich angemessen in den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden. Die Voraussetzung dafür, dass die
einzubeziehenden Außenbereichsflächen an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil an-
grenzen ist hier gegeben. Die einzubeziehenden Flächen sind durch die bauliche Nutzung des
angrenzenden Bereichs geprägt. So handelt es sich dabei um Flächen oder Grundstücke, die
auf der gegenüberliegenden Seite einer einseitig bebauten Straße liegen.
Anlass für diese Satzung ist die Absicht der Stadt Dahlen in erschlossener und städtebaulich
geeigneter Lage im Anschluss an den Siedlungskörper eine wohnbauliche Flächenergänzung
vorzunehmen. Dieses Vorhaben fügt sich bezüglich der Art der baulichen Nutzung in die eben-
falls wohnbaulich geprägte Umgebung ein. Mit der städtebaulichen Satzung sollen Flächen-
angebote für Wohnbauzwecke im Sinne der maßvollen Ergänzung geschaffen werden.
Ziel ist die Ansiedlung baulandnachfragender, jungen Familien mit Kindern. Aus diesem Grund
hat die Gemeinde den Aufstellungsbeschluss zu diesem städtebaulichen Satzungsverfahren
gefasst. [PLA.NET: Begründung zur Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“, Stand 17.02.2021.]
In einer kürzesten Distanz von 10 m in südwestlicher Richtung zum Plangebiet befindet sich
das FFH - Gebiet „Dahle und Tauschke“.
In der vorliegenden Arbeit ist zu prüfen, ob ausgeschlossen werden kann, dass die Realisie-
rung der Vorgaben der Ergänzungssatzung den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes entge-
gensteht. Nur wenn dies offensichtlich der Fall ist, entfällt die Notwendigkeit tiefergehender
Untersuchungen (FFH - Verträglichkeitsprüfung).
Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung liegt im Außenbereich nach § 35 BauGB.
Aufgrund der Lage im Außenbereich sind die §§ 14 bis 17 BNatSchG anzuwenden (§ 18
BNatSchG).
Gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft
… Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit
der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können.
Mit der Realisierung der Vorgaben der Ergänzungssatzung werden die vorbenannten Krite-
rien für einen Eingriff erfüllt.
Gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG gilt:
Vom Verursacher eines Eingriffs sind zur Vorbereitung der Entscheidungen und Maßnahmen
zur Durchführung des § 15 in einem nach Art und Umfang des Eingriffs angemessenen Um-
fang die für die Beurteilung des Eingriffs erforderlichen Angaben zu machen, insbesondere
über
1. Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie
2. die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Er-
satz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft einschließlich Angaben
zur tatsächlichen und rechtlichen Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz
benötigten Flächen. Die zuständige Behörde kann die Vorlage von Gutachten
verlangen, soweit dies zur Beurteilung der Auswirkungen des Eingriffs und der
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich ist.
Aus dem Vorbenannten leiten sich folgende Aufgaben der vorliegenden Arbeit ab:
• die Erstellung einer Bestandsaufnahme, als Grundlage
• einer FFH-Erheblichkeitsabschätzung,
• für die Entwicklung von Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung, -minimierung
und -kompensation und
• einer Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung.
4Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
3. Bestandsaufnahme
Am 02. und 04.12.2020 erfolgte im Plangebiet eine Erfassung der Flächennutzungs- und
Biotoptypen. Folgende Flächennutzungs- und Biotoptypen wurden kartiert:
• vollversiegelte Flächen / Gebäude
Im Gebiet befinden sich mehrere kleine Gartenlauben.
• vollversiegelte Flächen
Dieser Flächennutzungstyp umfasst eine vollversiegelt befestigte Terrasse an einer Gartenlaube sowie die
Straße „Am Weinberg“.
• teilversiegelte Flächen
Unter diesem Biotoptyp wird eine kleine Pflasterfläche (Weg) sowie eine Holzterrasse zusammengefasst.
• Folieteich
In dem Garten auf dem Flurstück 3085 befindet sich ein Folieteich.
• nitrophile Gras- und Krautflur; Straßenrand
Beidseitig der Straße „Am Weinberg“ hat sich im Straßenrandbereich eine nitrophile Gras- und Krautflur etab-
liert.
• Gartenland
Den größten Flächenanteil im Plangebiet nimmt Gartenland ein. Dieses ist gekennzeichnet von Rasenflä-
chen, kleinen, meist unbefestigten, Wegen, Blumenbeeten, Ziergehölzen, Koniferen, Obstgehölzen. Grabe-
land ist nicht zu finden. Auf dem Flurstück 3084 wurde erst in der jüngeren Vergangenheit Grabeland aufge-
lassen – auf einem Luftbild aus dem Jahr 2018 sind noch Beete erkennbar. [https://rz.ipm-gis.de/rapis2/client/?app=um-
welt]
• Gebüsche, (Schnitt-)Hecken mit hohem Koniferenanteil
Im Plangebiet befinden sich mehrere dichte Baum- und Strauchbestände, welche in der Tabelle 1 näher
beschrieben werden. Schnitthecken wurden diesem Biotoptyp ebenfalls mit zugerechnet.
• Einzelbäume
In den Gärten kommen zahlreiche Einzelbäume vor, welche im Detail in der Tabelle 1 beschrieben werden.
Bemerkenswert sind die alten Linden entlang der Straße „Am Weinberg“, welche als höhlenreiche Einzel-
bäume nach § 21 SächsNatSchG geschützt sind.
Die Gehölze können in Detail wie folgt beschrieben werden:
Tabelle 1: Gehölzbestandsliste
lfd. Art Stamm-Ø Höhe in m Kronen-Ø Bemerkung
Nr. in 1,30 m in m
Höhe
in cm
1 Linde-Art (Tilia spec.) Spalte, Astausfaulungen und Baumhöh-
80 >25 14
len
2 Linde-Art (Tilia spec.) 40 23 9 Astausfaulungen, gekappter Zwiesel
3 Linde-Art (Tilia spec.) Baumhöhlen, abblätternde Rinde, bei
100 >25 14 Baum erfolgte starker Rückschnitt (Stark-
äste gekappt)
4 Kultur-Apfel (Malus domes- Nistkasten
25 7 5
tica)
5 Gewöhnlicher Flieder (Syringa Hecke, Gebüsch, Strauchgruppe
vulgaris), Forsythie (Forsythia - bis 6 -
x intermedia)
6 Stechfichte (Picea pungens) 15 (?) 8 5 Stamm schwer einsehbar
7 Lebensbaum-Art (Thuja Gebüsch
spec.), Tanne-Art (Abies
spec.), Rhododendron (Rho-
- 9 -
dodendron Catawbiense Hyb-
ride), Wacholder-Art (Junipe-
rus spec.)
5Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
lfd. Art Stamm-Ø Höhe in m Kronen-Ø Bemerkung
Nr. in 1,30 m in m
Höhe
in cm
8 Serbische Fichte (Picea
12 9 2
omorika)
9 Gewöhnliche Fichte (Picea
20 10 4
abies)
10 Linde-Art (Tilia spec.) 10; 10; 10; sehr enger Stand, Kronen dicht beieinan-
5 3
8 der
11 Linde-Art (Tilia spec.) 12 7 3
12 Linde-Art (Tilia spec.) 10 6 3
13 Lebensbaum-Art (Thuja spec.) 10; 20; 20; mehrstämmig
11 7
20; 25; 20
14 Hainbuche (Carpinus betulus) 25; 25 10 7 Zwiesel, Stammschaden
15 Objektnummer nicht vergeben
16 Objektnummer nicht vergeben
17 Gewöhnliche Esche (Fraxinus
15 13 6
excelsior)
18 Stieleiche (Quercus robur) 15 13 7
19 Linde-Art (Tilia spec.) 15 13 6
20 Linde-Art (Tilia spec.) 20 14 7
21-29 Objektnummern nicht vergeben
30 Kultur-Apfel (Malus domes-
25 5 5
tica)
31 Kultur-Apfel (Malus domes- Nistkasten
25 5 5
tica)
32 Kultur-Apfel (Malus domes-
25 4 5
tica)
33 Süßkirsche (Prunus avium ) 10 4 2,5
34 Gewöhnlicher Liguster (Ligust- Hecke, Schnitt
- 1,5 -
rum vulgare)
35 Kultur-Apfel (Malus domes- Zwiesel
15; 20 9 9
tica)
36 Kultur-Apfel (Malus domes-
20 4 2,5
tica)
37 Kriechender Wacholder (Ju- Gebüsch
niperus sabina); Lebensbaum-
Art (Thuja spec.), Schwarzer - 2 (4) -
Holunder (Sambucus nigra),
Pfirsich (Prunus persica)
38-40 Objektnummern nicht vergeben
41 Hainbuche (Carpinus betulus) 10 10 5
42 Linde-Art (Tilia spec.) strauchig wachsend, mehrstämmig,
bis 12 Bis 7 7
Stammschäden, gekappte Krone
43-45 Objektnummern nicht vergeben
46 Hainbuche (Carpinus betulus); Schnitthecke
Spierstrauch (Spiraea spec.),
- 1,8 -
Sommerflieder (Buddleja da-
vidii)
Legende
Name Baum weist Quartiereigenschaften für baumbewohnende Fledermausarten auf
dichte Gehölzbestände; Hecken; Gebüsche
Baum, welcher die Kriterien für ein geschütztes Biotop nach § 21 SächsNatSchG erfüllt
Die Lage der Flächennutzungs- und Biotoptypen sowie der Gehölze geht aus dem Plan 1 her-
vor, welcher sich in der Anlage 3 der vorliegenden Arbeit befindet.
6Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
4. FFH - Erheblichkeitsabschätzung
4.1 Beschreibung und Bedeutung des betroffenen Schutzgebietes
Das FFH - Gebiet „Dahle und Tauschke“ umfasst ein strukturreiches Bachsystem im unteren
Hügelland. Charakteristisch sind seine Siedlungs- und Verkehrsarmut, naturnahe Bachab-
schnitte mit begleitenden Uferstaudenfluren und Erlen-Eschen-Wäldern, Teiche mit Verlan-
dungsvegetation sowie kleinflächig Pfeifengraswiesen.
Die Schutzwürdigkeit begründet sich mit dem Vorkommen typisch ausgeprägter Fließgewäs-
ser mit begleitenden Auwaldgesellschaften, kleinflächig Nieder- und Zwischenmoor, Borst-
grasrasen, Pfeifengraswiesen sowie Eichen-Hainbuchenwald [Standarddatenbogen; LfUG; 2012].
Insgesamt hat das FFH Gebiet eine Flächengröße von 788 ha und verteilt sich anteilmäßig auf
folgende Biotopkomplexe (Habitatklassen):
- Binnengewässer (stehend und fließend) 2%
- Grünland mittlerer Standorte 44 %
- Feuchtgrünland auf mineralischen Böden 2%
- Ackerland 10 %
- Gebüsche / Vorwald 4%
- Laubwald 15 %
- Mischwald 4%
- Kunstforsten Laubholz (z.B. Pappelbestände oder exotische Gehölze) 1%
- Kunstforste Nadelholz 16 %
- anthropogen stark überformte Biotopkomplexe 2%
[Standarddatenbogen; LfUG; 2012].
Geltungsbereich der Ergänzungs-
satzung „Am Weinberg Südwest“
Grenzen des
FFH-Gebietes
Abb. 2: Grenzen des FFH - Gebietes im Umfeld der geplanten Ergänzungssatzung (ohne
Maßstab)
7Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
4.1.1 Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse
Im FFH - Gebiet sind folgende Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse gemäß
Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG anzutreffen:
- Eutrophes Stillgewässer (Lebensraumtyp 3150)
- Fließgewässer mit Unterwasservegetation (Lebensraumtyp 3260)
- artenreiche Borstgrasrasen (prioritärer Lebensraumtyp 6230*)
- Pfeifengraswiesen (Lebensraumtyp 6410)
- Feuchte Hochstaudenfluren (Lebensraumtyp 6430)
- Flachland-Mähwiesen (Lebensraumtyp 6510)
- Übergangs- und Schwingrasenmoore (Lebensraumtyp 7140)
- Hainsimsen-Buchenwälder (Lebensraumtyp 9110)
- Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder (Lebensraumtyp 9160)
- Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder (prioritärer Lebensraumtyp 91E0*)
Eine Definition und Erläuterung zu den einzelnen Lebensraumtypen ist im Internet unter:
www.bfn.de zu finden.
Im Plangebiet befinden sich keine Lebensraumtypen (LRT).
Nächstgelegene LRT sind in der Dahleaue südlich der Straße „Am Weinberg“ zu finden. Hier
grenzt eine Flachland-Mähwiese (Lebensraumtyp 6510, ID 10037, ID 10038 und ID 10039)
bis nahe an die Straße heran und in einer Entfernung von ca. 90 m im Süden befindet sich
eine feuchte Hochstaudenflur (LRT 6430, ID 10064).
In einer Entfernung von ca. 430 m im Westen befindet sich ein Erlen-Eschen- und Weichholz-
wald (Lebensraumtyp 91E0*, ID10041).
Lage des Plangebietes
Abb. 3: Lage der ausgewiesenen Lebensraumtypen im Bereich der geplanten Ergänzungs-
satzung (ohne Maßstab) [verändert nach: MAP: Karte 2.1 Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen, Stand
08.03.2005.]
8Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
4.1.2 Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse
Im FFH - Gebiet „Dahle und Tauschke“ kommen keine Pflanzenarten von gemeinschaftlichem
Interesse vor.
4.1.3 Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse
Im FFH - Gebiet „Dahle und Tauschke“ sind folgende Tierarten von gemeinschaftlichem Inte-
resse anzutreffen:
Säugetiere (gemäß Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG)
- Lutra lutra (Fischotter) / NATURA 2000-Code: 1355
- Castor fiber (Biber) / NATURA 2000-Code: 1337
Wirbellose (gemäß Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG)
- Osmoderma eremita (Eremit) / NATURA 2000-Code: 1084
Wirbellose (gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG)
- Lucanus cervus (Hirschkäfer) / NATURA 2000-Code: 1083
Erläuterung zur Bedeutung der Anhänge:
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie): Tier- und Pflanzenarten von ge-
meinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewie-
sen werden müssen.
Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie): Streng zu schützende Tier- und
Pflanzenarten von gemeinschaftlichen Interesse.
Die Fledermausfauna wurde bei den Erfassungen zum MAP nicht untersucht (vgl. MAP, S.
67), so dass keine Hinweise auf ein Vorkommen dieser Artgruppe vorliegen. Es muss jedoch
mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass auch Fledermäuse innerhalb des FFH-
Gebietes vorkommen.
4.2. Erhaltungsziele und Schutzzweck des Gebietes
Im Anhang der Verordnung der Landesdirektion Leipzig zur Bestimmung des Gebietes von
gemeinschaftlicher Bedeutung „Dahle und Tauschke“ vom 19. Januar 2011 werden folgende
Erhaltungsziele formuliert:
9Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
10Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
4.3. Auswirkung des Projektes auf Lebensräume und Arten von gemeinschaftli-
chem Interesse
4.3.1 Beschreibung wesentlicher projektbezogener Wirkfaktoren
Mit der Realisierung des geplanten Bauvorhabens sind folgende projektbezogenen Wirkfakto-
ren zu erwarten:
Tabelle 2: Wirkfaktoren
Wirkungs-
Wirkfaktor Auswirkungen
dauer
baubedingt
- Störung/Zerstörung der im gebaggerten
- Lärmemissionen, Abgase, Licht, Erschüt-
Boden lebenden Arten- und Lebensge-
terungen
meinschaften,
- Inanspruchnahme von Boden, Bodenver-
- Verlust potentieller und möglicherweise
dichtung (Erdarbeiten; Zwischenlage-
kurz- bis vorhandener Brutbäume des Eremit
rung)
langfristig - Scheuchwirkung / Beunruhigung von
- Baufeldfreimachung einschließlich evtl.
Teillebensräumen während der Bau-
notwendiger Gehölzfällungen sowie Be-
phase durch den Baustellenbetrieb,
seitigung von abgelagerten Material so-
- Tötung nicht fluchtfähiger Tiere durch
wie Abbruch von Gebäuden
Baustellenbetrieb / Bauarbeiten
anlagebedingt
Durchführung von Sanierungs-, Umbau-,
Abbrucharbeiten an Gebäuden - Verlust potentieller und möglicherweise
Baufeldfreimachung einschließlich evtl. vorhandener Brutbäume des Eremit
notwendiger Gehölzfällungen sowie Be- (insbesondere Bäume Nr. 1 und 3)
seitigung von abgelagerten Material - Verlust potentiell geeigneter Quartiere
Verlust von Pflanzenstandorten und Tier- für baumbewohnende Fledermausarten,
langfristig
lebensräumen (Gartenland, nitrophile wenn die Bäume Nr. 1 und 3 gefällt wer-
Gras- und Krautfluren sowie Gehölzen) den müssen
auf den zusätzlich neu befestigten Flä- - Verlust potentieller und möglicherweise
chen (964 m²). vorhandener Quartiere gebäudebewoh-
ggf. Rodung von höhlenreichen Einzel- nender Fledermausarten
bäumen
11Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
4.3.2 Auswirkungen auf Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse
Einschätzung:
Bei der Realisierung des Bauvorhabens sind keine Auswirkungen auf Lebensraumtypen von
gemeinschaftlichem Interesse zu erwarten.
Begründung:
Bei Realisierung der Vorgaben der Ergänzungssatzung werden keine Lebensraumtypen
von gemeinschaftlichem Interesse beansprucht oder tangiert. Entsprechende Lebens-
raumtypen kommen auf den durch die Ergänzungssatzung beanspruchten Flächen nicht
vor.
4.3.3 Auswirkungen auf Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse unter Hervorhe-
bung prioritärer Arten
Einschätzung:
Auswirkungen auf Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse sind nicht zu erwarten.
Begründung:
Entsprechende Pflanzenarten kommen im Gebiet nicht vor.
4.3.4 Auswirkungen auf Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse unter Hervorhebung
prioritärer Arten
Vorbemerkung:
Aufgrund der relativ kurzen Ortsbegehungen im Dezember 2020 war es nicht möglich, eine
komplette Bestandsaufnahme der Fauna durchzuführen.
Da in den Erhaltungszielen formuliert wurde:
„Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vor-
kommenden Populationen der Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse
……..sowie ihrer Habitate ….“
erfolgt nachfolgend eine „worst - case“ - Betrachtung, bei der die Auswirkungen auf Tiere von
gemeinschaftlichem Interesse schwerpunktmäßig anhand ihrer Habitatansprüche zu beurtei-
len sind. So ist es irrelevant, ob die Tierart tatsächlich vorkommt oder nicht - vielmehr sind die
momentane Lebensraumeignung und die Entwicklungspotentiale am Standort ausschlagge-
bend.
Säugetiere
Im Gebiet vorkommende Säugetiere von gemeinschaftlichen Interesse (gemäß Anhang II und
IV der Richtlinie 92/43/EWG) sind:
- Lutra lutra (Fischotter) / NATURA 2000-Code: 1355
- Castor fiber (Biber) / NATURA 2000-Code: 1337
In der folgenden Tabelle sind Lebensraum und Lebensweise der im Gebiet vorkommenden
Säugetiere von gemeinschaftlichem Interesse dargestellt:
12Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
Tabelle 3: Lebensraum und Lebensweise der im FFH-Gebiet vorkommenden Säugetiere
Name Lebensraum / Lebensweise
Lutra lutra (Fischotter) charakteristische Art wenig anthropogen zerschnittener und gering belasteter Land-Was-
ser-Lebensräume; nutzt natürliche Höhlungen als Baue, z.B. unterspülte Wurzelbereiche,
aber auch verlassene Höhlen anderer Tiere; im Winter ist der Zugang zu offenen Gewäs-
sern überlebenswichtig, da der Fischotter kein Winterschlaf hält
Castor fiber (Biber) Der Biber lebt semiaquatisch. Er besiedelt kleine und mittlere Flüsse, Seen, Altwässer und
Sümpfe in den Flussauen. Die Qualität des Lebensraums wird vor allem durch die Struktur
der Ufer und durch das Nahrungsangebot bestimmt. Bevorzugt werden Gewässer mit na-
turnahen, zur Anlagen von Bauen oder Burgen geeigneten Ufern und einem umfangreichen
Angebot an Weichhölzern.
Die Fledermausfauna wurde bei den Erfassungen zum MAP nicht untersucht (vgl. MAP, S.
67), so dass keine Hinweise auf ein Vorkommen dieser Artgruppe vorliegen. Potentiell muss
jedoch davon ausgegangen werden, dass auch Fledermäuse als Tierarten des gemeinschaft-
lichen Interesses innerhalb des FFH-Gebietes vorkommen.
Einschätzung:
Bei der Realisierung des Bauvorhabens sind für Fischotter und Biber keine Auswirkungen zu
erwarten. Für die im Gebiet potentiell vorkommenden Fledermausarten sind keine bis geringe
Auswirkungen zu erwarten- unter der Bedingung, dass spezielle Vermeidungsmaßnahmen
berücksichtigt werden.
Begründung:
Vorkommen des Bibers und des Fischotters sind innerhalb des Plangebietes nicht zu er-
warten- das Plangebiet liegt nicht im Auensystem der Dahle und grenzt auch nicht unmit-
telbar an dieses an. Auch wird das Plangebiet durch die Straße „Am Weinberg“ vom FFH-
Gebiet getrennt, das Plangebiet liegt im Siedlungsrandbereich von Dahlen und ist einge-
zäunt. Somit kann ausgeschlossen werden, dass Fischotter und Biber das Plangebiet
durchwandern.
Fließgewässer, die als Lebensraum des Bibers und Fischotters dienen, kommen im Plan-
gebiet nicht vor und grenzen auch nicht unmittelbar an dieses an.
Auswirkungen auf die Dahle und ihr Auensystem können aufgrund der Lage des Plange-
bietes innerhalb des Siedlungsrandbereiches von Dahlen und der räumlichen Distanz zwi-
schen Plangebiet und Dahle ausgeschlossen werden.
Potentielle Quartiere der Fledermäuse können die im Plangebiet vorhandenen Gebäude
sein. Weiterhin bieten die alten Linden Nr. 1 und 3 mit Baumhöhlen den baumbewohnen-
den Fledermausarten (potentiell) geeignete Quartiere. Unter der Voraussetzung, dass bei
einem geplanten Abbruch von Gebäuden diese vorher auf gebäudebewohnende Fleder-
mäuse untersucht werden (V 1, vgl. Kap. 5), sind keine Auswirkungen auf die Artengruppe
der gebäudebewohnenden Fledermausarten zu prognostizieren. In V 2 wurde weiterhin
zum Schutz der baumbewohnenden Fledermausarten festgelegt, dass die alten Linden
Nr. 1 und 3 zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen sind.
Mögliche Auswirkungen auf Fledermausjagdgebiete sind denkbar (Beanspruchung von
2.260 m² Gartenland als potentielles Fledermausjagdhabitat), werden jedoch als unerheb-
lich eingeschätzt, da sich das Plangebiet innerhalb des Siedlungsrandbereiches befindet
–so wird das Plangebiet von bebauten Flächen oder von Gärten begrenzt- eine durchge-
hende Grünverbindung wird nicht verbaut. Auch können die neu entstehenden Hausgär-
tenwieder als Jagdhabitat für Fledermäuse genutzt werden.
13Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
Wirbellose
Im Gebiet kommen zwei wirbellose Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß An-
hang II und IV (nur Eremit) der Richtlinie 92/43/EWG vor:
- Osmoderma eremita (Eremit) / NATURA 2000-Code: 1084
- Lucanus cervus (Hirschkäfer) / NATURA 2000-Code: 1083
In der folgenden Tabelle sind Lebensraum und Lebensweise der im Gebiet vorkommenden
Wirbellosen von gemeinschaftlichem Interesse dargestellt:
Tabelle 4: Lebensraum und Lebensweise der im FFH-Gebiet vorkommenden Wirbellosen.
Name Lebensraum / Lebensweise
Osmoderma eremita (Eremit) Alle geeigneten Höhlen in Laubbäumen werden angenommen, dabei ist die Menge des
verfügbaren Mulms wichtiger als die Art des Brutbaums. Auch eingeführte Baumarten
werden als Brutbäume gemeldet. Bevorzugt werden Höhlen mit über 50 Litern Mulm, die
eine genügend hohe Feuchtigkeit aufweisen müssen, aber nicht zu nass (schmierige
Konsistenz) sein dürfen. Selbstverständlich sind Höhlen bildende Laubholzarten wie z.B.
die Eiche oder im Süden die Platane auch besonders häufig Brutbäume. Die Tiere wäh-
len gern Höhlen in größerer Höhe, als Richtgröße werden 6 bis 12 Meter angegeben.
Bricht ein Baum zusammen und gelangt die Bruthöhle so in Bodennähe, wird Osmo-
derma schnell durch andere Tierarten (Elateriden, Regenwürmer, Nashornkäfer) ver-
drängt. Die besiedelten Bäume müssen eine gewisse Dicke und ein gewisses Alter errei-
chen. Als Baumalter wird 150 bis 200 Jahre angegeben, als Stammdurchmesser ab 50
Zentimeter. Diese Angaben sind sicher durch das vorhandene Baummaterial beeinflusst.
Die primären Lebensräume des Käfers sind Auwaldreste (Hart- und Weichholzaue) sowie
Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder. Als Sekundärbiotope gelten Friedhöfe, Parks, Al-
leen, Obstgärten usw.
Lucanus cervus (Hirschkäfer) Besiedelt werden naturnahe, lichte und wärmebegünstigte Laubwaldbestände mit einem
hohen Anteil an alten und absterbenden Bäumen, vor allem Eichenwälder, Eichen-Hain-
buchenwälder und Kiefern-Traubeneichenwälder, teilweise auch Parkanlagen und Obst-
wiesen. Bevorzugte Entwicklungsbäume sind Eichen, aber auch andere Baumarten bis
hin zu Obstgehölzen werden genutzt. Die Alttiere ernähren sich vorzugsweise vom
Baumsaft »blutender« Eichen.
Als Brutstätte werden stark abgängige Bäume, Stubben, am bzw. im Boden liegende
Starkhölzer oder dergleichen genutzt.
Einschätzung:
Die Realisierung der Vorgaben der Ergänzungssatzung wird für den Hirschkäfer keine Aus-
wirkungen haben. Für den Eremit gilt dies unter der Bedingung, dass die alten Linden Nr. 1
und 3 bei Realisierung der Vorgaben der Ergänzungssatzung erhalten bleiben und vor Beein-
trächtigungen geschützt werden (V 2).
Begründung:
- Der Hirschkäfer findet innerhalb des Plangebietes keinen geeigneten Lebensraum vor,
eine Beeinträchtigung desselben kann ausgeschlossen werden. Auch wurden innerhalb
des gesamten FFH-Gebietes keine Nachweise der Art bei den Erfassungen zum MAP
erbracht und es wurden keine Habitatflächen für die Art ausgewiesen.
14Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
- Als Habitat des Eremit ist eine etwa 1.000 m lange Allee aus alten bis sehr alten Eichen
nördlich der Gräfenhainer Mühle (nördlich Dahlen) bekannt [MAP, S. 65].
Lage des Plangebietes
Abb. 4: Lage der ausgewiesenen Habiatfläche des Eremit nördlich des Plangebietes
(ohne Maßstab) [verändert nach: MAP: Karte 2.2 Vorkommen von FFH-Arten, Stand Mai 2005.]
- Die kürzeste Distanz zwischen Plangebiet und Habitatfläche beträgt ca. 870 m. zum
Schutz des Eremit wurde in V 2 festgelegt, dass die potentiell als Brutbaum geeigneten
Bäume Nr. 1 und 3 zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen sind. Bei Erhalt
der potentiell geeigneten Brutbäume sind Auswirkungen auf den Eremit ausgeschlossen.
15Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
4.4. Einschätzung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen unter Berücksichti-
gung möglicher Synergieeffekte
„Erheblich ist eine Beeinträchtigung, wenn die Veränderung und Störung in ihrem Ausmaß
oder in ihrer Dauer dazu führen, dass ein Gebiet seine Funktionen in bezug auf die Erhaltungs-
ziele der FFH- oder der Vogelschutz-Richtlinie oder die für den Schutzzweck maßgeblichen
Bestandteile nur noch in eingeschränkten Umfang erfüllen kann“ [MU 2001].
vorhabensbedingte Flächenbeanspruchung oder sonstige Zerstörung
bzw. indirekte Beeinträchtigung
Erhaltungsziel: Erhaltungsziel: Erhaltungsziel:
Erhalt Entwicklung „ohne Ziel“
Erhalt für günstigen Entwicklung für
Erhaltungszustand günstigen Erhal-
erforderlich tungszustand erfor-
bzw. derlich
Erhalt in der bzw.
beeinträchtigten Entwicklung in der
Form für beeinträchtigten
günstigen Erhal- Form für
tungszustand nicht günstigen Erhal-
ausreichend ?* tungszustand nicht
ausreichend ? *
ja nein ja nein
nicht nicht er- nicht er-
erheb- erheb- erheb- heblich heblich
lich lich lich
*Hierbei sind auch kumulative Effekte durch andere Projekte oder Pläne zu berücksichtigen.
Abb. 5: Ermittlung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele.
[KAISER, 2003; geringfügig geändert]
Bei der Beurteilung des Maßes der Erheblichkeit sind neben kumulativen Effekten durch an-
dere Projekte oder Pläne auch bestehende Beeinträchtigungen (Vorbelastungen) zu berück-
sichtigen. Einerseits kann die Neubelastung dazu führen, dass ein Erhaltungsziel erheblich
beeinträchtigt wird („Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.“), andererseits kann
die Beseitigung einer solchen Vorbelastung zwingende Voraussetzung für das Erreichen der
Erhaltungsziele sein. Sofern das Beseitigen einer solchen Vorbelastung vorhabensbedingt un-
möglich wird, führt auch das zu einer vorhabensbedingten erheblichen Beeinträchtigung der
Erhaltungsziele. [KAISER, 2003]
Bezüglich der Realisierung der Vorgaben der Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
wird, unter Berücksichtigung der Erhaltungsziele und den Ausführungen im Kapitel 4.3 festge-
stellt, dass erheblichen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können, unter der
Bedingung, dass die im Kapitel 5. aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen realisiert werden.
16Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
Begründung:
- Das Vorhaben hat keine erheblichen Auswirkungen auf Lebensraumtypen, Pflanzen oder
Tiere von gemeinschaftlichem Interesse, unter der Bedingung, dass die im nachfolgenden
Kapitel beschriebenen Maßnahmen realisiert werden.
- Kumulative Effekte mit anderen Plänen oder Projekten, welche zu einer erheblichen Be-
einträchtigung der Erhaltungsziele führen können, sind nicht bekannt.
- Der Beseitigung vorhandener Vorbelastungen steht die Umsetzung der Vorgaben der
Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“ nicht entgegen.
5. Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und -kompensation
Vermeidungsmaßnahme V 1: Untersuchung von Gebäuden:
Unmittelbar vor Beginn der Umbau-/Sanierungs- und/oder Abbrucharbeiten sind die Gebäude
auf das Vorkommen von gebäudebewohnenden Arten zu prüfen. Die Untersuchungen sind
zeitnah vor dem Beginn der Baumaßnahmen durchzuführen. Kommen entsprechende Arten
vor, sind ggf. weiterführende Maßnahmen notwendig.
Begründung:
Die Maßnahme V 1 leitet sich aus den Vorgaben der FFH- Erheblichkeitsabschätzung sowie
aus dem Artenschutzrecht nach § 44 BNatSchG ab.
Die Vorgaben leiten sich direkt aus dem Naturschutzgesetz ab und sind zwingend zu berück-
sichtigen.
Vermeidungsmaßnahme V 2: Baumschutz
Die Linden Nr. 1, 2, 3 und 20 sind zu erhalten und während der Baumaßnahmen durch das
Aufstellen von Bauzäunen und Maßnahmen nach DIN 18 920 zu schützen.
Maßnahmen während der Bauzeit nach DIN 18 920 :
1. Schutz vor mechanischen Beschädigungen des Stammes durch einen Brettermantel und Abpolsterung
gegen den Baum oder durch Umwicklung des Stammes mit Dränageschläuchen d 100 .
2. Schutz des Wurzelbereiches vor Abgrabung. Grabungen müssen mindestens 2 m vom Stamm entfernt
erfolgen.
3. Schutz des Wurzelbereiches gegen Druckschäden durch Überfahren mit schwerer Technik. In diesen Be-
reichen ist eine Überdeckung mit Kiessand 0/8 vorzunehmen.
4. Schutz des Wurzelbereiches vor Überfüllung mit Erdstoff.
Arbeiten im Wurzelbereich, Behandlung von Wurzelschäden nach ZTV-Baumpflege:
5. Es ist alles daran zu setzen, den Schachtbereich durchlaufende Wurzeln zu erhalten. Erdarbeiten im Wur-
zelbereich sind grundsätzlich in Handschachtung durchzuführen.
6. Arbeiten an lebenden Grob- und Starkwurzeln dürfen die Standfestigkeit und Lebensfähigkeit des Baumes
nicht gefährden. Wurzeln mit einem Durchmesser > 3 cm dürfen nicht durchtrennt werden. Verletzungen
sollen vermieden werden und sind ggf. zu behandeln.
7. Wurzeln sind schneidend zu durchtrennen und die Schnittflächen sind zu glätten. Schwach- und Grobwur-
zeln sind schräg nach unten zu schneiden. Bei Starkwurzeln ist die Schnittfläche möglichst klein zu halten
(Schnitt rechtwinklig zum Wurzelverlauf). Wurzelenden mit einem Durchmesser < 2 cm sind mit wachs-
tumsfördernden Stoffen, mit einem Durchmesser > 2 cm mit Wundbehandlungsstoffen zu behandeln.
8. Die Wurzeln sind gegen Austrocknung und Frosteinwirkung zu schützen.
9. Verfüllmaterialien müssen durch die Art der Körnung (enge Stufung) und Verdichtung eine dauerhafte
Durchlüftung zur Regeneration der beschädigten Wurzeln sicherstellen.
10. Entsprechend dem Wurzelverlust können Verankerungen und / oder ausgleichende Schnittmaßnahmen in
der Krone erforderlich werden.
Schnittmaßnahmen in der Krone nach ZTV-Baumpflege:
11. Bei allen Schnittmaßnahmen ist ein arttypisches Erscheinungsbild des Baumes anzustreben.
12. Schnitte sind so zu führen, dass der Astring und/oder die vorhandene Schutzzone erhalten bleiben, eine
gute Kallusbildung und Überwallung der Wunde möglich ist und kein Stummel verbleibt.
13. Schnitte am Astkragen sind so zu führen, dass der obere Punkt der Schnittlinie außerhalb der in der Ga-
bel verlaufenden Rindenleiste liegt.
17Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
14. Starkäste sollten nur in begründeten Ausnahmefällen abgeschnitten werden.
Sämtliche Arbeiten an den Bäumen sind durch qualifizierte Fachfirmen durchzuführen.
Begründung und Festsetzungsvorschlag:
Der Erhalt der Bäume 1 und 3 leitet sich aus den Vorgaben der FFH- Erheblichkeitsabschät-
zung sowie aus dem Artenschutzrecht nach § 44 BNatSchG ab. Auch erfüllen diese Bäume
die Kriterien für höhlenreiche Einzelbäume nach § 21 SächsNatSchG und sind daher beson-
ders geschützt.
Die Bäume 2 und 20 sind ortsbildprägend und aus städtebaulichen Gründen (Bestandteil
einer Baumreihe entlang der Straße) zu erhalten.
Zur Durchsetzung der Maßnahme V 2 sollte in die Ergänzungssatzung auf der Rechtsgrund-
lage von § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB folgende Festsetzung aufgenommen werden:
„Die Linden im Süden der Flurstücke 3084 und 3086 sind gemäß
zeichnerischer Festsetzung zu erhalten. Abgänge sind artgleich zu
ersetzen. Die Ersatzpflanzungen (Stammumfang mindestens 16 - 18
cm) sind in einem Abstand von maximal 2 m zur Grundstücksgrenze
und maximal 3 m entfernt vom alten Baumstandort, zu pflanzen.“
Die Linden sind im Plan mit dem Planzeichen 13.2.2 (Erhaltung Bäume) der PlanZV festzu-
setzen.
Kompensationsmaßnahme K1: „Anlage einer Streuobstwiese auf dem Flurstück
3222/1 der Gemarkung Dahlen“
Vorbemerkung:
Wie im Kapitel 6. ausgeführt, können die mit der Realisierung der Vorgaben der Ergänzungs-
satzung verbundenen Eingriffe in Natur- und Landschaft nicht innerhalb des Geltungsberei-
ches ausgeglichen werden. Zum Ausgleich der Eingriffsfolgen ist eine externe Kompensati-
onsmaßnahme erforderlich.
Die geplante Kompensationsmaßnahme soll auf dem Flurstück 3222/1 der Gemarkung Dahlen
realisiert werden.
Eigentumsverhältnisse:
Bei dem Flurstück 3222/1 der Gemarkung Dahlen handelt es sich um ein kommunales Flur-
stück.
18Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
Lage
Die Fläche für die Kompensationsmaßnahme befindet sich im Osten von Dahlen. Die Lage ist
in der folgenden Karte dargestellt (ohne Maßstab):
Abb. 6: Lage der Kompensationsfläche (ohne Maßstab)
Abb. 7: Lage des Flurstückes 3222/1 (ohne Maßstab)
19Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
Eignung und Bestand:
Die Fläche liegt im selben Naturraum („Nordsächsisches Platten- und Hügelland“) wie die Ein-
griffsfläche. Die Voraussetzung nach § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG (Lage der Ersatzmaß-
nahme im betroffenen Naturraum) wird damit erfüllt.
Bei der Fläche handelt es sich um eine Wiesenfläche auf einem terrassierten, nordexponierten
Hang mit Plateauflächen. Die Wiese ist rasenartig kurz und wird offensichtlich regelmäßig ge-
mäht.
Folgende charakteristische Pflanzenarten konnten nachgewiesen werden:
Agropyron repens - Gemeine Quecke
Arrhenatherum elatius - Glatthafer
Cardamine pratensis - Wiesen-Schaumkraut
Cerastium holosteoides - Gemeines Hornkraut
Dactylis glomerata - Knaulgras
Festuca rubra - Rot-Schwingel
Glecoma hederifolia - Gundermann
Hypochaeris radicata - Gewöhnliches Ferkelkraut
Lamium purpureum - Rote Taubnessel
Lolium perenne - Deutsches Weidelgras
Luzula campestris - Gemeine Hainsimse
Ranunculus acris - Scharfer Hahnenfuß
Ranunculus repens - Kriechender Hahnenfuß
Rumex acetosa - Wiesen-Sauerampfer
Rumex obtusifolius - Stumpfblättrige Ampfer
Taraxacum officinale - Kuhblume
Trifolium repens - Weiß-Klee
Veronica chamaedrys - Gamander Ehrenpreis
Im Westen der Wiese steht eine Reihe Pflaumenbäume:
Tabelle 5: Gehölzbestand auf dem Flurstück 3222/1 der Gemarkung Dahlen
Stam Höhe
m-Ø in in m
1,30 m Kronen-
Nr. Art Höhe Ø in m Schnitt Bemerkungen
Hauspflaume / einseitige Krone; Stammscha-
1 12 6 3 Is
Prunus domestica den
Hauspflaume /
2 15 7 3 Is
Prunus domestica
Hauspflaume /
3 30 7 7 En viel Totholz
Prunus domestica
Hauspflaume /
4 30 7 6 En viel Totholz
Prunus domestica
Hauspflaume /
5 30 8 7 En Totholz
Prunus domestica
Hauspflaume /
6 30 6 7 En Totholz
Prunus domestica
Sauerkirsche /
7 10 1,5 2 Is Niederstamm
Prunus cerasus
Abkürzungen zu den notwendigen Schnittmaßnahmen:
Is: Instandhaltungsschnitt
En: Erneuerungsschnitt
20Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
Bild 1: Blick auf die Hangterrassen im Nordosten (21.04.2021)
Bild 2: Blick auf den Hang im Osten (21.04.2021)
21Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
Bild 3: Plateaufläche im Westen (21.04.2021)
Bild 4: Plateaufläche im Nordwesten (21.04.2021)
22Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
Bild 5: Blick auf die Pflaumenreihe im Westen (21.04.2021)
Maßnahmenbeschreibung:
Auf dem Flurstücken 3222/1 der Gemarkung Dahlen ist auf einer Fläche von ca. 1.800 m² eine
Streuobstwiese anzulegen.
Insgesamt sind auf der Fläche 23 Obstbäume zu pflanzen. Die Bäume sind in einem Abstand
von ca. 10 bis 12 m auf den Plateauflächen und an den Böschungsschultern und Hangfüssen,
in einem Abstand von wenigstens 10 m zum Wald fachgerecht zu pflanzen.
Die Lage der empfohlenen Pflanzstandorte geht aus dem nachfolgenden Lageplan hervor.
Für die Pflanzung sind regionaltypische Sorten zu verwenden. Besonders geeignete land-
schaftsraumtypische Obstsorten sind [Quelle: SMUL; 2003]:
Apfelsorten:
Altländer Pfannkuchenapfel Lunower
Auralia Maunzen
Bittenfelder Melrose
Blenheim Minister von Hammerstein
Bohnapfel Piros
Brettacher Prinz Albrecht von Preußen
Carola Prinzenapfel
Coulon - Renette Reka
Dülmener Rosenapfel Relinda
Finkenwerder Herbstprinz Retina
Fischer Rheinischer Krummstiel
Geflammter Kardinal Riesenboiken
Glockenapfel Rote Sternrenette
Grahams Jubiläumsapfel Roter Eiserapfel
Halberstädter Junfernapfel Roter Gravensteiner
Helios Schöner von Herrnhut
Jakob Schöner von Nordhausen
Kaiser Wilhelm Winterrambour
Krügers Dickstiel Zabergäu-Renette
Birnensorten:
Armida Paris
Bunte Julibirne Pastorenbirne
Clairgeau Petersbirne
23Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
Eckehard Phillipsbirne
Gute Graue Pitmaston
Köstliche von Charneu Poiteau
Lucius Thimo
Marianne Triumph von Vienne
Süßkirschen:
Altenburger Melonenkirsche Fromms Herz
Bianca Kassins Frühe
Büttners Rote Knorpel Namara
Dönissens Gelbe Teickners Schwarze Herzkirsche
Drogans Gelbe Knorpel Türkine Namosa
Durone de Vignola
Folgende Pflanzqualitäten sind mindestens einzuhalten:
Hochstamm; Stammhöhe mindestens 1,8 m,
Stammumfang mindestens 7 cm in 1 m Höhe,
mindestens 3 Leitäste neben dem Mitteltrieb bei der einjährigen Krone.
Schnittmaßnahmen
Die Bäume sind jährlich zu schneiden. In das Schnittprogramm sind auch die vorhandenen 7
Obstbäume mit aufzunehmen (siehe Tabelle 5).
Je nach Alter und Zustand sind im Bestand folgende Schnittmaßnahmen durchzuführen:
Erziehungsschnitte / Pflanzschnitt
An den neu gepflanzten Bäumen sind fachgerechte Pflanz- und Erziehungsschnitte durch-
zuführen. Diese Schnitte dienen dem Aufbau eines geordneten Kronengerüstes aus der
Stammverlängerung und den Leitästen.
Instandhaltungsschnitte
An Bäumen mit abgeschlossener, korrekter Kronenbildung sind Instandsetzungsschnitte
durchzuführen. Dazu ist der Kronenraum auszulichten und es ist ein Fruchtholzschnitt an
Seitenzweigen der Leitäste und ggf. auch unmittelbar am Leitast vorzunehmen.
Der Bedarf und der Umfang der Instandhaltungsschnitte richten sich nach dem Wachstum
in der Krone. Er dient der alljährlichen Überwachung.
Erneuerungsschnitt
Bei stark verkahlten oder überalterten Bäumen ist ein Erneuerungsschnitt (Verjüngungs-
bzw. Sanierungsschnitt) durchzuführen. Dabei ist die Krone stark auszulichten. Durch den
Rückschnitt ins ältere Holz soll ein kräftiger Austrieb provoziert werden.
Totholz ist dabei aus dem Kronenraum zu entfernen. Je nach Alter des Baumes können
aber stärkere, abgestorbene Äste als Lebensraum im Kronenraum belassen werden.
Starkäste mit Baumhöhlen sollen auf jeden Fall am Baum verbleiben (wobei an den Bäu-
men solche nicht festgestellt werden konnten).
Wiesenpflege
Die Fläche unter den Bäumen ist extensiv zu pflegen. Eine extensive Pflege bedeutet eine ein-
bis zweimalige Mahd im Jahr und den Verzicht auf Dünger- und Pflanzenschutzmittel. Das
Mähgut ist von der Fläche abzutransportieren.
24Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
Abb. 8: Bestandsplan Flurstück 3222/1 mit Lage der empfohlenen Pflanzstandorte
(ohne Maßstab)
Sicherung:
Die Kompensationsmaßnahme wird durch die Stadt Dahlen durchgeführt (§ 135a Abs. 2
BauGB) und zur Refinanzierung zugeordnet. Dazu sollte in die Ergänzungssatzung folgende
Zuordnungsfestsetzung aufgenommen werden:
Zuordnungsfestsetzung zum Ausgleich außerhalb des Plangebietes
Planungsrechtliche Grundlage: § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB
Festsetzung:
Die Kompensationsmaßnahme K1 „Anlage einer Streuobstwiese auf dem Flurstück
3222/1 der Gemarkung Dahlen“ wird den in der Ergänzungssatzung „Am Weinberg
Südwest“ der Stadt Dahlen ausgewiesenen Baugrundstücken zum Ausgleich zugeord-
net.
Verteilungsmaßstab für die Kosten ist die zulässige Grundfläche auf den Baugrundstü-
cken.
Begründung:
Entsprechend der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung muss der Eingriff in Natur und
Landschaft in der Höhe eines Wertpunktedefizites von 14.318 Wertpunkten außerhalb
des Plangebietes ausgeglichen werden. Dazu wird die Kompensationsmaßnahme K1
durchgeführt.
Mit der Zuordnungsfestsetzung werden die zu erwartenden Eingriffe im Geltungsbe-
reich der Ergänzungssatzung der externen Ausgleichsmaßnahme eindeutig zugeord-
net.
Als Verteilungsmaßstab der Kosten wurde die zulässige Grundfläche auf den jeweili-
gen Baugrundstücken gewählt, da die Baugebiete in Hinblick auf ihre Bedeutung für
Natur- und Landschaft als gleichwertig zu beurteilen sind.
25Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
Realisierungszeitraum:
Die Fertigstellung der Kompensationsmaßnahme muss spätestens 12 Monate nach Beendi-
gung der Baumaßnahmen (Errichtung Hauptbaukörper) abgeschlossen sein. Wird die Bebau-
ung im Geltungsbereich der Ergänzungssatzung abschnittsweise realisiert, kann auch die
Kompensationsmaßnahme anteilmäßig abschnittsweise realisiert werden.
6. Eingriffsbeschreibung und –bewertung mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung
Die nachfolgende Flächenbilanz verdeutlicht die bei Vorhabenrealisierung zu erwartenden
Änderungen der Flächennutzung.
Tabelle 6: Flächenbilanz
Fläche in Anteil
Bestand m² in %
vollversiegelte Flächen; Gebäude 81 2,4
vollversiegelte Flächen 289 8,5
teilversiegelte Flächen 18 0,5
Folieteich 3 0,1
nitrophile Gras- und Krautflur; Straßenrand 410 12,1
Gartenland 2.260 66,6
Gebüsche, (Schnitt-)Hecken mit hohem Koniferenanteil 331 9,8
gesamt: 3.392 100,0
Fläche in Anteil
Planung m² in %
vollversiegelte Fläche; Straße (Übernahme aus Bestand) 271 8,0
überbaubare Grundstücksfläche 1.084 32,0
nicht überbaubare Grundstücksfläche 1.627 48,0
nitrophile Gras- und Krautflur; Straßenrand
(Übernahme aus Bestand) 410 12,1
gesamt: 3.392 100,0
Das Planungsgebiet hat eine Gesamtflächengröße von ca. 3.392 m². Der Anteil voll- und teil-
versiegelten Flächen beträgt in der Planung für das gesamte Gebiet etwa 1.355 m² (40 %) im
Gegensatz zum Bestand in welchem 391 m² (11,5 %) überbaut sind. Der Anteil der bebauten
Flächen steigt somit um 964 m² (28,4 %).
Die Realisierung der geplanten Bauvorhaben stellen einen Eingriff im Sinne des § 18
BNatSchG (bzw. § 8 SächsNatSchG) dar.
Dieser Eingriff bedeutet:
ein Verlust aller Bodenfunktionen auf den neu versiegelten Flächen,
eine Verminderung von Lebensbereichen für die Flora und Fauna (verstärkte Zerschnei-
dung von Lebensräumen),
eine Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate durch eine zusätzliche Bodenversie-
gelung und damit der Reduzierung des Wasseraufnahmevermögens,
eine Erhöhung der Oberflächenabflüsse durch größere Flächenversiegelung.
In der folgenden Tabelle sind die Auswirkungen der Baumaßnahmen aufgezeigt.
26Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“
FFH – Erheblichkeitsabschätzung sowie E-/A-Bilanz
Stand: 23.04.2021
In der Tabelle wurde unterschieden zwischen:
- anlagebedingten, d.h. im Zusammenhang mit der Anlage des Vorhabens stehenden
- betriebsbedingten, d.h. im Zusammenhang mit dem Betrieb des Vorhabens stehenden
- baubedingten, d.h. im Zusammenhang mit der Bauphase des Vorhabens stehen-
den
Auswirkungen.
Tabelle 7: Umweltauswirkungen
Umweltauswirkung
Schutzgüter anlagebedingte Auswirkung betriebsbedingte Aus- baubedingte Auswirkung
wirkungen
Boden Einschränkung von Bodenfunktionen auf- Es sind keine mess- Beeinträchtigungen des Bodens be-
grund der zusätzlichen Überbauung von baren Beeinträchti- ziehen sich auf mögliche Kontami-
insgesamt 964 m² Fläche. gungen zu erwarten. nation in der Bauphase (bei Hava-
rien).
Wasser
Grundwasser Geringfügige Verminderung der Grund- Es sind keine mess- Beeinträchtigungen des Grundwas-
wasserneubildungsrate aufgrund der zu- baren Beeinträchti- sers beziehen sich auf mögliche
sätzlichen Überbauung von insgesamt gungen zu erwarten. Kontamination in der Bauphase (bei
964 m² Fläche. Havarien).
Oberflächenwasser Geringfügige Erhöhung von Oberflächen- Es sind keine mess- Beeinträchtigungen des Oberflä-
abflüssen aufgrund der zusätzlichen baren Beeinträchti- chenwassers beziehen sich auf
Überbauung von insgesamt 964 m² Flä- gungen zu erwarten. mögliche Kontamination in der Bau-
che. phase (bei Havarien).
Klima / Luft Geringfügige und kleinräumige Ver- Es sind keine mess- Es sind keine messbaren Beein-
schlechterung des Mikroklimas durch baren Beeinträchti- trächtigungen zu erwarten.
Überwärmung aufgrund der zusätzlichen gungen zu erwarten.
Befestigung (964 m²).
Tiere / Pflanzen und Verlust von Pflanzenstandorten und Tier- Es sind keine mess- Mögliche Verluste von Pflanzen-
deren Lebensräume / lebensräumen aufgrund der zusätzlichen baren Beeinträchti- standorten und Tierlebensräumen
Lebensraumfunktionen Überbauung von insgesamt 964 m² Flä- gungen zu erwarten. im Falle von Kontamination in der
che. Bauphase (bei Havarien).
Tötung nicht fluchtfähiger Tiere
während der Bauphase.
Beunruhigung von Tierlebensräu-
men durch Baulärm, Erschütterun-
gen, Staub, Licht etc.
Landschaftsbild / Erho- Mit Planrealisierung ändert sich das Land- Es sind keine mess- Temporäre Beeinträchtigung der
lungsfunktion schaftsbild vor Ort. Aufgrund der geringen baren Beeinträchti- Erholungseignung durch Baustel-
Dimension der baulichen Anlagen und gungen zu erwarten. lenbetrieb und -verkehr im Bereich
dem geplanten Baumerhalt, wird einge- des angrenzenden Weges.
schätzt, dass die Veränderung des Land-
schaftsbildes nicht erheblich ist.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die größten Auswirkungen mit der baulichen Bean-
spruchung derzeit unbefestigter Flächen (Gartenland, Gebüsche und Hecken mit einem hoh-
nen Koniferenanteil) verbunden sind.
Aufgrund der geringen Größe der beanspruchten Fläche, der Bestandssituation, dem geplan-
ten Baumerhalt und der Lage, wird eingeschätzt, dass die Auswirkungen auf die Schutzgüter
Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und Landschaftsbild nur von geringer Intensität sind.
Es wird eingeschätzt, dass der mit dem Bauvorhaben verbundene Eingriff in Natur- und Land-
schaft durch die geplante Gehölzpflanzung (Maßnahme K1) kompensiert werden kann.
Zur besseren Skalierung des Eingriffs wurde nachfolgend das Ergebnis der verbal - argumen-
tativen Eingriffs- /Ausgleichsbewertung anhand eines Biotopwertverfahrens durchgerechnet.
Ziel dieser Prüfung ist es, Planungssicherheit zu erlangen, da die verbal - argumentative Kom-
pensationsermittlung kaum anhand von vergleichbaren Fällen relativierbar bzw. überprüfbar
und nur schwer nachvollziehbar ist. [vgl. KÖPPEL u.a., 1998, S. 217 - 218]
Die nachfolgende Bilanzierung erfolgte auf Grundlage der „Handlungsempfehlung zur Bewer-
tung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen; Stand Juli 2003“.
Die Darstellung der Bilanzierung in der nachfolgenden Tabelle weicht von der Handlungsemp-
fehlung ab, da die dort gewählte Darstellungsform für das kleine Gebiet zu kompliziert (und
27Sie können auch lesen