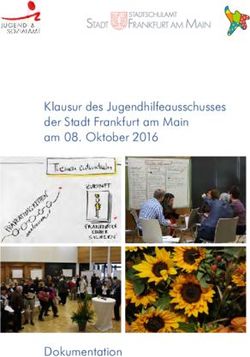FACHSCHULE FÜR SOZIALPÄDAGOGIK - Abschlussprüfung im Sommer 2020 Sprache und Kommunikation Entwicklung und Bildung Gesellschaft, Organisation und ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
F ACHSCHULE FÜR S OZIALPÄDAGOGIK
Abschlussprüfung im Sommer 2020
Schwerpunktthemen für die schulübergreifenden schriftlichen
Prüfungsaufgaben für die Fächer
Sprache und Kommunikation
Entwicklung und Bildung
Gesellschaft, Organisation und RechtFachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhaltsverzeichnis
Seite
Allgemeine Regelungen und Verfahren 3
Verfahren zur Vorbereitung der schulübergreifenden 4
Aufgabenstellung
Anforderungsbereiche 5
Liste der Arbeitsaufträge (Operatoren) 7
Sprache und Kommunikation 9
Entwicklung und Bildung 14
Gesellschaft, Organisation und Recht 17
Februar 2019
Herausgeberin: Behörde für Schule und Berufsbildung, Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB)
Postfach 76 10 48 • D- 22060 Hamburg
www.hibb.hamburg.de
-2-Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allgemeine Regelungen
Seit dem Prüfungsdurchgang im Sommer 2008 erhalten die Schülerinnen und Schüler der
Hamburger Fachschulen für Sozialpädagogik zentral erstellte Prüfungsaufgaben für die
schriftliche Abschlussprüfung in den drei Klausurfächern.
Die zentrale Aufgabenstellung in der schriftlichen Prüfung ist Bestandteil der Standard- und
Qualitätssicherung schulischer Arbeit. Verbindlichkeit und Vergleichbarkeit der Unterrichts-
und Prüfungsleistungen sind Qualitätsmerkmale der Fachschulen für Sozialpädagogik in
Hamburg:
• Einheitliche Standards für Unterricht und Abschlüsse der Schulen werden gesichert.
• Die in den einzelnen Schulen erbrachten Lernleistungen werden durch Evaluation der
schulischen Arbeit vergleichbar.
• Die Qualität des Unterrichts wird angehoben, die Fächer werden didaktisch weiterentwi-
ckelt.
• Die Qualität der Abschlussqualifikation in der Erzieherausbildung wird gesichert.
• Die Lehrkräfte werden im Bereich der Erstellung der Prüfungsaufgaben entlastet.
Die schriftliche Abschlussprüfung mit zentraler Aufgabenstellung erstreckt sich auf die Fä-
cher:
• Sprache und Kommunikation
• Entwicklung und Bildung oder Gesellschaft, Organisation, Recht
Schulübergreifende Aufgabenstellungen für die Facharbeit im Fach „Sozialpädagogisches
Handeln“ und für die mündlichen Prüfungen sind nicht vorgesehen.
-3-Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verfahren zur Vorbereitung der schulübergreifenden Aufgabenstellung
Festlegung der Themenschwerpunkte
In diesem Heft erhalten Sie für den dreijährigen Bildungsgang mit dem Ziel „Staatlich aner-
kannte Erzieherin" bzw. „Staatlich anerkannter Erzieher", der am 1. August 2017 begonnen
hat, die Angaben über die Schwerpunkte, auf die sich die schulübergreifenden Aufgabenstel-
lungen für den Sommer 2020 beziehen werden. Die Themenschwerpunkte sind Eingrenzun-
gen und Konkretisierungen der im Bildungsplan enthaltenen Fächer und Lernfelder. Weiter-
hin gibt es Literaturhinweise, wobei in der Regel für die Erarbeitung des Themas zwischen
verbindlicher Lektüre und weiterführenden Hinweisen unterschieden wird.
Erstellung von Aufgaben
Die Prüfungsaufgaben werden von bewährten und zur Verschwiegenheit verpflichteten Fach-
lehrerinnen und Fachlehrern aus den Schulen entworfen und anschließend durch das Ham-
burger Institut für Berufliche Bildung geprüft und genehmigt.
Organisation
• Die Schülerinnen und Schüler treffen die Wahl zwischen den Prüfungsfächern „Entwick-
lung und Bildung“ sowie „Gesellschaft, Organisation, Recht“ in dem Semester, an dessen
Ende die schriftlichen Prüfungen stattfinden. Für jedes Fach wird am Prüfungstag ein
Aufgabensatz zur Bearbeitung vorgelegt.
• Am Prüfungstag für das Fach „Sprache und Kommunikation“ werden den Prüflingen zwei
Aufgabensätze vorgelegt, von denen sie einen zur Bearbeitung auswählen.
• Die schriftliche Prüfung in den einzelnen Prüfungsfächern findet an allen Schulen am
selben Tag und zur selben Zeit statt.
• Für die Bearbeitung der Prüfungsaufgaben stehen jeweils vier Zeitstunden zur Verfü-
gung.
• Die Schulen werden rechtzeitig vorher mit den erforderlichen Aufgabensätzen und Prü-
fungsunterlagen ausgestattet. Für die Korrektur erhalten die Lehrkräfte Erwartungshori-
zonte und Bewertungshinweise.
Rechtliche Regelungen
Es gelten die Regelungen, die in der APO-AT vom 25. Juli 2000, in der APO-FSH vom
16. Juli 2002 und in der Handreichung für Prüfungen in den Vollzeitformen der beruflichen
Schulen vom Juni 2016 aufgeführt sind.
-4-Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anforderungsbereiche
Die Anforderungen in der Prüfung unterscheiden sich nach der Art, der Komplexität und dem
Grad der Selbstständigkeit der geforderten Leistung; sie verlangen unterschiedliche Arbeits-
weisen. Zur Erhöhung der Transparenz und Vergleichbarkeit lassen sich drei Anforderungs-
bereiche beschreiben, ohne dass diese in der Praxis der Aufgabenstellung immer scharf
voneinander getrennt werden können. Daher ergeben sich Überschneidungen bei der Zu-
ordnung der Teilaufgaben zu den Anforderungsbereichen. Im Laufe der Ausbildung soll die
Fähigkeit erworben werden, zu erkennen, auf welcher Ebene gemäß der Aufgabenstellung
gearbeitet werden muss.
Die zentralen Aufgaben der schriftlichen Prüfung ermöglichen Leistungen in allen drei Anfor-
derungsbereichen, dabei liegt der Schwerpunkt im Anforderungsbereich II. „Gute" oder „sehr
gute" Leistungen setzen angemessene Ergebnisse auch im Anforderungsbereich III voraus.
„Ausreichende“ Leistungen setzen Leistungen im Anforderungsbereich I und teilweise im An-
forderungsbereich II voraus.
Anforderungsbereich l (Reproduktion)
Der Anforderungsbereich I umfasst die Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen im
gelernten Zusammenhang (Reproduktion) sowie die Beschreibung und Anwendung geübter
Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in einem wiederholenden Zusammenhang.
Das bedeutet zum Beispiel:
• Inhalte von Texten wiedergeben
• Im Unterricht behandelte Ansätze und Maßnahmen in pädagogischen Handlungsfel-
dern darstellen
• Theorien darstellen
• Im Unterricht behandelte Begriffe erläutern
Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)
Der Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten
und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch
Übung bekannten Zusammenhang und das selbstständige Übertragen und Anwenden des
Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte.
Das bedeutet zum Beispiel:
• Den Inhalt eines bisher nicht bekannten, komplexen, berufsbezogenen Textes oder
einen umfassenden fachspezifischen Sachverhalt in eigenständiger Form wiederge-
ben und ihn dabei zusammenfassen
• Die Struktur eines Textes erfassen
• Die Argumentation eines Textes beschreiben
• Generalisierende Aussagen konkretisieren
• Wortschatz, Satzbau und poetische / stilistische / rhetorische Mittel eines Textes be-
schreiben und auf ihre Funktion und Wirkung hin untersuchen
• Erlernte Untersuchungsmethoden auf vergleichbare neue Gegenstände anwenden
• Konkrete Aussagen angemessen abstrahieren
• Begründete Folgerungen aus Analysen und Erörterungen ziehen
• Strukturen (der Kommunikation) erkennen und beschreiben
• Sprachverwendung in pragmatischen Texten erkennen und beschreiben
• Fachspezifische Verfahren im Umgang mit Texten reflektiert und produktiv anwenden
• Eine Argumentation funktionsgerecht gliedern
-5-Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Eine angemessene Stilebene / Kommunikationsform (differenzierte und klare Darstel-
lungsweise) wählen
• Text-Bild-Ton-Beziehungen in ihrer wechselseitigen Wirkung erkennen (zum Beispiel
im Lernfeld 10, „Kinder- und Jugendliteratur“, in dem auch Hörspiele und Kinderfilme
behandelt werden)
Anforderungsbereich III (Problemlösendes Denken)
Der Anforderungsbereich III umfasst das zielgerichtete Verarbeiten komplexer Sachverhalte
mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen,
Begründungen und Wertungen zu gelangen. Dabei müssen die zur Bewältigung der Aufgabe
geeigneten Arbeitstechniken und Verfahren selbstständig ausgewählt, in einer neuen Prob-
lemstellung angewendet und das eigene Vorgehen beurteilt werden.
Das bedeutet:
• Die Wirkungsmöglichkeiten eines Textes beurteilen
• Beziehungen herstellen, z.B. in einem Text vertretene Positionen in umfassendere
theoretische Zusammenhänge einordnen
• Argumentationsstrategien erkennen und werten
• Aus den Ergebnissen einer Texterschließung oder Erörterung begründete Schlüsse
ziehen
• Bei gestalterischen Aufgaben selbstständige und zugleich textangemessene Lösun-
gen erarbeiten und (unter selbst gewählten Gesichtspunkten) reflektieren
• Fachspezifische Sachverhalte erörtern, ein eigenes Urteil gewinnen und argumentativ
vertreten
• Ästhetische Qualität bewerten
• Eine Darstellung eigenständig strukturieren
Allgemeine Anforderungen:
Zusätzlich zu den Anforderungen, die sich aus der Themenformulierung ergeben, sollen hin-
sichtlich Aufbau und Inhalt sowie Ausdruck und Sprachrichtigkeit folgende Kriterien erfüllt
sein:
• Sich einer verständlichen und sachangemessenen Ausdrucksweise bedienen
• Eine aufgabengemäße Stilebene wählen
• Fachbegriffe richtig verwenden
• Eigene Wertungen begründen
• Gedanken folgerichtig darstellen
• Begründungszusammenhänge herstellen; zwischen Thesen, Argumenten und Bei-
spielen unterscheiden
• Ergebnisse durch funktionsgerechtes Zitieren absichern
• Normgerecht schreiben im Hinblick auf Rechtschreibung, Grammatik, Satzbau und
Zeichensetzung
-6-Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liste der Operatoren
Zentrale Prüfungsaufgaben müssen hinsichtlich des Arbeitsauftrages und der erwarteten
Leistung eindeutig formuliert sein. Die in den schriftlichen Aufgaben verwendeten Operatoren
(Arbeitsaufträge) werden in der folgenden Tabelle definiert und inhaltlich gefüllt. Entspre-
chende Formulierungen in den Klausuren der vorangegangenen Semester sind ein wichtiger
Teil der Vorbereitung auf die Prüfung.
Neben Definitionen und Beispielen enthält die Tabelle auch Zuordnungen zu Anforderungs-
bereichen. Die konkrete Zuordnung kann auch vom Kontext der Aufgabenstellung abhängen.
Eine scharfe Trennung der Anforderungsbereiche ist nicht immer möglich.
Operatoren Erklärung / Ziel der Anweisung Beispiele
Nennen Sie einige Sprachför-
nennen
Ohne nähere Erläuterungen aufzählen derkonzepte. Nennen Sie we-
(I)
sentliche rhetorische Mittel.
Sachverhalte und Zusammenhänge (evtl.
beschreiben Beschreiben Sie das Beobach-
mit Materialbezug) in eigenen Worten
(I – II) tungsverfahren SISMIK.
sachlich wiedergeben
Einen erkannten Zusammenhang oder Stellen Sie die Argumentations-
Darstellen (I – II)
Sachverhalt strukturiert wiedergeben. strategie des Verfassers dar.
Geben Sie den Inhalt des Tex-
zusammenfassen Wesentliche Aussagen komprimiert tes wieder. Fassen Sie Ihre Un-
(l – II) und strukturiert wiedergeben tersuchungsergebnisse zu-
sammen.
Ordnen Sie die Aussagen zur
Sprachförderung einem Sprach-
Mit erläuternden Hinweisen in einen förderkonzept zu.
einordnen (l – ll )
genannten Zusammenhang einfügen Ordnen Sie das genannte Kapi-
tel in den Handlungszusam-
menhang des Romans ein.
Etwas Neues oder nicht explizit For-
muliertes durch Schlussfolgerungen Erschließen Sie aus der Szene
erschließen (II)
aus etwas Bekanntem herlei- die Vorgeschichte der Familie.
ten/ermitteln
Erläutern Sie die Bedeutung
Nachvollziehbar und verständlich ver-
erläutern (II) von Fingerspielen für die
anschaulichen
Sprachförderung.
Unter gezielten Fragestellungen Ele- Analysieren Sie den Romanan-
mente, Strukturmerkmale und Zu- fang unter den Gesichtspunkten
analysieren (ll – lll)
sammenhänge herausarbeiten und die der Erzählperspektive und der
Ergebnisse darstellen Figurenkonstellation.
Setzen Sie Sprachfördermaß-
in Beziehung Zusammenhänge unter vorgegebenen
nahmen der Kita XYZ in Bezug
setzen oder selbst gewählten Gesichtspunk-
zum Konzept der ganzheitlichen
(ll – lll) ten begründet herstellen
Sprachförderung.
Nach vorgegebenen oder selbst ge- Vergleichen Sie die Beobach-
vergleichen wählten Gesichtspunkten Gemein- tungsverfahren SISMIK und
(ll – lll) samkeiten, Ähnlichkeiten und Unter- HAVAS unter dem Gesichts-
schiede ermitteln und darstellen punkt der Praktikabilität.
eine Meinung, Argumentation, Wer-
begründen tung methodisch korrekt und sachlich ... und begründen Sie Ihre Auf-
(ll – lll) fundiert durch Belege, Beispiele absi- fassung.
chern
-7-Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operatoren Erklärung / Ziel der Anweisung Beispiele
Beurteilen Sie traditionelle Kin-
Zu einem Sachverhalt ein selbststän- derverse eigener Auswahl hin-
Beurteilen, bewer- diges Urteil unter Verwendung von sichtlich ihres Sprachförderpo-
ten, Fachwissen und Fachmethoden auf tentials.
Stellung nehmen Grund von ausgewiesenen Kriterien
Bewerten Sie das Verhalten der
(III) formulieren und begründen
Figur am Ende der Roman-
handlung.
Nach ausgewiesenen Kriterien ein be- Setzen Sie sich mit der Auffas-
auseinandersetzen gründetes eigenes Urteil zu einem sung des Autors zu einer ge-
mit ... (III) dargestellten Sachverhalt und / oder sellschaftlichen Erscheinung
zur Art der Darstellung entwickeln auseinander.
Die Darstellung eines Sachverhaltes Überprüfen Sie, ob die vorge-
überprüfen ausgewiesenen Kriterien gegenüber- stellten Maßnahmen geeignet
(III) stellen und zu einem Urteil gelangen sind, Kinder sprachlich zu för-
dern.
Ein Problem erkennen und darstellen,
Erörtern Sie die Frage, ob die
unterschiedliche Positionen einander
Romanfigur X angemessen ge-
gegenüberstellen, eine Schlussfolge-
handelt hat.
rung erarbeiten und darstellen
erörtern oder: Ein Beurteilungs- oder Bewer-
(III) tungsproblem erkennen und darstel-
len, unterschiedliche Positionen sowie
Pro- und Kontra-Argumente abwägen Erörtern Sie einen pädagogi-
und eine Schlussfolgerung erarbeiten schen Zielkonflikt.
und vertreten
Ein komplexeres Textverständnis
nachvollziehbar darstellen:
auf der Basis methodisch reflektierten Interpretieren Sie das 8. Kapitel
interpretieren Deutens von textimmanenten und ggf. aus dem Roman XYZ vor dem
(III) textexternen Elementen und Struktu- Hintergrund des gesamten Ro-
ren zu einer resümierenden Gesamt- mangeschehens.
deutung über einen Text oder einen
Textteil kommen
entwerfen, ent- Auf einer Basis ein zukünftiges Kon-
Entwerfen Sie eine mögliche
wickeln zept in seinen wesentlichen Zügen
Fortsetzung der Erzählung.
(III) planen und darstellen
Gestalten Sie einen Elternbrief
Ein Konzept nach ausgewiesenen Kri-
gestalten für einen Informationsabend
terien sprachlich oder visualisierend
(III) zum Thema Wortschatzförde-
ausführen
rung.
-8-Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprache und Kommunikation
Themenschwerpunkt I - Comics und Graphic Novels in der sozialpädagogischen
Praxis:
Perspektiven und Ansatzpunkte für die Leseförderung
Basiskompetenzen:
1. Die Prüflinge verfügen über grundlegendes Wissen zur Gattung Comic: Sie sind über
die Entstehung und Geschichte des Comics im Überblick informiert, sie können die Be-
griffe „Comic“ und „Graphic Novel“ anhand relevanter Kriterien definieren und dabei Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede bestimmen.
2. Sie kennen zentrale Prinzipien und Merkmale des grafischen Erzählens und können
diese erläutern (zum Beispiel Panels, Gutter, Seitenarchitektur, Sprech- und Gedanken-
blasen, Zeichen wie Soundwords, Bild-Text-Verknüpfung). Sie wissen, dass das Lesen
von Comics verschiedene Teilfähigkeiten erfordert, die über das Lesen eines Printtextes
hinausgehen und können die spezifischen Herausforderungen beschreiben.
3. Die Prüflinge können die Graphic Novel „Der Traum von Olympia“ von Reinhard Kleist
im Hinblick auf ihre Geschichte (Themen und Motive) sowie ihre spezifische Gestaltung
als Graphic Novel untersuchen.
a. Sie können grafische und sprachliche Mittel unter den motivischen Gesichtspunkten:
Traum, Hoffnung, Zweifel und Ausweglosigkeit analysieren und dabei Fachbegriffe
zur Beschreibung des grafischen Erzählens anwenden. Sie können Einzelbilder und
Panelfolgen beschreiben und interpretieren, Zusammenhänge zwischen Bild und
Text in ausgewählten Sequenzen erfassen und die Wirkung konkreter Bild-Text-
Elemente diskutieren.
b. Sie können die Figur Samia Yusuf Omar interpretieren, einen Bezug zur Realität her-
stellen und sich am Beispiel mit Fluchtursachen auseinandersetzen.
4. Die Prüflinge können ausgehend von ihren eigenen Leseeindrücken und Erfahrungen mit
der Graphic Novel „Der Traum von Olympia“ die Chancen des Mediums Comic für das li-
terarische und außerliterarische Lernen erörtern (Stichworte: Lesemotivation, visual li-
teracy, Vermittlung schwieriger Themen).
5. Sie kennen die Bedeutung von Comics für Kinder und Jugendliche sowie zentrale
Argumente, die für oder gegen den Einsatz vom Comics in der Leseförderung sprechen
und können sich mit diesen Aspekten differenziert auseinandersetzen.
6. Die Prüflinge kennen Kriterien zur Beurteilung von Comics sowie (allgemeine) didakti-
sche Anregungen zum Einsatz in der sozialpädagogischen Praxis. Sie sind in der Lage,
ausgehend von ihren eigenen Leseerfahrungen exemplarisch Ideen zum Einsatz einer
Graphic Novel wie „Der Traum von Olympia“ in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
zu entwickeln.
-9-Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mögliche Aufgabenformate
• Darstellung fachwissenschaftlicher und berufsbezogener Inhalte
• Untersuchung und Beurteilung der Graphic Novel im Hinblick auf gestalterische und/ oder
inhaltliche Aspekte
• Darstellung von Interpretationsergebnissen in Bezug auf ausgewählte Sequenzen
• Erörtern bzw. Überprüfen von Thesen, Stellungnehmen zu berufsbezogenen Fragestel-
lungen
• Entwicklung von Angebotsideen zur Präsentation von Comics/ Graphic Novels
Verbindliche Literatur:
Primärliteratur:
Kleist, Reinhard: Der Traum von Olympia. Die Geschichte von Samia Yusuf Omar. Hamburg
2017, ISBN: 978-3-551-71386-5 (Paperback)
Sekundärliteratur:
Fürst, I./ Helbig, E./ Schmitt, V.: Kinder- und Jugendliteratur. Theorie und Praxis. Köln 2013,
S. 235 – 238 (zu BK 5 ), S. 241f (zu BK 6)
Giesa, Felix: Comic, Graphic Novel & Co. als bildbasierte Erzählliteratur. In: Knopf, Julia/ Ab-
raham, Ulf (Hrsg.): BilderBücher. Band 1: Theorie. Baltmannsweiler 2014, S. 74f (zu BK 2)
Hantschel, Manuela: Der Traum von Olympia. Ein Unterrichtsmodell für die Klassen 9 – 13.
In: www.carlsen.de/lehrer (Stand: Okt. 2018), S. 4 – 9, S. 11 (zu BK 3)
Jost, Roland: Comics als Instrument(e) der Leseförderung. In:
https://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=1379 (Stand: Okt. 2018)
(zu BK 4 und 5)
Marquardt, Manfred: Handbuch Kinder- und Jugendliteratur. Troisdorf 2010, S. 176f, 180f (zu
BK 5 und 6)
Schikowski, Klaus: Der Comic. Geschichte, Stile, Künstler. Stuttgart 2014, S. 13 – 26 (zu BK
1 und 2)
Seeßlen, Georg: Rückkehr und Erinnerung. Zehn Variationen der neunten Kunst. In: Text +
Kritik. Zeitschrift für Literatur. Graphic Novels (Sonderband). München 2017, S. 10 – 14 (zu
BK 1 und 4), S. 16 – 26 (Ausschnitte) (zu BK 4)
Sommer, Frank: Mit Comics liest es sich leichter! In: eselsohr, Heft 07/2017, S. 8 (zu BK 5)
Wrobel, Dieter: Graphic Novels. In: Praxis Deutsch. Graphic Novels. Heft 252/ Juli 2015, 42.
Jg., S. 4 – 8 (zu BK 1, 2 und 4), S. 13 (zu BK 2)
- 10 -Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weiterführende Literatur:
Abel, Julia/ Klein, Christian: Leitfaden zur Comicanalyse. In: Dies. (Hg.): Comics und Graphic
Novels. Eine Einführung. Stuttgart 2016, S. 77 – 106 (umfangreiches Modell zur Analyse von
Comics mit vielen Leitfragen und Erläuterungen, empfehlenswert zu BK 2 und 3.)
Breyer, Ariane: „Der Traum von Olympia“: Helden in Grautönen. In: Die Zeit Nr. 13 vom 17.
März 2016 (erhältlich unter: https://www.zeit.de/2016/13/der-traum-von-olympia-graphic-
novel-reinhard-kleist-luchs-des-jahres-2016 (Stand: Okt. 2018) (empfehlenswerte Rezension
der Graphic Novel angesichts des Luchs – Buchpreises im Jahr 2015)
Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Aus Politik und Zeitgeschichte. Comics. Heft 33
– 34/ 2014, 64. Jg. (unterschiedliche Fachtexte zu Geschichte, Formen und Perspektiven des Co-
mics, online kostenlos erhältlich unter http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/189540/comics)
Hantschel, Manuela: Der Traum von Olympia. Ein Unterrichtsmodell für die Klassen 9 – 13.
In: www.carlsen.de/lehrer (die Unterrichtsmaterialien mit vielen methodischen Ideen und Arbeits-
blättern sind nach der Registrierung auf der Lehrerseite des Carlsen-Verlags kostenlos herunterzula-
den, sehr empfehlenswert für BK 3)
Marquardt, Manfred: Handbuch Kinder- und Jugendliteratur. Troisdorf 2010, S. 169 – 173
(prägnante Darstellung der Geschichte des Comics mit Beispielen, zu BK 1)
McCloud, Scott: Comics richtig lesen. Hamburg 1995 (umfangreiche und empfehlenswerte Dar-
stellung der Funktionsweisen des Comics in Comicform, v.a. zu BK 2)
Praxis Deutsch. Zeitschrift für den Deutschunterricht. Graphic Novels. Heft 252/ Juli 2015,
42. Jg. (Die Zeitschrift versammelt mehrere Artikel zum Einsatz von Graphic Novels im Unterricht, da-
runter „drüben“ (Simon Schwartz), „Irgendwie dazwischen“ (Tracy White), „Persepolis“ (Marjane Sat-
rapi). Hieraus lassen sich Anregungen für die eigene unterrichtliche Arbeit mit einer Graphic Novel
ziehen.)
- 11 -Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprache und Kommunikation
Themenschwerpunkt II - Pragmatischer Bereich:
Sprachentwicklung und Sprachförderung von Kindern –
Schwerpunkt: Semantisch-lexikalische Kompetenzen
(LF 12)
Basiskompetenzen:
I Grundlagen:
1. Die Prüflinge sind in der Lage, die vier Sprachebenen zu unterscheiden und wissen,
dass in der Sprachförderung jeweils eine dieser Ebenen gezielt im Fokus stehen kann.
2. Sie kennen die für die lexikalische Ebene zentralen linguistischen Begriffe.
3. Sie wissen, dass die Bedeutungen von Wörtern abhängig von den Festlegungen der
Sprechergemeinschaft, den individuellen Erfahrungen und der kognitiven Entwicklung der
Interaktionspartner sind.
II Erwerb des Lexikons
4. Die Prüflinge können die Sprachentwicklung unter semantisch-lexikalischen Gesichts-
punkten beschreiben.
5. Sie kennen kindliche Erwerbsstrategien.
6. Sie kennen die Ordnungsstruktur des mentalen Lexikons (Unter-, Über-, Nebenordnung,
Kollokationen, Antonyme, Synonyme) und die Bedeutung der Skripte für die Organisation
des mentalen Lexikons.
7. Sie können Unter- und Überdehnung als Übergangsphänomene erläutern und in Äuße-
rungen feststellen.
III Diagnostische Aspekte
8. Die Prüflinge können den Sprachentwicklungsstand von Kindern einschätzen und dabei
die besonderen Voraussetzungen des Lexikonerwerbs von sequentiell zweisprachig auf-
wachsenden Kindern berücksichtigen.
9. Sie sind in der Lage, bei der Einschätzung der Sprachentwicklung Phänomene zu erken-
nen, die Indikatoren für eine lexikalische Störung bei Kindern sein können.
IV Unterstützung der semantisch-lexikalischen Entwicklung
10. Die Prüflinge können Lexikonerwerb in alltäglichen und geplanten Situationen gezielt un-
terstützen und diese Situationen auswerten. Dabei sind sie sich über die Möglichkeiten
und Grenzen sowohl immersiver als auch kompensatorischer Förderansätze sowie orga-
nisatorischer Voraussetzungen von gelingender Sprachförderung im Klaren.
11. Sie wissen, wie sie mit ihrem Sprachverhalten Wortschatzbildung unterstützen können.
12. Sie erkennen und nutzen das sprachbildende Potential von Kinderliteratur im Hinblick auf
Lexikon und Semantik.
- 12 -Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbindliche Literatur
Zu 1. Iven, Claudia (2009): Sprache in der Sozialpädagogik. Troisdorf. S. 13-14
Zu 2. Ruberg, Tobias; Rothweiler, Monika; Koch-Jensen, Levka (2013): Spracherwerb und
Sprachliche Bildung. Lern- und Arbeitsbuch für sozialpädagogische Berufe. Köln. S. 94-95,
97-99
Zu 3. ebd. S. 103-104
Zu 4. ebd. S. 110-111
Zu 5. ebd. S. 112-113
Zu 6. ebd. S. 105-106
- Ruberg, Tobias; Rothweiler, Monika (2012): Spracherwerb und Sprachförderung in
der KiTa. Stuttgart. S. 98-100
Zu 7. Ruberg u.a. (2013): S. 114-115
Zu 8.
- Ruberg u.a. (2013): S. 122, S. 210-211
- Ruberg u.a. (2012): S. 102-104
Zu 9. Ruberg u.a. (2013): S. 124-125
Zu 10.
- Ruberg u.a. (2012) S. 106-111
- Ruberg u.a. (2013): S. 128-130
- Tracy, Rosemarie (2008): Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unter-
stützen. Tübingen. S. 190-198
- Lemke, Vytautas (2009): Sprachförderung im Spannungsfeld von Sprachbad und
Sprachtraining. In: Tracy, Rosemarie; Lemke, Vytautas (2009) (Hrsg.): Sprache macht stark.
Berlin. S. 78-85
Zu 11. Ruberg u.a. (2013) S. 132-134
Zu 12. ebd. S. 140-141
Weiterführende Literatur:
Bunse, Sabine; Hoffschildt, Christiane (o.J.): Sprachentwicklung und Sprachförderung im
Elementarbereich. München
Iven, Claudia (2010): Aktivitäten zur Sprachförderung. Troisdorf
Iven, Claudia (2013): Sprache in der Sozialpädagogik. Arbeitsheft. Köln
Szagun, Gisela (2008): Sprachentwicklung beim Kind. Weinheim
Zur Illustration des Aneignungsprozesses des semantischen Gehalts eines Begriffes:
Nordqvist, Sven (1992): Nicke findet einen Stuhl. Hamburg
- 13 -Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entwicklung und Bildung
Themenbereich: Herausforderndes Verhalten von Kindern wahrnehmen und
professionell begleiten
Themenschwerpunkt I: Schweigende stille und ruhige Kinder konstruktiv be-
gleiten – eine andere Herausforderung in Kita und
Grundschule
Basiskompetenzen:
Die angehenden Erzieherinnen und Erzieher können herausforderndes Verhalten als Auftrag
verstehen, sich mit der Individualität des betreffenden Kindes zu befassen und sein Verhal-
ten im Kontext seiner sozialen Systeme als kompetentes und sinnhaftes Agieren zu deuten.
Eine starke Zurückhaltung oder temporäres Nichtsprechen bewerten sie nicht als persönliche
Zurückweisung, sondern sind in der Lage, ihre Gefühle und Einstellungen zu reflektieren und
können professionelle Distanz und Empathie entwickeln. Exemplarisch kennen sie die Kardi-
nalsymptome und komorbide Störungen von elektivem Mutismus sowie Faktoren, die die
Entstehung dieser Form der Auffälligkeit begünstigen. Sie wissen um die besondere Nähe
dieses Störungsbildes zu sozialer Ängstlichkeit.
Die Fachkräfte sind geübt in der interpretations- und bewertungsfreien Beobachtung und
können sie von Diagnostik unterscheiden. Sie können ihren Blick auf die personalen und so-
zialen Ressourcen des Kindes richten sowie Hypothesen formulieren um das kindliche Han-
deln zu verstehen und um passgenaue, ressourcenorientierte Handlungsstrategien zu entwi-
ckeln. Sie sind sich der Möglichkeiten und Grenzen von Programmen und Trainings bewusst.
Sie können ihr eigenes Handlungsspektrum in der feinfühligen und entwicklungsangemesse-
nen Gestaltung des pädagogischen Alltags verorten.
Die angehenden Erzieherinnen und Erzieher entwickeln Möglichkeiten nichtsprachlicher
Kommunikation. Sie sind in der Lage, adäquate Bedingungen zu schaffen, damit das Kind
die Kita oder Grundschule als sicheren Ort und sich selbst als wirkungsvoll und selbstständig
erleben kann. Sie können Kinder vielfältig bei der Erweiterung ihrer Kommunikations- und
Handlungsfähigkeit unterstützen.
Hinweise für therapeutisches Vorgehen können die Fachkräfte auf den pädagogischen Be-
reich übertragen. Zugleich wissen sie um die Grenzen ihrer professionellen Möglichkeiten
und ihres Auftrags. Unter Berücksichtigung familiärer Lebenswelten können sie die Voraus-
setzungen für Kooperation und Vernetzung herstellen.
Verbindliche Literatur:
FELDMANN, Daniela, KRAMER Jens: Die Erweiterung der Handlungsfähigkeit – ein grund-
legendes Ziel in der systemisch-kooperativen Förderung von Kindern mit selektivem Mutis-
mus. In: https://www.selektiver-mutismus.de/informationen/fachartikel/ (Zugriff am 14.10.18),
2009 (8 S.)
FRÖHLICH-GILDHOFF, Klaus, RÖNNAU-BÖSE, Maike, TINIUS, Claudia: Herausforderndes
Verhalten in Kindergarten und Grundschule. Erkennen, Verstehen, Begegnen. Kohlhammer,
Stuttgart 2017, S.77-84, 88-91, 95-99 (19 S.)
FRÖHLICH-GILDHOFF, Klaus, RÖNNAU-BÖSE, Maike, TINIUS, Claudia: Herausforderndes
Verhalten verstehen. In: kindergarten heute, 5/2018 S.10-14 (5 S.)
PFREUNDER, Michael: Auffälliges Verhalten von Kindern aus systemischer Sicht. kindergar-
ten heute, wissen kompakt. Herder, Freiburg 2015, S.5-10, 19-22, 59-60 (12 S.)
- 14 -Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEINHAUSEN, Hans-Christoph (2010): Mutismus. In: Psychische Störungen bei Kindern
und Jugendlichen. Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. 7., neu
bearbeitete und erweiterte Auflage. Urban und Fischer. München. S. 179-182 (4 S.)
Weiterführende Literatur:
SCHOOR, Udo: Schweigende Kinder im Kindergarten und in der Schule. In: Die Sprachheil-
arbeit 5/2002, S.210-225
SMITS, Anne Mieke, LÜTJE-KLOSE, Birgit: „Guck mal, ich hab was mitgebracht“ – Pädago-
gische Beobachtung und individuelle Begleitung für ein Kind mit Migrationshintergrund. In:
https://www.se-lektiver-mutismus.de/informationen/fachartikel/ (Zugriff am 14.10.18), 2008
- 15 -Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entwicklung und Bildung
Themenschwerpunkt II: Selbstbildungsprozesse begleiten. Selbstbildung und
Partizipation als Weg zu Selbstwirksamkeit
Basiskompetenzen:
Das Kind ist ein kompetentes und von Anfang an dialogfähiges Subjekt seiner Entwicklung.
Bildung wird seit Humboldt als eine Eigentätigkeit des Menschen zur Aneignung der Welt
beschrieben, als eine „Konstruktionsleistung“. Partizipation ist ein Recht auf Beteiligung, auf
die (Mit-) Gestaltung der eigenen Lebensumgebung.
Die angehenden Erzieherinnen und Erzieher begreifen sich selbst als Schlüsselpersonen mit
Erfahrungsvorsprung und Verantwortung, die ihre Macht reflektieren, abgeben und demokra-
tische Prozesse dialogisch initiieren und fördern müssen. Als „Schülerinnen und Schüler“ der
Kinder (Freire) müssen sie versuchen, deren Welt zu verstehen und sich von gewohnten
Rollen verabschieden.
Sie kennen zentrale Prinzipien von Partizipation, die zu vielfältigen sozialen Aushandlungs-
prozessen zwischen allen Beteiligten im pädagogischen Geschehen führen können und da-
mit zu einem wachsenden realistischen Weltbezug sowie komplexen Bildungsprozessen der
Kinder. Sie sind in der Lage, die Potenziale von Beteiligung im Spannungsfeld zwischen der
Ermöglichung von Autonomie und Überforderung auszuloten.
Sie wissen um den Einfluss einer pädagogisch gestalteten Umgebung auf die Erfahrung von
Autonomie und Selbstwirksamkeit (Bandura). Sie erkennen Selbstwirksamkeit als Motor für
Bildungsprozesse sowie als zentralen Schutzfaktor für Resilienz.
Die angehenden Erzieherinnen und Erzieher kennen geeignete pädagogische Verfahren um
resiliente Verhaltensweisen zu fördern ebenso wie das grundlegende „Handwerkszeug“ zur
Förderung von Partizipationsprozessen.
Verbindliche Literatur:
GERRIG, Richard R.: Banduras sozial-kognitive Lerntheorie. In: Psychologie. 21. erweiterte
und aktualisierte Auflage. Pearson Deutschland, Hallbergmoos, 2018, S. 531-533
HANSEN, Rüdiger, KNAUER, Raingard, STURZENHECKER, Benedikt: Partizipation in Kin-
dertageseinrichtungen. So gelingt Demokratiebildung mit Kindern! Verlag das Netz, Weimar,
Berlin, 2015. S.98-102, S.84-88, S.252-261
LUTZ, Ronald: Zusammenhänge von Partizipation und Resilienz. In: KNAUR, Reinhard und
STURZEN-HECKER, Benedikt: Demokratische Partizipation von Kindern. Juventa, Wein-
heim und Basel, 2016, S.91-105
REGNER, Michael, SCHUBERT-SUFFRIAN, Franziska, SAGGAU, Monika: Partizipation in
der Kita. kindergarten heute, praxis kompakt. 3. Aufl. Herder, Freiburg, 2014 S.34-41
Weiterführende Literatur:
AHNERT, Lieselotte: Wieviel Mutter braucht ein Kind? Bindung – Bildung – Betreuung: öf-
fentlich und privat. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, 2010, S.224-245
HANSEN, Rüdiger, KNAUER, Raingard, STURZENHECKER, Benedikt: Partizipation in Kin-
dertagesein-richtungen. So gelingt Demokratiebildung mit Kindern! Verlag das Netz, Weimar,
Berlin, 2015. S.262-270Retzlaff, Rüdiger: Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und sys-
temische Therapie, Stuttgart, Klett-Cotta, 20162, S.93-112
- 16 -Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesellschaft, Organisation und Recht: Kinderrechte 1
Themenschwerpunkt I: Kinderrechte im Alltag von Familien in Deutschland (LF 15)
Basiskompetenzen
Kinder sind (Rechts-) Subjekte. Deutschland hat die UN-Kinderrechtskonvention 1992 über-
wiegend und 2010 vollständig ratifiziert. Seitdem gelten die in der Konvention festgelegten
Rechte auch für Kinder mit Flüchtlingsstatus und damit für alle in Deutschland lebenden Kin-
der und Jugendlichen von 0-18 Jahren. Eine an den Kinderrechten orientierte Pädagogik in-
nerhalb und außerhalb der Familie muss vor diesem Hintergrund dafür sorgen, dass jedes
Kind und jeder Jugendliche über seine Rechte auf Schutz, Beteiligung und Förderung infor-
miert wird. Pädagogische Fachkräfte und Eltern sollten gemeinsam daran arbeiten, dass al-
len Kindern und Jugendlichen ihre Rechte zuteilwerden.
Darum ist es wichtig, dass pädagogische Fachkräfte den Inhalt und Aufbau der UN-
Kinderrechtskonvention sowie den Kinderrechteansatz (im Gegensatz zum sog. Bedürf-
nisansatz) kennen und in der Lage sind, im Rahmen ihrer Erziehungspartnerschaft mit Eltern
angemessen über die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu kommunizieren.
Darüber hinaus brauchen Fachkräfte ein Grundverständnis über den Zusammenhang zwi-
schen sozialpolitischen Entscheidungen und der Umsetzung von Kinderrechten in Deutsch-
land. Sie sollten in der Lage sein, eine eigene Haltung mit Blick auf mögliche und sinnvolle
Maßnahmen zur positiven Weiterentwicklung der Kinderrechtssituation im Alltag von Fami-
lien in Deutschland zu entwickeln.
Das bedeutet, die Absolventinnen und Absolventen …
• verfügen über ein grundlegendes Wissen zur Geschichte, dem Aufbau und den allge-
meinen Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention (Art 2: Recht auf Nichtdiskriminierung,
Art. 3: Recht auf vorranginge Berücksichtigung des Kindeswohls, Art. 4: Verpflichtung zur
Verwirklichung der Kinderrechte, Art 5: Respektierung des Elternrechts und Achtung vor
den sich entwickelnden Fähigkeiten des Kindes, Art. 6: Recht auf Leben und bestmögli-
che Entwicklung, Art 12: Recht auf Berücksichtigung der Meinung des Kindes in allen es
betreffenden Angelegenheiten).
• können die wesentlichen Schutz-, Förderungs- und Beteiligungsrechte von Kindern ein-
ordnen und die daraus sich ergebende Konsequenzen für ihre pädagogische Arbeit re-
flektieren.
• sind in der Lage, die gesellschaftliche Bedeutung des Kinderrechtsansatzes der Kinder
als (Rechts-)Subjekten versteht, zu erörtern und kennen den Unterschied zum Bedürf-
nisansatz.
1
Hilfsmittel für die Examensklausur, die sich auf beide Schwerpunkte bezieht:
Die UN-Kinderrechtskonvention im Wortlaut in: Jörg Maywald (2012): Kinder haben Rechte! Kinder-
rechte kennen-umsetzen-wahren. Beltz Verlag. Weinheim Basel. S. 199-220
- 17 -Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• können an konkreten Beispielen aus den Themenfeldern Kinderarmut, Teilhabe- und Bil-
dungschancen relevante individuelle, soziale und politische Faktoren darstellen (wie z.B.
Herkunft, Wohngegend, sozial-ökonomischer Status und Bildungsstand der Eltern, Migra-
tionserfahrungen, Gesundheit etc.), welche die konkrete Erfahrung von Kindern mit Blick
auf Ihre Rechte beeinflussen.
• können darauf aufbauend geeignete pädagogische und gesellschaftspolitische Ansatz-
punkte zur Unterstützung von den Kindern in Deutschland entwickeln, denen ihre Rechte
noch nicht angemessen zuteilwerden.
Verbindliche Literatur:
Krappmann, Lothar (2015): Die Kinderrechtskonvention. Eine Einführung für alle, die sich für
Kinder einsetzen. In: TPS 10, 2015: Kinderrechte, S. 6-9
Maywald, Jörg (2012): Das Gebäude der Kinderrechte. In: Kinder haben Rechte! Kinderrech-
te kennen-umsetzen-wahren. Beltz Verlag, S. 40-51
Maywald, Jörg (2012): Kinderrechte in der Familie. In: Kinder haben Rechte! Kinderrechte
kennen-umsetzen-wahren. Beltz Verlag, S. 122-125
Deutsches Kinderhilfswerk (2018): Bekanntheit der UN-Kinderrechtskonvention in Deutsch-
land. In: Kinderreport Deutschland 2018. Rechte von Kindern in Deutschland. S. 32-40
Maywald, Jörg (2012): Impulse der National Coalition für die kommende Dekade. In: Kinder
haben Rechte! Kinderrechte kennen-umsetzen-wahren. Beltz Verlag, S. 161-174
Liebel, Manfred (2015): Kinderinteressen zwischen Paternalismus und Partizipation.
Beltz Verlag, S. 358-360
Weiterführende Literatur:
Böttcher, Hartmut; Ellinghaus, Britta et al (2012): Die Kinder- und Jugendhilfeberichte der
Bundesregierung. In: Erziehen, bilden und begleiten. Das Lehrbuch für Erzieherinnen und
Erzieher. Bildungsverlag Eins, S. 166-176
Liebel, Manfred (2015): Kinderinteressen zwischen Paternalismus und Partizipation. Beltz
Verlag, S. 60
Maywald, Jörg (2012): Kinderrechte – ein Blick zurück. In: Kinder haben Rechte! Kinderrech-
te kennen-umsetzen-wahren. Beltz Verlag, S. 20-33
Maywald, Jörg (2012): Die Prinzipien des Kinderrechtsansatzes. In: Kinder haben Rechte!
Kinderrechte kennen-umsetzen-wahren. Beltz Verlag, S. 110-117
Maywald, Jörg (2012): Impulse der National Coalition für die kommende Dekade. In: Kinder
haben Rechte! Kinderrechte kennen-umsetzen-wahren. Beltz Verlag, S. 161-174
Spuida, Kirsten (2015): „Ich hab` ein Recht auf den Hort!“ Was Kinder über ihre Rechte wis-
sen. In: TPS 10: Kinderrechte, S. 4-5
- 18 -Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Themenschwerpunkt II: Kinderrechte in Kita und Schule im Spannungsfeld von
Bildung und Macht (LF16)
Basiskompetenzen:
Pädagogische Fachkräfte in Krippe, Kita, Schule und öffentlicher Erziehung haben – in Er-
gänzung zu den Eltern – dafür Sorge zu tragen, dass Kinder altersgemäß ihre eigenen Rech-
te kennenlernen und im pädagogischen Alltag die tatsächliche Umsetzung ihrer Rechte auf
Schutz, Förderung und Beteiligung erleben.
Eine konsequente Orientierung an Kinderrechten und eine damit verbundene Umsetzung
des Kinderrechtsansatzes sind zentrale Bausteine der Qualität pädagogischen Handelns in
Krippe, Kita, Schule und Jugendhilfe. Dazu brauchen Fachkräfte zum einen fundierte Kennt-
nisse über Kinderrechte und müssen zum zweiten in der Lage sein, ihr eigenes pädagogi-
sches Handeln, institutionelle Bedingungen und gesellschaftliche Zusammenhänge regel-
mäßig kritisch zu reflektieren. Machtverhältnisse zwischen pädagogischen Fachkräften und
Kindern und Jugendlichen, müssen überprüft werden, um pädagogisches Handeln im Alltag
verantwortlich gestalten zu können.
Fachkräfte müssen wissen, welche Handlungsschritte möglich und erforderlich sind, sofern
Rechte von Kindern in pädagogischen Institutionen nicht ausreichend geschützt werden.
Darüber hinaus geht es darum, individuelle, institutionelle und gesellschaftliche Ansätze und
damit die konkreten Bedingungen in Kita und Schule so weiter zu entwickeln, dass Schutz,
Förderung und Beteiligung von Kindern im Sinn ihrer Rechte durchgängig ermöglicht wer-
den.
Das bedeutet, dass die Absolventinnen und Absolventen …
• in Grundzügen den Aufbau und die Zielsetzung der UN-Kinderrechtskonvention be-
schreiben können.
• über ein grundlegendes Wissen über den Zusammenhang zwischen der UN-
Kinderrechtskonvention und dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
insbesondere §1:Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe, §8: Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen, §22-24: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege verfügen.
• in der Lage sind, Konflikte in Kita und Schule aus einer Kinderrechtsperspektive zu ana-
lysieren, mögliche Lösungsvorschläge zu entwickeln und diese kritisch zu reflektieren.
• in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer bewussten Gestaltung von Machtver-
hältnissen zwischen Fachkräften und Kindern in pädagogischen Institutionen erkennen.
• über das nötige Wissen verfügen, um Gelingensbedingungen im Betreuungsalltag und in
den Rahmenbedingungen von Kita und Schule zu identifizieren, die dazu beitragen, dass
Kinder zu ihrem Recht auf Schutz, Förderung und Beteiligung kommen.
• die Bedeutung von Kinder- und Menschenrechtsbildung in Kita und Schule erläutern
können und eine eigene Haltung dazu entwickelt haben.
- 19 -Fachschule für Sozialpädagogik
Regelungen für die schulübergreifenden schriftlichen Prüfungsaufgaben im Sommer 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• im Stande sind, zu ausgewählten praktischen Ansätzen der Kinder- und Menschen-
rechtsbildung in Kita und Schulen (wie Partizipation, Subjektorientierung, vorurteilsbe-
wusste Pädagogik) Stellung zu nehmen.
Verbindliche Literatur:
Beate Rudolf (2014): Kinderrechte als Maßstab pädagogischer Beziehungen. In: Annedore
Prengel, Ursula Winkelhofer (Hg) (2014): Kinderrechte in pädagogischen Beziehungen. Bud-
rich Verlag, Opladen, Berlin, S. 21-31
S. Maywald, Jörg (2014): Recht haben und Recht bekommen. Der Kinderrechtsansatz in
Kindertageseinrichtungen. 9-26 Verfügbar unter: https://www.kita-
fachtexte.de/uploads/media/KiTaFT_maywald_II_2014_1_.pdf Zugriff am 04.10.2018
Haberkorn, Rita; Irskens, Beate (2017): Innehalten! Damit Erzieher/innen den Jüngsten kei-
nen Zwang antun. In: TPS 4, 2017: Bildung und Macht, S. 44-47
Gartinger, Silvia und Janssen, Rolf (Hg.) (2015): Professionelles Handeln im sozialpädagogi-
schen Berufsfeld. Erzieherinnen und Erzieher. Band 1. Modelle und Methoden partizipativer
pädagogischer Arbeit. Cornelsen. Berlin S.240-244
Henkel, Nicole; Neumann, Sascha: Dabeisein (2016): Mitmachen, Einflussnehmen. Ein Blick
auf Kinder als Akteure im Betreuungsalltag. In: TPS 10, 2016: Kindheitsforschung, S.22-25
Lohrenscheit, Claudia (2013): Kinderrechte mit COMPASITO & Co - Menschenrechtbildung
für und mit Kindern; in: Polis – Zeitschrift des Verbands für Politische Bildung in Schule,
Hochschule, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung; Heft 1/2013, S. 6-12
Hutschenreuter, Ilka (2010): „Ja, aber so bei uns mitbestimmen eigentlich nicht, oder?“ Parti-
zipation von Kindern in der Grundschule. In: Friederike Heinzel / Grundschulverband (Hrsg.):
Kinder in Gesellschaft – Was wissen wir über aktuelle Kindheiten? Beiträge zur Reform in
der Grundschule (Nr. 130). Frankfurt am Main, S. 210-221
Weiterführende Literatur:
Gartinger, Silvia und Janssen, Rolf (Hg.) (2015): Professionelles Handeln im sozialpädagogi-
schen Berufsfeld. Erzieherinnen und Erzieher. Band 1. Modelle und Methoden partizipativer
pädagogischer Arbeit. Cornelsen. Berlin S.245-251
Liebel, Manfred (2006): Vom Kinderschutz zur politischen Partizipation? Anmerkungen zu
Praxis und Theorie der Kinderrechte. In: ZSE Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und
Sozialisation. 26.Jahrgang / Heft 1/2006, S.86-99
Maywald; Jörg (2017): Machtausübung in pädagogischen Beziehungen. Kinderrechte sind
Schutz vor Machtmissbrauch. In TPS 4, 2017: Bildung und Macht, S.6-9
Rabe-Kleberg (2017): Erzieherinnen und Macht. Fünf Thesen zu gefühlter Machtlosigkeit
und tatsächlicher Machtausübung. In TPS 4, 2017: Bildung und Macht, S.14-16
Edelstein, Wolfgang, Krappmann, Lothar, Student, Sonja (Hg.)(2016): Kinderrechte in die
Schule. Schwalbach/Ts: Wochenschau Verlag
- 20 -Sie können auch lesen