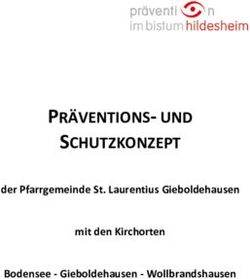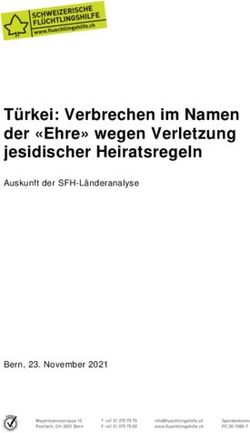Informationsintegration in mehrsprachigen Textchats am Beispiel des Skype Translators im Sprachenpaar Katalanisch-Deutsch
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
I NSTITUT FÜR A NGEWANDTE L INGUISTIK UND T RANSLATOLOGIE
U NIVERSITÄT L EIPZIG
Informationsintegration in mehrsprachigen
Textchats am Beispiel des Skype Translators im
Sprachenpaar Katalanisch-Deutsch
Thesenpapier zur Dissertation von
Felix Hoberg
felix.hoberg@uni-leipzig.de
Stand: 23. Februar 2021
1 Abstract
Die vorliegende Arbeit widmet sich die Informationsintegration in maschinell übersetzten, mehr-
sprachigen Textchats am Beispiel des Skype Translators im Sprachenpaar Katalanisch-Deutsch. Der
Untersuchung von Textchats dieser Konfiguration wurde sich bislang nur wenig zugewendet. Deshalb
wird zunächst der grundlegend explorativ ausgerichteten Forschungsfrage nachgegangen, wie Perso-
nen eine maschinell übersetzte Textchat-Kommunikation wahrnehmen, wenn sie nicht der Sprache des
Gegenübers mächtig sind. Damit einher geht auch die Untersuchung der Informationsextraktion und
-verarbeitung zwischen Nachrichten, die in der eigenen Sprache verfasst wurden, und der Ausgabe
der Maschinellen Übersetzung.
Zur Erfassung des Nutzungsverhalten im Umgang mit Skype und dem Skype Translator wurde mit
einer deutschlandweit an Studierende gesendeten Online-Umfrage gearbeitet. In einer zweiteiligen,
naturalistisch orientierten Pilotstudie unter Einsatz des Eye-Trackers wurde das Kommunikationsver-
halten von Studierenden mit deutscher Muttersprache einerseits in maschinell vom Skype Translator
übersetzten Chats mit katalanischen Muttersprachler·innen und andererseits, als Referenz, in mono-
lingualen, rein deutschsprachigen Chats ohne Skype Translator untersucht. Bei den Teilnehmer·innen
an diesen Studien handelt es sich um zwei unabhängige Gruppen. Beide wurden ebenfalls mit
Fragebögen zum Nutzungsverhalten und zu den Eindrücken des Skype Translators erfasst.
Das sicher überraschendste Ergebnis der Studie ist, dass die Versuchspersonen einen substanziellen
Teil der Chatkommunikation auf der MÜ-Ausgabe in beiden beteiligten Sprachen verbringen. Die
Untersuchung der Sakkaden und Regressionen deutet auf einen sprunghaften Wechsel zwischen
Originalnachricht und MÜ hin. Der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit liegt dabei konsequent auf
den neusten Nachrichten. Es ist daher anzunehmen, dass die Versuchspersonen die MÜ-Ausgabe
aktiv in die Kommunikation miteinbeziehen und wesentliche Informationen zwischen Original und
MÜ abzugleichen versuchen.
12 Hintergrund
Seit ungefähr 2010 lassen sich innerhalb des ohnehin exponentiell wachsenden Forschungsgebietes
der digitalen Datenverarbeitung noch stärker herausragende Innovationen und Leistungszugewin-
ne beobachten. Dank mobiler Endgeräte sind Milliarden Menschen mit dem Internet verbunden
und können hierüber Informationen zu nahezu jedem Lebensbereich abrufen und beitragen. Nicht
erst innerhalb des o. g. genannten Zeitraums hat sich das Feld der Mensch-Maschine-Interaktion
ausgeweitet. Eine Unterform davon ist die sog. Usability, sprich: die Nutzerfreundlichkeit, bei der
ebenfalls die Interaktion von Mensch und Maschine in Hinblick auf den erfolgreichen Austausch von
Informationen hin untersucht wird. Bereits in den 1990er Jahren wurde mit dem Projekt Verbmobil (vgl.
Wahlster, 2000) der Versuch gestartet, maschinelle Übersetzung im Rahmen der computervermittelten
Kommunikation nutzbar zu machen.
Die Kommunikationssoftware Skype ist ebenfalls schon seit 2003 auf dem Markt. Weltweit bekannt
ist das Programm vor allem für die Möglichkeit, Echtzeit-Videochats zu führen. Auch wenn es
eine explizit beworbene Business-Version mit entsprechenden Sonderfunktionen gibt, wird Skype
hauptsächlich von Privatanwender·innen genutzt. Mit der Einführung des Skype Translators 2015 hat
Skype den Versuch gestartet, die Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg vollautomatisch und
in Echtzeit zu ermöglichen.
Aktuell werden mehr als 60 Sprachen im Textchat sowie 11 Sprachen für die Übersetzung von
gesprochener Sprache in Voice- und Videochats angeboten. Skype steht heutzutage jedoch in starker
Konkurrenz zu einer Vielzahl an weltweit agierenden Diensten, die ihren Nutzer·innen eine maschi-
nelle Übersetzungsausgabe zur Verfügung stellen (z. B. Facebook, Instagram). Zugleich jedoch ist
Skype nach bestem Wissensstand die derzeit einzige Chatanwendung, die maschinelle Übersetzung
für die Echtzeitkommunikation anbietet.
Die Funktion befindet sich allerdings im stetigen Wandel. Bereits die Version, die dieser Arbeit
zugrunde liegt, ist eine andere, als die aktuell für die Endnutzer·innen verfügbare. Zu Beginn der
Ausarbeitung war sie nur für Windows 7 und 10 verfügbar und auch dort nur in der jeweils aktuellsten
Version der Software. Gegenwärtig jedoch ist der Skype Translator bei Skype auf Windows, Linux und
MacOS sowie in der Smartphone-App enthalten. Skype for Business unterstützt den Skype Translator
bislang hingegen nicht.
Mit Blick auf das gesamte Leistungsportfolio von Skype lassen sich gerade in jüngster Zeit Dienst-
leister·innen beobachten, die die Videofunktion zur Fernberatung ihrer Kund·innen einsetzen (s. z. B.
Leipziger Wohnungsbaugesellschaft (LWB)). Gegenwärtig ist Skype neben dem ebenfalls aus den
USA stammenden Konkurrenten Zoom auch medial präsent. Im Zuge der durch die weltweite Corona-
Pandemie bestehenden Kontakt- und Reisebeschränkungen und dem entsprechend sich verändernden
Kommunikationsverhalten kommt es vor, dass ein offizielles Interview im Fernsehen per Videochat
durchgeführt wird. Skype ist dabei eine häufig genutzte Anwendung.
3 Methodik
Die Arbeit umfasst zwei Erhebungsteile: Als Hinführung und Orientierung wurde zunächst in einer
deutschlandweit an Studierende versendeten Online-Umfrage das generelle Nutzungsverhalten von
Skype sowie Kenntnisse im Umgang mit dem Skype Translator abgefragt.
Dann folgte eine Eye-Tracking-basierte Pilotstudie am Skype Translator, die das zentrale Element
dieser Arbeit darstellt. Diese Pilotstudie bestand ebenfalls aus zwei Teilen. Ein Teil sah die Textchat-
2Kommunikation von deutschen Muttersprachler·innen mit anderen deutschen Muttersprachler·innen
über Skype unter Einsatz des Eye-Trackers, aber ohne Verwendung des Skype Translators, vor. Mit die-
ser Studienvariante sollten okulometrische und linguistische, einsprachige Daten gesammelt werden,
die der zweiten Studienvariante als Referenzmaterial dienen. In diesem Studienteil kommunizierten
deutsche Muttersprachler·innen unter Einsatz des Eye-Trackers über Skype und mit aktiviertem
Skype Translator mit katalanischen Muttersprachler·innen in ihrer jeweiligen Muttersprache. Im
Rahmen der Analyse wurden folgende Indikatoren untersucht: Fixationsanzahl, Dauer der ersten
Fixation, Regressionen, Dauer des ersten Durchlaufs durch ein AOI, Gesamtverweildauer in einem
AOI, Pupillengröße, Sakkadenanzahl, -richtung, -amplitude sowie -dauer.
Die Bildschirmmitschnitte wurden mit Areas of Interest (AOI) entsprechend der präsentierten
Chatnachrichten (jeweils deutsches und katalanisches Original und MÜ) annotiert. Die Annotation
erfolgte dabei mit dynamischen AOI, die sich mit der Position der Nachrichten am Bildschirm
verschieben. Die Reihenfolge der Nachrichten ist dabei stets im Hinterkopf zu behalten: Auf die
original deutschsprachige Nachricht folgt die MÜ ins Katalanische. Die Reaktion des Gegenübers
erfolgt zunächst im Original auf Katalanisch, bevor die MÜ ins Deutsche eingeblendet wird. Die
Auswertung der Eye-Tracking-Daten erfolgte sowohl visuell, in absoluten Zahlen und statistisch auf
Grundlage von nicht-parametrischen Tests. Diese wurden mit der Statistiksoftware R durchgeführt.
Die Chatverläufe, die sich aus den beiden Studienteilen ergaben, sind als Textdateien vorhanden
und werden in der Arbeit nur angerissen, können jedoch für weiterführende Forschung korpusbasiert
aufbereitet und untersucht werden.
4 Thesen
4.1 In dem von der Maschinellen Übersetzung vermittelten Chat finden sich Elemente
der Nähe- und Distanzkommunikation.
Die Angaben der Versuchspersonen in den studienbegleitenden Fragebögen lassen den Schluss zu,
dass die von einem MÜ-System vermittelte Chatsituation eindeutig Elemente der Nähe- und Distanz-
kommunikation aufweist, wie sie Koch u. a. (2011) in ihrem Modell darstellen. Einerseits betonen die
Proband·innen die Unverfänglichkeit und Kurzlebigkeit der Chatsituation, was für einen gewissen
Grad an Vertrautheit steht. Andererseits unterstreichen Sie weiterhin die bestehende Anonymität
einer Textchat-Kommunikation, deren Mauern ein MÜ-System nicht niederreißen kann, sondern
eher noch verstärkt. Besonders wird dies in den Angaben der Proband·innen deutlich, die unsicher
im Umgang mit dem Gegenüber sind, zugleich jedoch nicht auf den zwischengeschalteten Skype
Translator eingehen. Trotz der bestehenden Möglichkeit, die Person zu biographischen Angaben zu
befragen, ist die Chatsituation also weiterhin als unpersönlich gekennzeichnet. Die Versuchspersonen
verweisen auf die nicht vorhandene Vertrautheit zwischen ihnen und dem Gegenüber, was teilweise
dem Skype Translator angelastet wird. Es sind zudem Grundzüge des Filter- und des Kanalreduktions-
modells wiedererkennbar, wie sie von Walther (1996), Trepte u. a. (2012) und Döring (2013) beschrieben
werden und nach denen computervermittelte Kommunikation mit dem Verlust von Informationen
und Aktionsmöglichkeiten einhergeht. Auch auf Grundlage der visualisierten Eye-Tracking-Daten
(Heatmap, Gaze Plots u. a.) wird ein weiteres Merkmal der computervermittelten Kommunikation
erkenntlich: Die Versuchspersonen richten ihre Aufmerksamkeit beinahe über die gesamte Dauer der
Chatsituation auf den Bereich des Bildschirms, an dem die neuen Nachrichten eingeblendet werden.
In diesem Zusammenhang ist auffällig, dass die Proband·innen zu keiner Zeit willentlich durch den
3Chatverlauf scrollten, um ältere Nachrichten außerhalb der Bildschirmanzeige zu betrachten. Davon
zeugt die Durchsicht der Bildschirmmitschnitte während der Datenaufbereitung. Der Fokus auf den
aktuellsten Nachrichten spiegelt somit eine möglichst synchrone Kommunikation wider.
4.2 Den Proband·innen gelingt es, ein Gespräch mit einer Person, die nicht dieselbe
Sprache wie sie spricht, zu führen und bei dem sie sich auf die Ausgabe des Skype
Translators verlassen müssen.
Die Mehrheit der Versuchspersonen gibt sich zufrieden mit dem Verlauf der computervermittelten
Kommunikation unter Beteiligung des Skype Translators. Mehrfach klingt in den Aussagen unter-
schwellig positive Überraschung über die maschinelle Übersetzung heraus, auch wenn zugleich
betont wird, dass die unterschiedlichen, bekannten Probleme der Maschinellen Übersetzung auch im
Rahmen des Gesprächs entdeckt wurden, durch Rückfragen jedoch gelöst werden konnten. So gibt die
Mehrheit der Proband·innen an, nicht das Gefühl zu haben, dass Ihnen im Rückblick Informationen
fehlen. Zugleich drücken die Proband·innen ihre Verwirrung über den erstmaligen Kontakt mit dem
Design des Skype Translators aus. Da alle Nachrichten, sowohl die maschinelle Übersetzung ins Deut-
sche und Katalanische als auch das katalanische Original, linksbündig, hingegen die ausgehenden
Nachrichten der Studienteilnehmer·innen rechtsbündig angezeigt werden, wirkt der Aufbau mit Blick
auf die Informationsverarbeitung zunächst unübersichtlich. Auch hierin lassen sich erneut Elemente
der o. g. Kommunikationsmodelle erkennen. Die Versuchspersonen reagieren auf die fehlenden Kom-
munikationselemente (z. B. para- und non-verbale) indem sie auf die verbleibenden ausweichen. In
diesem Fall gewinnt die Kommunikationssituation im Vergleich zu bestehenden Untersuchungen an
Textchats sogar ein Element hinzu: das der Maschinellen Übersetzung.
4.3 Die Versuchspersonen im Setting Katalanisch-Deutsch nutzen das Vorhandensein
der MÜ-Ausgabe für ein sprunghaftes Leseverhalten, wohingegen die Personen im
monolingualen Setting den Fokus der Aufmerksamkeit primär auf die Nachrichten
des Gegenübers legen.
Die Untersuchung der einzelnen Indikatoren ergibt, dass ein sprunghaftes, vergleichendes Leseverhal-
ten zwischen den einzelnen Nachrichtenarten besteht. Die Versuchspersonen orientieren sich offenbar
an allen Chatbeiträgen, auch wenn sie der anderen Sprache nicht mächtig sind. Weiterhin deuten die
einzelnen Indikatoren der Eye-Tracking-Studie darauf hin, dass die Versuchspersonen kognitiv stärker
gefordert sind und ihre Aufmerksamkeit dementsprechend breiter verteilen (müssen), um den vor-
handenen vier verschiedenen Nachrichtenarten gerecht zu werden. Darüber hinaus ist festzustellen,
dass die Proband·innen im Setting Katalanisch-Deutsch ihre Aufmerksamkeit auf alle zur Verfügung
stehenden Beitragsarten verteilen, was auch durch die Angaben im begleitenden Fragebogen gestützt
wird. Die Versuchspersonen gaben dort an, mit Interesse zwischen den Originalnachrichten sowie
der MÜ-Ausgabe zu wechseln. Die Versuchspersonen im einsprachigen Studienteil hingegen orien-
tieren sich schwerpunktmäßig an den Beiträgen des Gegenübers, sprich: den eingehenden, für sie
unbekannten Nachrichten. Davon zeugen beispielsweise die hohe Anzahl an Fixationen oder auch
an eingehenden Regressionen auf die entsprechenden Beiträge. Auch die zeitlichen Indikatoren der
Gesamtverweildauer und der Dauer des ersten Durchlaufs deuten in diese Richtung.
44.4 Der Informationsaustausch erfolgt auf Grundlage aller vier zur Verfügung stehen-
den Nachrichtenarten.
Die Eye-Mind-Hypothese von Carpenter (1988) geht von der Annahme aus, dass die Augen auf den
Bereich gerichtet sind, den das Gehirn gerade verarbeitet. Mit Rückgriff auf diese Hypothese deuten
die Eye-Tracking-Daten darauf hin, dass die Versuchspersonen für den Informationsautausch in der
Chatkommunikation alle zur Verfügung stehenden Nachrichtenarten, sprich: sowohl jeweils deutsch-
als auch katalanischsprachige Originalnachrichten und deren MÜ, verwenden. Die eigenen Nachrich-
ten der Versuchspersonen können sowohl in der Eingabemaske als auch innerhalb des Chat-Layouts
betrachtet werden. Dadurch fällt ihnen die geringste Beachtung zu, worauf alle untersuchten Indikato-
ren der Eye-Tracking-Studie hindeuten. Die eigenen Nachrichten weisen die geringste Fixationsanzahl
auf. Auch die Durchlaufdauer, Gesamtverweildauer sowie die Pupillengröße sind geringer als auf
den weiteren Nachrichtenkategorien, was für eine niedrigere kognitive Auslastung spricht. Die Unter-
suchung der Regressionen deutet allerdings auch darauf hin, dass ausgehend von den nachfolgenden
maschinell übersetzten Nachrichten ins Katalanische durchschnittlich mindestens ein Rücksprung in
die einzelnen deutschen Originalnachrichten ausgeführt wird. In die gleiche Richtung weist auch die
Differenz zwischen der selektiven regressiven Durchlaufdauer und der regressiven Durchlaufdauer.
Während erstere nur die Fixationsdauer ab erstmaligen Betreten bis zum Verlassen hin zu einem AOI
mit höherer Ordnungszahl bemisst, umfasst zweitere auch alle Rücksprünge zu vorausgehenden
AOI in dieser Zwischenzeit. So kommt es, dass die selektive regressive Durchlaufdauer im Falle der
maschinell übersetzten Nachrichten deutlich geringer ist als das Gesamtmaß. Daraus ist zu schließen,
dass die Versuchspersonen häufig und lange auf die der MÜ-Ausgabe vorausgehenden Originalnach-
richten zurückgreifen. Der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit lässt sich daher auf Grundlage der
absoluten Zahlen, der statistischen Untersuchung als auch der visuellen Inspektion auf dem Bereich
der eingehenden Nachrichten des Gegenübers sowie der MÜ verorten.
4.5 Die katalanischsprachigen Nachrichten, sowohl Original als auch MÜ, werden von
den deutschsprachigen Proband·innen vergleichend zur Informationssicherung in-
nerhalb des Chatverlaufs verwendet.
Eskenazi u. a. (vgl. 2017) und Inhoff u. a. (vgl. 2019) nutzen Regressionen zur Untersuchung der
Informationsverarbeitung während unterschiedlicher Leseaufgaben. In Anlehnung an diese Studien
bieten die Regressionen innerhalb der einzelnen Chatnachrichten verlässliche Anhaltspunkte zur
Analyse des Leseverhaltens in mehrsprachigen, maschinell übersetzten Chats. Der Stellenwert der
Regressionen für die Orientierung der Versuchspersonen wird besonders bei der Untersuchung der
katalanischsprachigen Nachrichten deutlich. Bei den eingehenden Regressionen sind es die original ka-
talanischsprachigen Nachrichten, in die – abgesehen von der Eingabemaske, die die Versuchspersonen
ohnehin zwingend zum Verfassen neuer Nachrichten betrachten müssen, – die meisten Regressionen
fallen. Im Falle der Regressionen aus einem AOI gehen von der deutschen und der katalanischen MÜ
die meisten Regressionen aus. Da diese beiden Nachrichtenkategorien in chronologischer Reihenfolge
(s. o.) jeweils nach den katalanischen bzw. deutschen Originalnachrichten eingeblendet werden, ist
es naheliegend, dass die Versuchspersonen die katalanischen Nachrichten in die Kommunikation
miteinbeziehen. Auch die Untersuchung der regressiven Durchlaufdauer im Vergleich mit der Ge-
samtverweildauer pro AOI lässt erkennen, dass die Versuchspersonen im mehrsprachigen Chat einen
substanziellen Teil der Zeit auf den Vergleich zwischen MÜ und Originalnachricht aufwenden. So ist
die absolute und durchschnittliche regressive Durchlaufdauer der MÜ sowohl wesentlich länger als
5die der Originalbeiträge als auch länger als die entsprechende Gesamtverweildauer pro AOI-Kategorie.
Es wird ersichtlich, dass die Versuchspersonen offenbar die maschinell übersetzten Nachrichten be-
trachten, dann jedoch zu den vorausgehenden Originalnachrichten zurückspringen, bevor sie dem
linearen Chatverlauf hin zu aktuellen Nachrichten folgen.
5 Desiderata und Weiterführung
Es wäre wünschenswert, die Studie im gleichen Design, allerdings mit Sprachen zu wiederholen, die
kein gemeinsames Schriftsystem teilen. Die Auswertung und Analyse der zur Verfügung stehenden
Daten zeigt, dass sich die Versuchspersonen während der Chatkommunikation zwar einerseits auf die
MÜ stützen, zugleich jedoch wenige schwerwiegende (Verständigungs-)Probleme auftreten. Dies mag
in großen Teilen sicherlich der Tatsache geschuldet sein, dass das Katalanische und das Deutsche ein
gemeinsames Schriftsystem teilen. Daher besteht das Forschungsinteresse, mehrsprachige, compu-
tervermittelte Kommunikation unter Beteiligung von Sprachen wie dem Russischen, Griechischen
oder Chinesischen zu untersuchen, um so eine größere Hürde zu schaffen, die die Versuchspersonen
bei der Informationsverarbeitung überwinden müssen. Weiterhin könnte durch die Studienwieder-
holung in diesem Format auch deutlicher untersucht werden, wie die Versuchsteilnehmer·innen die
Kommunikationssituation strukturieren, sprich: ob sie eher punktuell einzelne Bereiche der Chatbei-
träge vergleichen oder die gesamte MÜ-Ausgabe dem entsprechenden Original gegenüberstellen.
Außerdem erscheint es sinnvoll, die Zusammenstellung der Versuchspersonen zu verändern. Für
die vorliegende Arbeit wurde auf Studierende zurückgegriffen. Diese sind üblicherweise Anfang
20 und somit nativ mit vergleichbarer Technologie aufgewachsen. Außerdem weisen sie bereits ein
formell höheres Bildungsniveau auf, mit dem oft ohnehin Fremdsprachenkenntnisse verbunden sind.
Deshalb könnte eine Studienwiederholung mit Personen durchgeführt werden, die entweder nicht
aus dem akademischen Bereich stammen, oder nicht in der selben Altersgruppe zu verorten sind,
oder nicht das gleiche formelle Bildungsniveau aufweisen. Über die Variation dieser Parameter ließen
sich somit sicherlich auch weitere Erkenntnisse zu der Informationsverarbeitung in mehrsprachigen
Chats gewinnen.
Literatur
Carpenter, R. H. S. (1988). Movements of the eyes, 2nd rev. & enlarged ed. Movements of the eyes, 2nd rev.
& enlarged ed. Pages: 593. London, England: Pion Limited. 593 S. ISBN: 0-85086-109-8 (Hardcover).
Döring, Nicola (2013). „C 5 Modelle der Computervermittelten Kommunikation“. In: Grundlagen der
praktischen Information und Dokumentation. Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft
und-praxis. De Gruyter, Berlin, S. 425–430.
Eskenazi, Michael A. und Jocelyn R. Folk (Aug. 2017). „Regressions during reading: The cost depends
on the cause“. In: Psychonomic Bulletin & Review 24.4, S. 1211–1216. ISSN: 1069-9384, 1531-5320. DOI:
10.3758/s13423-016-1200-9. URL: http://link.springer.com/10.3758/s13423-0
16-1200-9 (besucht am 23. 02. 2021).
Inhoff, Albrecht W., Andrew Kim und Ralph Radach (9. Juli 2019). „Regressions during Reading“. In:
Vision 3.3, S. 35. ISSN: 2411-5150. DOI: 10.3390/vision3030035. URL: https://www.mdpi.c
om/2411-5150/3/3/35 (besucht am 23. 02. 2021).
Koch, Peter und Wulf Oesterreicher (2011). Gesprochene Sprache in der Romania: Französisch, Italienisch,
Spanisch. 2., aktualisierte und erw. Aufl. Romanistische Arbeitshefte 31. Berlin ; New York: De
Gruyter. 329 S. ISBN: 978-3-11-025261-3.
6Trepte, Sabine und Leonard Reinecke (2012). Medienpsychologie. OCLC: 863824312. Stuttgart: Kohlham-
mer Verlag. ISBN: 978-3-17-023544-1. URL: http://site.ebrary.com/id/10837240 (besucht
am 23. 02. 2021).
Wahlster, Wolfgang, Hrsg. (2000). Verbmobil: Foundations of Speech-to-Speech Translation. Bearb. von
S. Amarel u. a. Artificial Intelligence. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. ISBN: 978-3-
642-08730-1 978-3-662-04230-4. DOI: 10.1007/978-3-662-04230-4. URL: http://link.spr
inger.com/10.1007/978-3-662-04230-4 (besucht am 23. 02. 2021).
Walther, Joseph B (1996). „Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal, and hy-
perpersonal interaction“. In: Communication research 23.1. Publisher: Sage Publications London,
S. 3–43.
7Sie können auch lesen