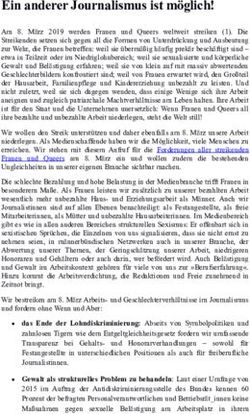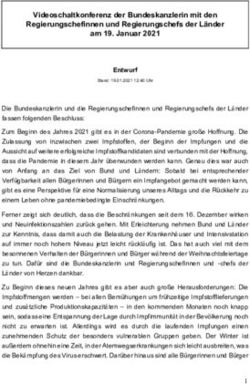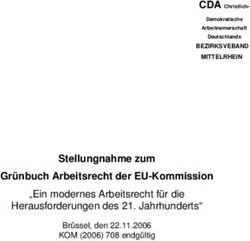Kälber im Überfluss - überflüssige Kälber? - Kälber als Nebenprodukt der Milchproduktion - Deutscher Tierschutzbund
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der kritische Agrarbericht 2022
Kälber im Überfluss – überflüssige Kälber?
Kälber als Nebenprodukt der Milchproduktion
von Frigga Wirths
Seit Jahren besteht ein Überangebot an Kälbern aus Milchviehbetrieben. Es führt zu einem derar-
tigen Preisverfall, dass Landwirte ihre Kälber nicht vermarkten können und sie teilweise an Vieh-
händler verschenken. Der Überschuss an Kälbern besteht sowohl bei Biobetrieben als auch bei kon-
ventionellen Milchviehhaltern. Eine unmittelbare Folge der fehlenden Nachfrage sind erhebliche
Tierschutzprobleme, die inzwischen auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Kälber von
Milchkühen sind offensichtlich Produkte, für die es derzeit keinen Markt gibt. Einzelne Landwirte
haben für ihre Betriebe Lösungen gefunden, aber damit werden die Ursachen der Überproduktion
nicht behoben. Dafür wären grundlegende Änderungen des Systems der Milcherzeugung und der
Rinderhaltung notwendig.
Die Erzeugerpreise für Milch in der konventionel auf einem Milchviehbetrieb geborenen Kälber wird
len Vermarktung schwanken hierzulande seit eini für die Bestandserneuerung als zukünftige Milchkuh
gen Jahren um die 30 Cent-Marke. Sie sind damit so aufgezogen. Die restlichen weiblichen und die männ
niedrig, dass vielen Landwirten eine kostendeckende lichen Tiere werden oft schon im Alter von zwei Wo
Milcherzeugung nicht möglich ist und die Intensi chen an Mastbetriebe verkauft.
vierung der Milcherzeugung voranschreitet. Es gibt Etwa 60 Prozent der Milchkühe gehören der Milch
in Deutschland nur noch 58.000 Milchviehbetriebe. rasse Holstein-Frisian an.3 Die Kälber dieser schlan
40 Prozent der Betriebe haben in den letzten zehn ken, für die Milcherzeugung gezüchteten Tiere sind
Jahren die Milchproduktion aufgegeben. Andere Be aufgrund ihrer Genetik nicht gut für die Mast geeig
triebe versuchen wettbewerbsfähig zu bleiben, indem net. Sie sind schwer zu vermarkten, die Viehhändler
sie ihre Herden aufstocken. 1995 lag die durchschnitt zahlen für diese Tiere teilweise nur noch Cent-Be
liche Herdengröße bei 27 Kühen, 2020 bei 68 Tie träge. Ihre Aufzucht kostet mehr als die Einnahmen
ren. Angestiegen ist auch die Milchleistung pro Kuh. durch ihren Verkauf, selbst dann, wenn die Kälber
Durchschnittlich liefert eine Milchkuh momentan gesund sind und keine Behandlung einer Krankheit
8.457 Liter Milch im Jahr.1 Auch Kühe mit einer der notwendig ist. Etwas günstiger ist die Situation für
artig hohen Milchleistung bringen jedes Jahr ein Kalb den Verkauf von Kälbern der Zweinutzungsrassen wie
auf die Welt, allerdings hat das für sie häufig gesund Fleckvieh oder der Kreuzungen mit Fleischrassen. Für
heitliche Beeinträchtigungen zur Folge. Kranke Tiere sie zahlen Mäster höhere Preise: 150 Euro und mehr
werden aus Kostengründen oft nicht mehr tierärzt für ein Kalb.
lich versorgt. Milchkühe haben nur noch eine kurze Abgesehen davon, dass es ein Überangebot an Käl
Lebenserwartung von durchschnittlich fünf Jahren.2 bern aus Milchviehbetrieben gibt, konkurrieren diese
Kälber auch noch mit denen aus der Mutterkuhhal
Nebenprodukt Kalb tung, die für die Fleischerzeugung gezüchtet wurden
und für die Mast entsprechend geeigneter sind. Im
Als Nebenprodukt der Milcherzeugung werden jähr Mai 2021 wurden in Deutschland 625.533 Mutterkühe
lich etwa vier Millionen Kälber auf Milchviehbetrie der Fleischrassen mit ihren Kälbern gehalten.4 Mut
ben geboren – zu viele Kälber, für die kein Markt be terkühe und deren Kälber leben meist im Herden
steht. Sie sind ohne wirtschaftlichen Wert. Das betrifft verband mit Weidehaltung und damit unter tierge
auch die Kälber von Biobetrieben. Circa ein Drittel der rechten Bedingungen.
276Tierschutz und Tierhaltung
Milchviehbetriebe versuchen, die Kosten, die durch sind also nicht ausreichend genährt und anfällig für
die Aufzucht der Holstein-Kälber entstehen, mög Krankheiten.
lichst gering zu halten, denn diese Ausgaben werden Neben der Fütterung ist auch die Wasserversor
durch den Verkaufserlös nicht gedeckt. Die niedrigen gung problematisch, vor allem in den Sommermona
Preise führen zu erheblichen Tierschutzproblemen, ten. Laut TierSchNutztV müssen Kälber, die älter als
die im Folgenden aufgezeigt werden. zwei Wochen sind, immer Zugang zu Wasser haben.
In zehn bis 29 Prozent der Betriebe, die an der PraeRi-
Mangelhafte Haltung Studie teilnahmen, war das nicht der Fall.
Üblicherweise werden Kuh und Kalb direkt nach
Die Haltung von Kälbern bis zum sechsten Lebensmo der Geburt oder wenige Tage später getrennt. Die Käl
nat ist in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ber werden häufig während der ersten Lebenswochen
(TierSchNutztV) geregelt.5 Außerdem gibt es für die in Einzelboxen untergebracht. Zu einer tiergerechten
Landwirte viele Empfehlungen zu Geburt und Käl Haltung gehört, dass Kälber früh Kontakt zu anderen
beraufzucht. In der Praxis werden Kälber jedoch oft Kälbern haben, denn Kontakt zu Artgenossen wirkt
weder nach den Anforderungen der Verordnung noch sich für die Ausbildung des arttypischen Verhaltens
der Guten fachlichen Praxis gehalten und gefüttert. positiv aus. Gemäß der TierSchNutztV darf man Käl
Infolgedessen ist die Mortalitätsrate hoch. ber jedoch bis zur achten Lebenswoche einzeln halten.
Kälber benötigen in den ersten Stunden ihres Le Erst danach ist die Haltung in Gruppen vorgeschrie
bens die spezielle Milch mit einem hohen Anteil an ben. Im Biobereich müssen die Kälber ab der zweiten
Abwehrstoffen, die eine Kuh direkt nach der Geburt Woche Kontakt zueinander haben.
eines Kalbes bildet (Biestmilch oder Kolostrum). In Häufig ist auch die Unterbringung der Kälber
der darauf folgenden, etwa zwölf Wochen dauernden ungenügend. Es fehlt an Einstreu und anstelle einer
Aufzuchtphase brauchen die jungen Tiere Milch oder Liegefläche mit sauberer und trockener Einstreu steht
Milchaustauscher aus Milchpulver. Danach sind sie den Tieren einen harter und feuchter Ruhebereich zur
alt genug, um sich ohne Milch, allein mit pflanzlicher Verfügung. In der PraeRi-Studie hatten die Kälber
Nahrung, zu ernähren. Die Versorgung der Kälber nur auf jedem zweiten Betrieb eine trockene Liegeflä
mit Milch ist teuer und arbeitsaufwendig. In großen che. Kälber auf Vollspaltenboden ohne Liegebereich
Betrieben ist die Betreuung tendenziell schlechter. Es zu halten, ist laut TierSchNutztV ab der dritten Le
fehlt an guten Arbeitskräften oder diese werden für benswoche zulässig. Besonders ältere Kälber werden
andere Tätigkeiten im Betrieb eingesetzt. Die Betreu oft so gehalten. Im Biobereich ist Vollspaltenboden
ung der Kälber wird vernachlässigt. Wird Kuhmilch nie erlaubt.
getränkt, reduziert sich die Menge der Milch, die an Auch die Witterungsbedingungen finden in der
die Molkerei verkauft werden kann. Milchaustauscher Praxis nicht immer genügend Berücksichtigung, so
wird in verschiedenen Qualitäten angeboten. Je hoch dass es im Winter zu kalt und im Sommer zu heiß ist.
wertiger – und nahrhafter für das Kalb – ein Produkt Das Tierschutzgesetz (TierSchG) erlaubt es immer
ist, desto teurer ist es. Als Folge erhalten die Kälber noch, Kälbern in den ersten sechs Lebenswochen die
in vielen Betrieben zu wenig Milch oder Milchaus Hornanlagen mit einem Brennstab zu entfernen. Zwi
tauscher oder der Milchaustauscher ist von geringer schen vier und neun Prozent der Betriebe führen das
Qualität. laut PraeRi-Studie ohne Gabe eines Schmerzmittels
Der PraeRi-Studie aus dem Jahr 2020 zufolge ist durch. Der Eingriff ist äußerst schmerzhaft, wenn er
die Versorgung der Kälber mit Milch nur in einem ohne Anästhesie und Schmerzmittelgabe vorgenom
Drittel der Betriebe ausreichend. In Bayern sogar nur men wird. Außerdem wird das Immunsystem da
in 20 Prozent der Betriebe, obwohl dort nur wenige durch geschwächt. Aus diesen Gründen ist das Ver
Holstein-Kühe gehalten werden und Fleckviehkälber öden der Hornanlage im Biobereich nur im Ausnah
einen höheren wirtschaftlichen Wert haben als die mefall erlaubt und muss dann unter Lokalanästhesie
Holsteins. Männliche Kälber werden schlechter ver und Schmerzmittelgabe durchgeführt werden.
sorgt als weibliche. Neben dem Mangel an täglicher
Versorgung mit Milch ist auch die Dauer der Fütte Hohe Verlustraten
rung mit Milch bis zum Absetzen in vielen konven
tionellen Betrieben kürzer als die empfohlenen zwölf All diese Mängel in der Aufzucht begünstigen Erkran
bis 13 Wochen.6 Kälber erhalten zu wenig Milch, ob kungen der Kälber und erhöhte Mortalitäten. Ein er
wohl Tiere, die in ihren ersten Lebenswochen viel an heblicher Teil der Kälber wird tot geboren, stirbt kurz
Gewicht zunehmen, erfahrungsgemäß gesünder sind, nach der Geburt oder in den ersten Wochen danach.
in ihrem späteren Leben als Kuh mehr Milch geben Die Rate an Totgeburten und Kälberverlusten zusam
und eine längere Nutzungsdauer haben.7 Viele Kälber men liegt zwischen zehn und 20 Prozent.8 Bei einer
277Der kritische Agrarbericht 2022
angenommenen Totgeburts - und Mortalitätsrate von die Kühe ihre Kälber im Stall auf dem Spaltenboden.
15 Prozent sind das etwa 600.000 Kälber im Jahr. Der hohe Keimgehalt dieser ungeeigneten Umgebung
Diese Sterblichkeitsraten entsprechen nicht einer begünstigt eine Erkrankung des Neugeborenen. Zu
unvermeidbaren, »normalen« Mortalität bei der Gat dem besteht das Risiko, dass das Kalb durch andere
tung Rind. Mutterkühe, die meistens ohne Hilfe durch Kühe oder die im Stall eingesetzten technischen Ge
den Menschen abkalben, haben eine geringere Kälber räte, zum Beispiel den Mistschieber, verletzt wird.
sterblichkeit als Milchkühe. In einer Studie lagen die Abgesehen davon sind die Geburtsüberwachung und
Kälberverluste bei Milchkühen bei 10,5 Prozent, bei Geburtshilfe in einer Abkalbebox wesentlich besser
Mutterkühen waren es 7,1 Prozent.9 durchzuführen als im Stall.
Die hohe Mortalitätsrate hat mehrere Ursachen.
Ein entscheidender Faktor, warum der Geburt und Kälbersterblichkeit während der Aufzuchtphase
der Aufzucht der Kälber oft wenig Aufmerksamkeit Kälber versterben nicht nur während und kurz nach
geschenkt wird, ist der geringe wirtschaftliche Wert der Geburt, sondern auch zu späteren Zeitpunkten.
der Kälber der Milchrassen. Da sie erst ab dem siebten Lebenstag in der HIT-
Datenbank angemeldet werden müssen, entsteht eine
Totgeburten Lücke in der Erfassung toter Tiere zwischen dem
Als Totgeburten werden in der HIT-Datenbank10 die dritten und siebten Tag. Diese Tiere werden oft nicht
jenigen Kälber erfasst, die tot geboren wurden oder gesondert aufgeführt, sondern zu den Totgeburten
in den ersten 48 Stunden nach der Geburt verstorben gerechnet. Damit werden die Zahlen zu den tatsäch
sind. Geburten finden häufig nachts statt und oft un lichen Verlusten in den ersten Lebenstagen der Tiere
terbleibt die Geburtshilfe – vor allem bei den Milch verfälscht. Im Gegensatz zu einer hohen Mortalitäts
viehrassen und in Großbetrieben. Es wird seltener Ge rate wird eine hohe Totgeburtenrate bei Kälbern ger
burtshilfe geleistet und Kaiserschnitte werden seltener ne von Betrieben und Beratern als schicksalshaft und
vorgenommen als früher.11 Schwergeburten werden unvermeidbar dargestellt, als sei der Landwirt dafür
somit spät erkannt. Sie können den Tod des Kalbes zur nicht verantwortlich.
Folge haben. Bei Färsen sind die Totgeburtenraten mit Ist die Versorgung und Unterbringung der Kälber
etwa zehn Prozent besonders hoch im Vergleich zu unzureichend, sind sie sehr krankheitsanfällig. Sie
der von Kühen, die bei etwa sechs Prozent liegt.12 Ne erkranken in den ersten Wochen besonders häufig
ben Komplikationen bei der Geburt selber ist oft auch an Durchfällen, Atemwegserkrankungen und Nabel
die mangelnde Versorgung der Kälber mit Kolostrum entzündungen. Die Erkrankungen werden zum Teil
(Biestmilch) ein Faktor, der zu Kälberverlusten führt. nicht oder zu spät bemerkt. Pflege und Behandlung
Im Gegensatz zu Mutterkühen, die im Herdenverband unterbleiben manchmal bewusst aus wirtschaftlichen
leben, fehlt besonders den Färsen der Milchviehbe Gründen. Kranke Kälber werden nicht behandelt und
triebe auch die Erfahrung, dass sie das Kalb ablecken nicht in einer Krankenbox untergebracht. So gehen
müssen und dass es am Euter trinken muss, um zu viele Erkrankungen tödlich aus. Ein großer Teil der
überleben. Erfolgt keine Hilfe durch den Menschen, Kälber stirbt durch mangelnde Fürsorge.
sterben diese Kälber. Unter den Kälbern, denen im Krankheitsfall eine
Nur in den ersten Stunden nach der Geburt ent Behandlung verweigert wurde, sind der PraeRi-Studie
hält die Biestmilch der Kühe die für das Neugebore zufolge männliche Kälber der Milchrassen besonders
ne lebenswichtigen Abwehrstoffe und nur während oft betroffen. Zwei bis sieben Prozent der Betriebe
dieses Zeitraums können diese die Darmschleimhaut räumten dort ein, die Bullenkälber weniger gut zu ver
passieren. Bereits nach sechs Stunden kann nur noch sorgen. Im Norden Deutschlands, wo hauptsächlich
die Hälfte der körpereigenen Eiweiße (Immunglobu Holstein- Kühe gehalten werden, bestätigten das sie
line), die für die Abwehr wichtig sind, absorbiert wer ben Prozent der Betriebe. In Bayern, mit einem hohen
den. Deswegen schreibt die TierSchNutztV vor, dass Anteil an Fleckviehkühen, gibt es der Studie nach kei
ein Kalb in den ersten vier Stunden nach der Geburt nen Unterschied in der Betreuung der Geschlechter;
Biestmilch erhalten muss. Wenn die Geburt unbeauf Fleckviehkälber haben einen höheren wirtschaftlichen
sichtigt erfolgt, nehmen etwa 50 Prozent der Kälber zu Wert als die Artgenossen der Milchrassen.
wenig Kolostrum auf.13 Eine Studie ergab zudem, dass
etwa ein Viertel der toten Kälber, die in einer Tier Exporte von Kälbern
körperbeseitigungsanlage untersucht wurden, kein
Kolostrum erhalten hatten.14 Männliche Kälber und die weiblichen, die nicht für
Mangelnde Geburtshygiene ist ein weiterer Faktor die Nachzucht benötigt werden, verlassen den Milch
für Totgeburten. Nicht alle Kälber werden in einem viehbetrieb sehr früh. Sie werden verkauft, um ge
sauberen Abkalbestall geboren. Vielfach bekommen mästet zu werden. Bereits ab einem Alter von 14 Ta
278Tierschutz und Tierhaltung
gen dürfen Kälber transportiert werden, auch über beispielsweise nach Ägypten. Die Transporte und die
lange Strecken. Voraussichtlich im Herbst 2022 soll Schlachtmethoden in Drittländern außerhalb Europas
das Mindestalter auf 28 Tage heraufgesetzt werden. sind mit extremen Tierschutzproblemen verbunden. –
680.000 Kälber im Jahr werden aus Deutschland ins Exporte sind jedenfalls keine Lösung, um den Über
Ausland verkauft, die meisten in die Niederlande, fluss an Kälbern in Deutschland abzubauen.
nach Spanien und Italien.15 Der Transport bedeutet
für die Kälber Angst und Stress. Sie können auf dem Welche Alternativen gibt es?
Transporter nicht mit Milch versorgt werden, sodass
sie an Hunger und Durst leiden. Hinzu kommen die Alle Kälber müssen von ihrer Geburt an mindestens
Belastungen durch Kälte oder Hitze, da die Transpor den Vorgaben der TierSchNutztV und den Empfeh
te laut Tierschutz-Transport-Verordnung (TierSch lungen der Guten fachlichen Praxis entsprechend
TrV)16 bei Temperaturen zwischen fünf und 30 Grad versorgt werden. Sie müssen ausreichend gefüttert
Celsius erlaubt sind. und getränkt werden, Kontakt zu Artgenossen und
Am Zielort werden sie unter Bedingungen gemäs eine eingestreute, trockene und saubere Liegefläche
tet, die in Deutschland nicht zulässig sind. Für die Käl haben und sie dürfen nicht unter Witterungseinflüs
bermast ist in Deutschland ein höherer Eisengehalt im sen leiden. Kranke Tiere müssen behandelt werden.
Futter vorgeschrieben, sodass die Tiere weniger anä Wirtschaftliche Gründe dürfen kein Argument dafür
misch sind und ihr Fleisch weniger weiß ist als das der sein, Tiere nicht angemessen zu versorgen. Das Ziel
im Ausland gemästeten Tiere. Ein Teil des im Ausland müssen geringe Totgeburten- und Mortalitätsraten
produzierten Kalbfleisches wird zurück nach Deutsch sein. Außerdem dürfen Kälber, die noch Milch be
land importiert. In jüngster Zeit ist in den Niederlan nötigen, nicht länger als acht Stunden transportiert
den die Nachfrage nach deutschen Kälbern, vor allem werden.
nach Kälbern der Milchrassen, zurückgegangen. Wenn die Kälberverluste niedrig wären und man
Kommt es zu Exportbeschränkungen, beispielsweise auf Exporte verzichtet, würde das zunächst das Pro
aufgrund von Bestimmungen, die die Verbreitung blem des Kälberüberschusses vergrößern. Deswegen
von Tierkrankheiten wie die Blauzungenkrankheit sind weitere Maßnahmen notwendig, die zeitgleich
verhindern sollen, verschärft sich das Überangebot in vorgenommen werden müssen und ineinander grei
Deutschland. fen. Sie werden zu einer grundsätzlichen Änderung
Ein Teil der Tiere wird gemästet, um dann zur der Milchproduktion führen.
Schlachtung in ein Drittland exportiert zu werden, Damit weniger Kälber geboren werden, muss die
Anzahl der Kühe reduziert werden. Abgesehen davon
ist zu hinterfragen, ob es ethisch zu rechtfertigen ist,
Folgerungen & Forderungen einerseits Mutterkühe (Fleischrassen) und anderer
seits Milchkühe zu züchten und zu halten. Anstelle
■ Die Kälberhaltung in Deutschland entspricht in von reinen Milchrassen sollten Zweinutzugsrassen
großen Teilen nicht den Vorgaben der Tierschutz gehalten werden. Diese Kälber sind als Masttiere
gesetzgebung. geeigneter und haben deswegen wirtschaftlich einen
■ Das hat primär wirtschaftliche Gründe, da es vor höheren Wert.
allem für Kälber von Milchkühen in Deutschland Seit einigen Jahren suchen immer mehr Milchbau
k einen Markt gibt. ern und -bäuerinnen nach Alternativen zum Verkauf
■ Anstelle reiner Milchrassen sollten daher verstärkt ihrer Kälber, vor allem der Bullenkälber. Meistens
Zweinutzungsrassen zum Einsatz kommen. sind es Kälber der Zweinutzungsrassen, die sie auf
■ Das Fleisch von Kälbern, die in Deutschland unter dem Betrieb aufziehen, mästen und regional vermark
tiergerechten Bedingungen geboren, gemästet und ten.17 Teilweise betreiben sie dabei kuhgebundene Käl
geschlachtet wurden, müsste als solches stärker beraufzucht. Dieses Verfahren, »Bruderkälber« aufzu
beworben und verkauft werden. ziehen und deren Fleisch zu vermarkten, ist noch eine
■ Importiertes Fleisch aus anderen EU-Ländern oder Nische, die ausgebaut werden sollte.
Südamerika sollte hierzulande nicht angeboten Manche Betriebe wählen eine andere Möglichkeit,
werden. die Anzahl der geborenen Kälber zu reduzieren. Sie
■ Landwirte und Landwirtinnen müssen für Milch und vergrößern die Abstände, in denen eine Kuh kalbt.
Fleisch faire Preise erhalten, sodass sie trotz der Die Kühe haben eine längere Zeitspanne, um sich
notwendigen Abstockung ihrer Herden ein gutes nach der Geburt zu erholen und das wirkt sich positiv
Einkommen haben. Hierbei spielt die Vermarktung auf ihre Gesundheit aus. Erheblichen Einfluss haben
eine zentrale Rolle. bei all dem entsprechende Maßnahmen vonseiten der
Vermarktung.
279Der kritische Agrarbericht 2022
Das Thema im Kritischen Agrarbericht 7 Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde (DHFZ) (Hrsg.):
X Stefanie Pöpken: Mehr Zeit zu zweit. Erfahrungen mit mutter- Positionspapier der DGFZ-Projektgruppe »Zukunft gesunde
und ammengebundener Kälberaufzucht. In: Der kritische Agrar- Milchkuh«: Zukunftsfähige Konzepte für die Zucht und Hal-
bericht 2020, S. 284–288. tung von Milchvieh im Sinne von Tierschutz, Ökologie und
X Franziska Hagen: Tiere als »Abfall«. Die unsichtbaren Folgen des Ökonomie. Bonn 2020 (www.dgfz-bonn.de/services/files/
Wachstumsstrebens in der Tierhaltung. In: Der kritische Agrar- stellungnahmen/Strategiepapier_Zukunft%20gesunde%20
bericht 2016, S. 246–250. Milchkuh_FINAL%202020%20%282%29.pdf).
X Irene Wiegand: Ein kurzes Leben. Kälberhaltung in Deutschland 8 DLG-Standard Milchviehhaltung. Prüf- und Durchführungs
und der EU – Aktuelle Probleme aus Sicht des Tierschutzes: bestimmungen. Frankfurt am Main 2020 (www.dlg-tierwohl.
In: Der kritische Agrarbericht 2014, S. 241–244. de/fileadmin/img/kriterien/Pruefbestimmungen_DLG-Stan-
dard_Milchviehhaltung.pdf).
9 Wilfried Hopp: Umfang und Ursachen der frühen Kälberverluste.
Wege zur Wahrheit. Vortrag auf dem Stendaler Symposium 2019.
Anmerkungen
10 Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere
1 Destatis: Milchleistung je Kuh in Deutschland in den Jahren 1900
(www.hi-tier.de).
bis 2020 (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153061/
11 L. Bittner: Berlin Brandenburgischer Rindertag, DVG Rinder
umfrage/durchschnittlicher-milchertrag-je-kuh-in-deutsch-
tagung, Vortrag 17. Oktober 2020.
land-seit-2000/). 12 Siehe unter anderem: Landeskontrollverband für Leistungs- und
2 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage [...] Druck- Qualitätsprüfung Sachsen-Anhalt (LKV): Jahresbericht 2019.
sache 19/9368: Abgangsraten und Todesfälle von Milchkühen Halle/Saale 2019.
in Deutschland vom 29. April 2019 (BT-Drucksache 19/9753) 13 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
(https://dserver.bundestag.de/btd/19/097/1909753.pdf). und Verbraucherschutz: Leitfaden für eine optimierte Kälber-
3 Thünen-Institut: Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland: aufzucht. Hannover 2015 (file:///Users/ms/Downloads/
Milchkühe. Braunschweig 2020 (www.thuenen.de/media/ Leitfaden_Kaelber_Online.pdf).
ti-themenfelder/Nutztierhaltung_und_Aquakultur/Haltungs- 14 Hopp (siehe Anm. 9).
verfahren_in_Deutschland/Milchviehhaltung/Steckbrief_ 15 AMI Markt Bilanz Vieh und Fleisch. Bonn 2021.
Milchkuehe_2020.pdf). 16 Verordnung zum Schutz von Tieren beim Transport und zur
4 Destatis: Tiere und tierische Erzeugung: Haltung mit Rindern Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates1)2) –
und Rinderbestand für November 2020 und Mai 2021 (www. Tierschutztransportverordnung (www.juris.de/jportal/portal/page/
destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirt- homerl.psml/screen/FcJWPDFScreen?doc.id=BJNR037500009).
schaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Tiere-Tierische-Erzeugung/ 17 Siehe hierzu auch den Beitrag von Kristina Schmalor in diesem
Tabellen/betriebe-rinder-bestand.html). Kritischen Agrarbericht (S. 171–177).
5 Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und
anderer zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere
bei ihrer Haltung (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung -
TierSchNutztV) (www.gesetze-im-internet.de/tierschnutztv/
BJNR275800001.html).
6 M. Hoedemaker, Tierärztliche Hochschule Hannover: Tierge- Frigga Wirths
sundheit, Hygiene und Biosicherheit in deutschen Milchkuh- Tierärztin und M. Sc. Nutztierwissenschaften,
betrieben – eine Prävalenzstudie (PraeRi). Abschlussbericht Fachreferentin beim
PraeRi (FKZ 2814H006-008), Hannover 2020 (https://ibei.tiho- Deutschen Tierschutzbund e.V.
hannover.de/praeri/uploads/report/Abschlussbericht_
komplett_2020_06_30_korr_2020_10_22.pdf). frigga.wirths@tierschutzakademie.de
280Sie können auch lesen