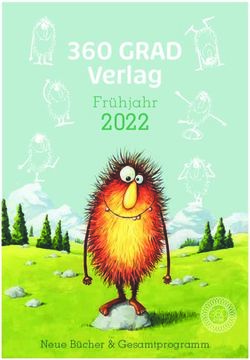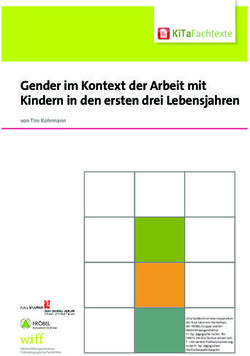Leitfaden zur Erstellung und zum Layout von Haus- und Abschlussarbeiten - Institut für ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Stand: 29.01.2020
Leitfaden
zur Erstellung und zum Layout
von Haus- und Abschlussarbeiten
Inhalt dings wird dann erwartet, dass Sie den Stoff aus einem eige-
1 Allgemeines .............................................................. 1 nen Blickwinkel präsentieren (›mit eigenen Worten wieder-
1.1 Bewertung ................................................................. 1 geben‹), dass Sie eigene Beispiele geben und dass Sie Pro
1.2 Zum Umfang der Arbeit ........................................... 1 und Contra diskutieren.
2 Die Teile der wissenschaftlichen Arbeit ................. 2 Das Thema, die genaue Ziel- oder Problemstellung und
3 Zur Textgestaltung ................................................... 2 die Vorgehensweise sind in der Einleitung darzulegen und
3.1 Formale Richtlinien .................................................. 2 zu begründen. Hier ist auch der Forschungsstand zu referie-
3.1.1 Seitenlayout und Absatzgestaltung ............... 2 ren. Eine sprachwissenschaftliche Arbeit in der Baltistik
3.1.2 Besonderheiten bei der Zeichenverwendung 2 sollte eine oder mehrere baltische Sprachen und deren Ana-
3.1.3 Der Zitatblock .................................................. 3 lyse zum Thema haben. Entsprechendes gilt für eine litera-
3.2 Zur argumentativen und sprachlichen Gestaltun .. 3 turwissenschaftliche Arbeit: Sie sollte Texte – vornehmlich
3.3 Zum Umgang mit Zitaten und Quellen .................. 4 literarische Texte – in einer oder mehreren baltischen
3.4 Verweise auf die von Ihnen verwendete Sekundärlite- Sprachen behandeln.
ratur ........................................................................... 5 Der Hauptteil der Arbeit befasst sich mit der eigentli-
4 Zum Literaturverzeichnis ......................................... 6 chen Untersuchung. Die Argumentation muss sachlich, fol-
4.1 Beispiele für die Angabe von Monographien ........ 6 gerichtig und nachvollziehbar sein (also diskursiv, nicht in-
4.2 Beispiele für die Angabe von Einzelwerken tuitiv). Die Methode muss dem Untersuchungsge-
mit deutlicher Herausgeberschaft … 7 genstand angemessen sein (»valide«). Methode,
4.3 Beispiele für die Angabe von Aufsätzen in Analyse und Darstellung bzw. Dokumentation
Sammelbänden und anderen edierten Wer- sind grundsätzlich ergebnisorientiert zu struktu-
ken … 7 rieren (also logisch, nicht chronologisch).
4.4 Beispiele für die Angabe von Aufsätzen in In einem Resümee werden die Ergebnisse der
Fachzeitschriften und anderen Periodika 7 Arbeit abschließend zusammengefasst und ggf. of-
4.5 Verweise auf Internetseiten und auf Werke, die aus- fengebliebene Fragestellungen für spätere Untersuchun-
schließlich digital zugänglich sind ......................... 7 gen aufgezeigt (»Desiderate«).
5 Plagiat ........................................................................ 8
6 Weiterführende Literatur ........................................ 8 1.1 Bewertung
7 Anhang: Die »Erklärung über die selbständige Abfas-
sung der Prüfungsarbeit« ......................................... 8 Die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten sind nicht
nur inhaltliche. In der Baltistik fließen in eine Bewertung
auch formale, orthografische (einschließlich der Interpunk-
1 Allgemeines tionsregeln), grammatische und stilistische Gesichtspunkte
mit ein. Die in diesem Leitfaden genannten Standards sind
Die Hausarbeit gibt Ihnen Gelegenheit, unter Anleitung dabei als conditio sine qua non zu verstehen.
zu üben, wie man einen wissenschaftlichen Text verfasst Eine Hausarbeit ist spätestens zu dem festgelegten Ter-
und gestaltet. Dazu gehören die Themenfindung, die theo- min einzureichen. Eine verspätete Abgabe hat zwangsläufig
retische Durchdringung des Themas und der gewählten die Note »nicht ausreichend« zur Folge. Die »Erklärung
Methode, eine Material- oder Zitatensammlung, deren Ana- über die selbständige Abfassung der Prüfungsarbeit«, auf
lyse und die schriftliche Darstellung von Theorie und Praxis. die im Anhang verwiesen wird, muss obligatorisch beilie-
Letzteres bedeutet zumeist die Darlegung Ihrer Ergebnisse gen.
und eine Dokumentation Ihres Vorgehens; auch die Inter-
pretation eines literarischen Textes umfasst in diesem Sinne 1.2 Zum Umfang der Arbeit
ein Vorgehen und Ergebnisse. Jede Hausarbeit dient au-
ßerdem als Vorbereitung auf Ihre Abschlussarbeit. Der geforderte Umfang der Arbeit ist der Prüfungsordnung
Eine wissenschaftliche Arbeit soll sich mit einem Thema zu entnehmen. Anhänge werden nicht in die Berechnung
auseinandersetzen, das in dieser Form vorher noch nicht be- des Umfangs einbezogen. Für den Fließtext werden fol-
arbeitet worden ist, oder sie soll ein bekanntes Thema so be- gende Formatierungen gewünscht, mit denen Sie gut 3.000
arbeiten, dass neue Erkenntnisse präsentiert werden kön- Anschläge auf eine Seite bringen:
nen. Ihre Hausarbeit darf etwas bescheidener daherkom- – Schriftgröße 12 pt, Zeilenabstand 15 pt. (Zum Ver-
men; sie kann sich auch stärker auf eine Darstellung be- gleich: Die Schriftgröße dieser Handreichung ist
kannter Methoden oder Ergebnisse konzentrieren. Aller- 10 pt, ihr Zeilenabstand 12,6 pt.)– Verwendung einer für den Schriftsatz geeigneten crosofts Programm »Word« wird der bedingte Trennstrich
Schrifttype. Geeignet sind Schriften mit Serifen, z. B. durch die Tastenkombination »Strg + - « aktiviert.
»Book Antiqua«, »Palatino Linotype«, »Minion Pro«, Es kommt der Lesbarkeit zugute, wenn man auf ungüns-
»Caslon«, »Garamond« oder »Century Schoolbook«. tige (obschon zulässige) Worttrennungen wie »Ei-che«,
Die Unicode-Zeichensätze der Schriften enthalten alle »Au-ge«, »zu-gig« verzichtet. Oft reicht es aus, Worttren-
baltischen (und viele andere) Sonderzeichen. nungen nur bei Stamm- oder Affixgrenzen durchzuführen
– Für den rechten, äußeren Korrekturrand ca. 40 mm (selbst wenn weitere zulässig sind); z. B. »Sprach-wissen-
Abstand des Textes vom Rand vorsehen; für die übri- schaft«, »Kunst-stoff-folie« oder »Morpho-logie«.
gen Seitenränder ca. 30 mm. Beschrieben wird nur die Werden verschiedene Schriftfonts innerhalb desselben
Vorderseite eines Blattes. Auf ihr steht die Seitenzahl Absatzes verwendet, kommt es in »Word« oft zu uneinheit-
rechts unten. lichen Zeilenabständen. Dies lässt sich beheben, indem
man bei der Angabe des Zeilenabstandes im Dialogfeld
»Absatz« die Option »genau« wählt. Im Textblock sollte der
2 Die Teile der wissenschaftlichen Arbeit Zeilenabstand genau 15 pt betragen.
Überschriften werden weder unterstrichen, noch kursiv
Die Teile sind: ausgezeichnet. Eine für sie zulässige Auszeichnung ist fett
oder halbfett. Hauptüberschriften können in einer etwas
Deckblatt mit Institutsnamen, dem Veranstaltungsse- größeren Schrift erscheinen. Vor und nach jeder Überschrift
mester, auf das sich Ihre Arbeit bezieht, dem Namen oder jedes Überschriftenblocks ist zu den Textblöcken hin
des Dozenten, der Bezeichnung der Veranstaltung eine Leerzeile einzufügen; vor einer Hauptüberschrift fin-
und ggf. des Moduls, dem vollständigen Titel Ihrer den sich zwei Leerzeilen.
Arbeit, Ihrem Namen, dem von Ihnen angestrebten Für die Kapiteleinteilung ist eine Dezimalgliederung
Abschluss, Ihrer Fächerkombination, Ihrer Matrikel- mit maximal drei Stellen üblich. Die erste Zeile des ersten
nummer und dem Abgabedatum der Arbeit; Absatzes nach Überschriften, Tabellen und Zitaten wird
Inhaltsverzeichnis; nicht eingerückt. Die ersten Zeilen von allen anderen Ab-
ggf. Verzeichnis der Abkürzungen und Siglen, wenn sätzen werden um 5 mm eingerückt.
die Arbeit individuelle oder fachfremde Abkürzungen Fußnoten stehen am Seitenende (unten auf der Seite).
enthält (fachübliche Abkürzungen wie Sie haben einen um 2 pt kleineren Schriftgrad als
»Sg.«, »Dat.« oder »Prät.« sowie allgemein- der Textblock – in Ihrer Arbeit also 10 pt mit Zei-
sprachliche Abkürzungen wie »vgl.«, »u.a.« lenabstand 12,5 pt. Mit jedem Hauptkapitel be-
oder »EU« können beim Leser vorausgesetzt ginnen die Fußnoten bei »1« zu zählen. Eine Fuß-
werden); note beginnt immer mit einem Großbuchstaben
Haupttext (s. Kapitel 3); und schließt immer mit einem Punkt. Die Absatz-
Literaturverzeichnis (s. Kapitel 4); formatierung einer Fußnote ist »hängend«. Für
ggf. Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen; Perfektionisten: Die Fußnotenzahl steht im Fußnotenfeld
ggf. Anhänge (alle Anhänge werden im Inhaltsver- nicht »hochgestellt«, sondern wie alle anderen Buchstaben
zeichnis aufgeführt); auf der Grundlinie. Und sie ist auch nicht kleiner, sondern
Ihre »Erklärung über die selbständige Abfassung der so groß wie der übrige Fußnotentext (10 pt).
Prüfungsarbeit« (s. Anhang). In die Fußnoten schreiben Sie Bemerkungen, die nicht
unmittelbar in den Text gehören, doch von thematischem
Interesse sind und Substanz bieten. Fußnoten sollten kein
3 Zur Textgestaltung Abladeplatz für unwesentliche Gedanken sein!
3.1 Formale Richtlinien
3.1.1 Seitenlayout und Absatzgestaltung 3.1.2 Besonderheiten bei der Zeichenverwendung
Verwenden Sie in Ihrem Fließtext, in Zitaten und in Fuß- Für phonetische Umschriften ist ausschließlich der API /
noten Blocksatz. In Überschriften, Tabellen und Aufzäh- IPA-Standard zu verwenden. Im Internet gibt es kostenlose
lungen wird linksbündig geschrieben. API / IPA-Zeichensätze (z. B. »Doulos SIL«); auch in vielen
Verwenden Sie die Möglichkeiten der Silbentrennung, Systemschriften sind inzwischen API / IPA-Zeichen enthal-
um unschön auseinandergezogene Wörter oder Sätze zu ten. Phonetische Umschriften stehen in […], Umschriften
vermeiden. Viele gewöhnliche Schreibprogramme besitzen von Phonemen und Morphen in /…/. Morpheme werden
eine automatische Silbentrennung, die Ihnen behilflich mithilfe von {…} bezeichnet, z. B. {Akk. Pl.}. Grapheme ste-
sein kann. Aber auch bei automatischer Worttrennung ist hen in . Graphe werden kursiv ausgezeichnet, weil sie
die Richtigkeit und Sinnhaftigkeit der Worttrennungen ei- Belege bzw. Zitatwörter sind; z. B. muss man Mažvydas’
genhändig zu überprüfen. Denn leider kann man sich nicht Szadei (16. Jh.) als interpretieren.
auf den Automatismus verlassen, insbesondere dann nicht, Beispiellaute, -silben, -wörter und -sätze werden im lau-
wenn mehrere Sprachen im selben Text nach ihren spezifi- fenden Text kursiv ausgezeichnet. Kursiv ausgezeichnet
schen Regeln getrennt werden sollen. Wenn Sie eigene werden insbesondere auch zitierte Belegstellen und -wör-
Worttrennungen durchführen, verwenden Sie am besten ter, wenn sie fremdsprachig sind.
den sog. bedingten Trennstrich, der ›in den Hintergrund Deutschsprachige Belegstellen und -wörter stehen in
verschwindet‹, sobald Sie eine Zeile nachträglich umbauen doppelten Anführungszeichen („…“); ebenso die deutsch-
und dabei der Grund für die Silbentrennung entfällt. In Mi- sprachigen Übersetzungen aus literarischen Werken. Indoppelten Anführungszeichen stehen auch Wörter und Be- Fachübliche Abkürzungen wirken im laufenden Text
zeichnungen im Kontext einer metasprachlichen Angabe, störend. Sie sind deshalb nur in Bezug auf einzelne Bei-
z. B. wenn von der Gattung »Bukolik«, dem sozialen Netz- spiele zu verwenden:
werk »Facebook« oder dem Personalpronomen »sie« die (4) Wie die folgenden Beispiele zeigen, unterscheiden das Lettische
Rede ist. (Beachten Sie: Wenn statt dessen von der Gattung und Litauische bei den dritten Personen nicht zwischen Singular und
der Bukolik oder dem Begriff des Kontextes die Rede ist, Plural. Das gilt für alle Tempora und Modi: z. B. 3. Pers. Präs. lett. brauc
(Sg./Plur.), lit. važiuoja (Sg./Plur.) ‘er/sie/es fährt, sie fahren’; 3. Pers.
entfallen die doppelten Anführungszeichen!)
Prät. lett. brauca (Sg./Plur.), lit. važiavo (Sg./Plur.) ‘er/sie/es fuhren,
Damit ergibt sich, dass in den Text integrierte fremd- sie fuhren’; und 3. Pers. Kond. lett. brauktu (Sg./Plur.), lit. važiuotų
sprachige Zitate zusammen mit ihrer deutschen Überset- (Sg./Plur.) ‘er/sie/es würde fahren, sie würden fahren’.
zung und der Angabe der Fundstelle wie folgt erscheinen: Oder: »Das Prädikat in Beispiel 14 steht in der 3. Pers.
(1) … und Egils antwortet ihm, »Pauls wird morgen herkommen« (Pauls Sg./Plur. Prät. Ind. Reflexiv.«
atnāks rīt; Sudrabiņš 1999: 271). Das war allerdings gelogen, weil …
Wenn Sie es nicht anders vermerken bzw. die Quelle bele- 3.1.3 Der Zitatblock
gen, wird davon ausgegangen, dass Sie die Übersetzung
der Stelle selbst angefertigt haben. Sinn des Zitatblockes ist es, Ihrem Leser kenntlich zu ma-
Das, was zu den Belegstellen und Übersetzungen gesagt chen, dass und wieviel Sie in direkter Rede zitieren. Denn
wurde, gilt sinngemäß auch für Buch-, Zeitschriften-, Zei- ist Ihr Zitat sehr ausführlich und enthält seinerseits weitere
tungs-, Artikel- und Aufsatztitel, wenn Sie diese in ganzer direkte Reden, kann der Leser schnell die Zusammenhänge
oder typischer Länge und Übersetzung erwähnen möchten. durcheinderbringen, wenn man nur mit üblichen Anfüh-
Z. B. schreiben Sie dann erstmalig ausführlicher: rungszeichen arbeiten würde. Freistehende Beispiele wer-
(2) Denn es findet sich diese Form mehrfach in Bretkes »Postille« (Pos-
den auch wie ein Zitatblock formatiert, aber sind natürlich
tilla, Tatai esti Trumpas ir Prastas Ischguldimas …, Königsberg 1591). weder ein Zitat, noch direkte Rede, sondern Ihre eigene
Leistung.
Im weiteren Verlauf Ihrer Arbeit können Sie sich dann in
Beispiel (4) (s. o.) zeigt, wie ein Zitatblock aussehen soll:
verschiedener kürzerer Weise auf diese Angabe beziehen;
Links um 5 mm eingerückt, rechts nicht eingerückt; Block-
s. hierzu die Regeln für die Angabe der verwendeten Lite-
satz; um 2 pt kleinere Schrift als der Haupttext (also 10 pt in
ratur in Kap. 3.3.
Ihrer Arbeit; Zeilenabstand dann 12,5 pt); und ein
In einfachen Anführungszeichen (‚…’) stehen
zusätzlicher Abstand zum ihn umgebenden Text
uneigentlicher Wortgebrauch (z. B. werden im
(2–3 mm davor und danach).
Deutschen auch andere Zeichensysteme als das
Einen Zitatblock soll man setzen, wenn der auf
der Schrift ‚gelesen‘) und Zitate innerhalb von Zi-
diese Weise zitierte Text mindestens drei Zeilen
taten, die bereits durch „…“ gekennzeichnet sind.
oder wenigsten knapp drei Zeilen füllt. Der Text
In einfachen, widerläufigen Anführungszeichen
des Zitatblocks ist zwar direkte Rede, er steht aber
(‘…’) stehen Bedeutungsangaben von Beispielen
nicht noch einmal selbst in Anführungszeichen.
oder einzelnen fremdsprachigen Begriffen. So erläutert
Treten im Zitatblock Anführungszeichen auf, dann so, wie
man z. B.:
sie in der zitierten Quelle verwendet wurden. Der auf den
(3) Und stavēt ‘stehen’ konjugiert man im Präsens. Zitatblock folgende Absatz des Haupttextes hat keinen
Für die Hervorhebung oder Betonung eines Wortes im Satz Erstzeileneinzug, es sei denn, Sie beginnen nach dem Zitat
verwendet man die einfache Unterstreichung. Freistehende tatsächlich einen neuen Absatz.
Beispiele werden durchnummeriert, aber nicht kursiv ge-
setzt; sie stehen in einem Zitatblocks (s. u.). 3.2 Zur argumentativen und sprachlichen Gestaltung
Tabellen haben Überschriften; sie werden durchnum-
meriert. Beschriftungen von Abbildungen, Grafiken und Die Vorgehensweise und die Argumentation sollen für den
Diagrammen stehen hingegen unter dem Bild; auch sie wer- Leser immer nachvollziehbar sein. Hierzu tragen eine
den durchnummeriert. Die Überschriften und Beschriftun- durchdachte Gliederung und eine folgerichtige Anordnung
gen werden dabei in normaler Schriftgröße (12 pt) ausge- der Argumente maßgeblich bei. Für das Thema irrelevante
führt. Der Titel einer Tabelle usw. ist ebenfalls ohne Aus- Beobachtungen gehören nicht in den Text. Folgerichtig zu
zeichnung ausgeführt (was man »recte« nennt); die Be- argumentieren, bedeutet zum Beispiel auf der Ebene des
zeichnung als Tabelle, Abbildung usw. gehört hingegen Ausdrucks, dass nach »erstens« auch tatsächlich ein »zwei-
zum Metatext und wird kursiv ausgezeichnet: z. B. »Tab. 5: tens« kommt; nach »einerseits« auch »andererseits« usw.
Prozentualer Anteil aller Femina auf -s am Gesamtwort- Häufig bietet es sich an, das untersuchte Material, Aus-
schatz«. Es folgt die entsprechende Tabelle. wertungstabellen u. ä. m. in einen Anhang zu stellen oder
Zu unterscheiden ist zwischen dem Gedankenstrich bei größerem Umfang in elektronischer Form Ihrer Arbeit
»–« (er vertritt Klammern, Kommata oder wird bei Zahlen- beizufügen. Grundsätzlich ist aber zu überlegen, ob der
angaben in der Bedeutung »bis« sowie als Minus-Zeichen Leser wirklich Ihr gesamtes Material, alle Belegstellen aus
eingesetzt) und dem Bindestrich » - « (er ist das Zeichen der einem literrischen Text, die Sie gefunden haben, oder alle
Worttrennung). Bindestriche, die fest an das nachfolgende Ihre Beobachtungen zwingend zur Kenntnis nehmen muss.
Zeichen gebunden sind (wie in »Graphemänderung oder Denn eine Darstellung von Beispielen im Text orientiert
-tilgung«), sollten im Textverarbeitungsprogramm mit dem sich immer an einer repräsentativen Auswahl und an der
sog. geschützten Trennstrich erzeugt werden, um unge- Frage, welche Beispiele das, was Sie zeigen möchten, auch
wollte Trennungen beim Zeilenumbruch zu verhindern. wirklich eindeutig und treffend belegen. Umgekehrt gilt:
Ihr Text sollte gerade nur so viele Beispiele besprechen, wiefür den jeweiligen Gesichtspunkt notwendig sind; unnötig gumentation ersetzen, sondern diese lediglich untermau-
lange Beispielreihen sind zu vermeiden. Um auch unnöti- ern. Sie sind deshalb auf keinen Fall isoliert zu platzieren,
ges Blättern zu vermeiden, sollten die besprochenen Bei- sondern in den Text einzubinden.
spiele möglichst im laufenden Text stehen; Beispiele in Entsprechendes gilt für Paraphrasen, bei denen jedoch
einem Anhang sind eher als Ergänzung zu verstehen. Ihre indirekte und zusammenfassende Wiedergabe der
Wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten sollen vor Rede des zitierten Autors und deren Einbindung in Ihren ei-
allem fachspezifische Fähigkeiten und Kenntnisse nach- genen Text stärker verwoben sind, als es beim ›selbständi-
weisen; vorausgesetzt wird jedoch auch eine angemessene geren‹ Zitat der Fall ist. Dabei ist unbedingt zu berücksich-
sprachliche Gestaltung. Üben Sie sich dadurch, dass Sie Ar- tigen, dass die indirekte Rede im Deutschen den Konjunktiv
tikel und Beiträge aus Fachzeitschriften nicht nur aus in- verlangt! Paraphrasieren Sie also in Ihrer Arbeit die ge-
haltlichem Interesse rezipieren, sondern auch auf die For- druckten Gedanken oder Erkenntnisse eines Dritten, geht
mulierungen und die Phraseologie der Autoren achten! der Leser davon aus, dass alles, was nicht im Konjunktiv der
Die sichere Handhabung der Interpunktionsregeln wird Redewiedergabe steht, Ihre eigenen Aussagen zum Thema
vorausgesetzt. Für das Leseverständnis sind Kommata oft- sind. Und das geschieht unabhängig davon, dass Sie viel-
mals auch an den Stellen wünschenswert, an denen das amt- leicht am Anfang Ihres Absatzes explizit auf Ihre Paraphrase
liche Regelwerk nur ihre fakultative Setzung vorsieht – ins- hingewiesen haben. (Was Sie trotzdem tun sollten!)
besondere also bei erweiterten Infinitiven und Partizipien. Der Konjunktiv, den die indirekte Rede verlangt, bewirkt
Bei vielen sprachlichen Zweifelsfällen hilft der DUDEN, Bd. eine gewisse Distanz des Verfassers – Ihre Distanz – zum
9: Richtiges und gutes Deutsch weiter. Widergegebenen. Deshalb ist eine Quelle zu paraphrasie-
Guter wissenschaftlicher Stil zeichnet sich durch Klar- ren dann günstig, wenn Sie die Gedanken des zitierten Wer-
heit und Genauigkeit aus. Die korrekte Anwendung der kes im weiteren Verlauf Ihrer Arbeit kritisch aufgreifen
fachüblichen Termini wird vorausgesetzt. Zu vermeiden möchten. Ein direktes Zitat ist günstiger, wenn Sie mit dem
sind zitierten Autor einer Meinung sind oder einfach zum ›Be-
– subjektive Werturteile (»ich finde«, »meiner Meinung weis‹ einen Textbeleg anbringen möchten.
nach«), Generell gilt für direkte Zitate, dass alles, was Sie am
– lange und verschachtelte Sätze, Zitat verändern (weglassen, hinzufügen, verbessern, kom-
– unangemessener Fremdwortgebrauch, mentieren) und also von Ihnen selbst zu verantworten ist,
– Redundanzen und gehäufte Querverweise durch die Verwendung von eckigen Klammern
(»wie ich in Kap. 1.2.3.4 schon erläutert kenntlich gemacht werden muss. Also setzen Sie
habe«), z. B. dort, wo Sie ein Stück des zitierten Textes
– umgangssprachliche, saloppe Ausdrücke ausgelassen haben, weil es nichts zur Sache tut,
(»nichtsdestotrotz«, »es ist ja allgemein be- nicht nur die erforderliche Ellipsis (›drei Punk-
kannt, dass«, »total«), te‹), sondern setzten diese auch noch zwischen
– vage Formulierungen (»dies könnte daran- eckige Klammern: »[…]«. Auslassungszeichen
liegen, dass«, »dies scheint«, »es sieht so aus, als ob«) werden jedoch nicht am Anfang und am Ende eines Zitates
und gesetzt, denn es ist klar, dass ein Zitat immer ein Ausschnitt
– Floskeln (»es würde den Rahmen dieser Arbeit spren- aus etwas ist. Das gilt für auch für den Zitatblock.
gen, wenn«). Wissenschaftliche Texte unterliegen einer Redlichkeits-
Die intensive Auseinandersetzung mit der sprachlichen Ge- forderung: Sämtliche, anderen Quellen und Werken ent-
staltung der Arbeit macht vielfach auf argumentative Un- nommenen Thesen, Definitionen, Formulierungen, Vorge-
klarheiten aufmerksam und führt damit auch zu einer in- hensweisen, Fakten und Ergebnisse sind durch Verweise
haltlichen Verbesserung. kenntlich zu machen. Verstöße werden als Täuschungsver-
such gewertet, selbst wenn die sonstigen Teile der Arbeit
3.3 Zum Umgang mit Zitaten und Quellen richtig sind. Eine Textübernahme liegt auch dann noch vor,
wenn einzelne Wörter des übernommenen Materials aus-
Wissenschaftliche Arbeiten stehen nicht für sich allein, son- getauscht wurden oder ein Text aus einer anderen Sprache
dern beziehen sich auf bereits vorliegende Forschungsbei- ins Deutsche übertragen wurde.
träge. Der Bezug geschieht entweder wortwörtlich in Form Hinter dieser strikten Forderung steht kein Selbstzweck
von Zitaten (also per direkter Rede), als paraphrasierende bezüglich der Prüfungssituation, für die Sie Ihre Arbeit
Inhaltswiedergabe (also per indirekter Rede) oder durch schreiben. Vielmehr ist es die Grundauffassung der Wissen-
vertrauensvolle Übernahme von Erkenntnissen oder Fak- schaften, dass man alle, aber auch wirklich alle Quellen und
ten. Letzteres bleibt sprachlich unmarkiert; was Sie für rich- Grundlagen seiner Überlegungen und Schlussfolgerungen
tig erachten und übernehmen, erscheint in Ihrer Arbeit als offenlegt, damit jeder andere Leser Ihre Forschung im De-
Argument, Tatsachenbericht oder Darstellung des Fakti- tail nachvollziehen, in allen Einzelheiten überprüfen und
schen. Und dass dann etwas nicht (nur) von Ihnen stammt, ggf. mit dem gleichem Ergebnis wiederholen kann. Diese
erhellt Ihr Verweis auf die entsprechende Sekundärliteratur, sog. Reliabilität ist neben Objektivität und Validität einer
der deshalb an einer solchen Stelle notwendig vorgenom- der drei Grundpfeiler rationaler Wissenschaft. Texte, die
men werden muss. diese drei Kriterien nicht erfüllen, müssen als obskur abge-
Zitate sind direkte Rede und deshalb orthographisch lehnt werden.
auch so zu behandeln (Anführungsstriche!); die Möglich- Von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen sind all-
keit, ein längeres Zitat als Textblock zu gestalten, wurde in gemein bekannte Informationen, gängige Methoden, die
Kapitel 3.1.3 beschrieben. Zitate sollen nicht die eigene Ar- nicht geistiges Eigentum eines Dritten sind, oder ›enzyklo-pädisches‹ Wissen. So muss z. B. für semantische Angaben noten sollen für subsidären Informationen vorbehalten blei-
wie lett. nams ‘Haus’, für die Angabe, dass p ein Plosiv sei, ben. Schreiben Sie also z. B.:
für den Fakt, dass Lentvaris bei Trakai in Litauen liege, oder (5) Wie von Vanags (1999b: 45 f.) überzeugend ausgeführt wurde, be-
für Gliederungen wie »1. Einleitung, 1.1. Zum Forschungs- ruhen die älteren Darstellungen von Schmidt/Böttcher (1977: passim),
stand, 1.2. Untersuchungsziele und -methoden« keine Hansen (1978: 55–60, 65 ff.), Schiffbauer (1923) und Karlsson (2007:
88–98) auf falschen Grundannahmen.
Quelle angegeben werden.
Die zitierten Quellen sollten in Bezug auf die Argumen- In der Regel werden nur die Familiennamen der Autoren
tation Ihrer Arbeit angemessen und zuverlässig sein. Neben verwendet. Die Angabe »Müller (1999: 45 f.)« bedeutet
der einschlägigen Sekundär- und Fachliteratur zum jeweili- dabei, dass Sie sich auf die Seiten 45 und 46 eines Werkes
gen Thema bieten sich gängige Nachschlagewerke und Le- beziehen, dass von dem Autor / von der Autorin Müller im
xika renommierter Verlage an. Internet-Lexika wie »Wiki- Jahre 1999 erschienen ist. Ungenaue Angaben wie »Seite
pedia« sind hingegen als Quellen für wissenschaftliche Ar- 65 ff.« sind dabei nach Möglichkeit zu vermeiden. Man be-
beiten nur ausnahmsweise geeignet. Haus-, Bachelor- und merke auch den Punkt nach »f« in der Angabe »Müller
Masterarbeiten (auch veröffentlichte) sind als Quelle eben- (1999: 45 f.)«! Bei mehrbändigen Werken ist die Nummer
falls ungeeignet. des Bandes mit anzugeben; z.B. »Petersen (1987: II, 234)«.
Formale Richtlinien für das Zitieren sind: Um eine Verwechselung mit den Seitenzahlen auszuschlie-
– Zitate sollen dem Original entnommen sein. Bei Pri- ßen, erfolgt die Bandzählung in der Regel durch römische
märliteratur ist die jeweils zuverlässigste Ausgabe zu Ziffern (auch wenn das im Original anders ist). Die Verweise
benutzen, wenn keine Referenzausgabe vorliegt. Alte auf Ihre Sekundärliteratur und Quellen sollten nicht gedop-
Schriften dürfen stillschweigend modernisiert wer- pelt werden. Richtig ist:
den: Z. B. wird »laẜẜám Stendera Siꞥꞡes« als lasām Sten- (6) Müller (2003: 11) weist darauf hin, dass … kam.
dera Ziņģes zitiert.
– Zitate sollen genau, d. h. buchstabentreu sein (also Falsch wäre: »Müller (2003) weist darauf hin, dass … kam
ggf. auch einer alten Rechtschreibung folgen). Zitate (Müller 2003: 11)«.
sind stets wörtlich zu übernehmen. Zitate sollen nicht Satzzeichen dienen u. a. dazu, Zusammengehörendes
entstellend und aus dem Zusammenhang gerissen sichtbar zu machen. Wird am Ende eines Satzes eine Litera-
sein. turangabe oder sonstige Bemerkung in Klammern einge-
– Zitate sollen zweckdienlich und in die Argu- fügt, steht das Satzzeichen nach der Klammer, da
mentation eingebettet sein. die Inhalte der Klammer zum vorhergehenden,
– Kurze Zitate im laufenden Text stehen in nicht zum folgenden Satz gehören. Endet ein
doppelten Anführungszeichen: „…“. Zitat mit einem eigenen Satzzeichen, wird dieses
– Enthält der zitierte Text selbst ein Zitat, wer- in der Regel weggelassen, wenn direkt danach
den die doppelten Anführungszeichen die- Ihre Quellenangabe folgt. Nach dieser steht dann
ses Zitats durch einfache (‚…‘) ersetzt. Um das Satzzeichen, das Ihr Text verlangt; z. B.:
ein direktes Nacheinander von doppelten und einfa- (7) Weshalb „eine Lexemspaltung auch im Wörterbuch ausgewiesen
chen Anführungsstrichen zu vermeiden, zitiert man – sein sollte“ (Müller 1999: 45), ist eine Frage, die …
wenn möglich – nicht nur das zitierte Zitat, sondern Bei Verweisen, die Teil eines Satzes oder Kommentars in
auch etwas von seinem Kontext. Klammern sind, wird keine erneute Klammer um den bi-
– Bei Auszeichnungen wie Fett- oder Kursivdruck ist bliographischen Hinweis selbst gesetzt:
anzugeben, dass diese von Ihnen selbst hinzugefügt
(8) Außer bei den Plosiven (so schon Müller 1997a: 45), die wie …
wurden, falls das zutrifft: Z. B. »dient es dem Abbau
morphologischer Markiertheit [Unterstreichung von Wird an einer Stelle auf mehrere Arbeiten des gleichen Au-
mir]«; oder es »betrifft alle Substantive, aber nicht die tor(enkollektiv)s verwiesen, werden die Jahreszahlen (ggf.
Verben [Kursivsetzung St.K.]«. Auf den eigenen Na- mit den Seitenangaben) ohne Wiederholung der Namen
men wird durch Pronomen oder Initialen, aber nicht mit Semikolon abgetrennt:
durch den vollen Namen verwiesen. (9) Wie bei Müller/Hansen (1977/79; 2005; 2017), Petersen (1999) und
– Enthält das Zitat einen Fehler, kann man den Um- schon Werner (1887a: 7–9; 1887b; 1890: 55–60, 376–413) so sollen
stand, dass man diesen gesehen und dass man also auch hier …
nicht falsch abgeschrieben hat, kenntlich machen, in- Wird jedoch außerhalb des eigentlichen Satzes auf die Ar-
dem man nach dem Fehler »[sic!]« schreibt. beiten mehrerer Autoren(kollektive) verwiesen, werden
auch die Namen der Autoren(kollektive) durch Semikolon
3.4 Verweise auf die von Ihnen verwendete Sekundärlite- voneinander getrennt:
ratur
(10) Wie bei den altpreußischen Verben (vgl. hierzu die ausführlichen
Darstellungen von Vanagas 1998; 2005: 34–56; und Kessler/Moss-
Verweise auf die von Ihnen verwendete Sekundärliteratur man 2016: 45 f.; 2021: 145–156) so sind auch …
oder auf Quellen geben Sie bitte im laufenden Text mithilfe
Innerhalb eines Absatzes können wiederholte Referenzen
des sog. Autor-Jahr-Systems an. Die vollständigen biblio-
auf dasselbe Werk durch »op. cit.« und auf dieselbe Stelle
graphischen Angaben und somit die Aufschlüsselung Ihrer
durch »loc. cit.« erzeugt werden. Bei Nachschlagewerken
Verweis-Siglen stehen im Literaturverzeichnis, das sich am
mit alphabetisch geordneten Einträgen kann die Abkürzung
Ende Ihrer Arbeit befindet. Setzen Sie also Ihre Literatur-
»s. v.« (für lat. sub voce ‘unter dem Ausdruck, Lemma’) bzw.
angaben und Quellenbezüge nicht in Fußnoten; die Fuß-
»s. vv.« (für sub vocibus ‘unter den Lemmata’) verwendet
werden:(11) So erklärt Subačius (1976: s. v. džiaugtis) … werden bei der Sortierreihenfolge ignoriert. Die Kyrillica
Formulierungen mit »vgl.« werden nur verwendet, wenn kann beibehalten werden; verwenden Sie für den Autorna-
es wirklich etwas zu vergleichen gibt: men jedoch eine lateinische Sigle. Dabei muss nach der wis-
senschaftlichen Transliteration (d. i. ISO 9) transliteriert
(12) Anders als die lettische Forschung, die den Debitiv als Partizip de-
finiert (vgl. Vanagas 2012: 31–35), folge ich hier der Definition von
werden. Die Duden-Transliteration ist nicht zulässig.
Shiftingh/Grammarman (1996: 12–17), weil … Die bibliografischen Angaben sollen vollständig und
genau sein. Vor allem bei Aufsätzen aus Sammelbänden
Man würde dann erwarten, dass sich bei »Vanagas 2012: oder edierten Werken ist Acht zu geben: Angaben nur zum
31–35« eine Darstellung davon finden lässt, wie die letti- Band als Ganzem sind hier nicht ausreichend. Autoren- und
sche Forschung den Debitiv bisher oder üblicherweise de- Herausgeberkollektive mit mehr als drei Personen werden
finiert hat, und, dass man an dieser Darstellung von Vanags zu »Erster Name et al.« abgekürzt. Bei Editoren/Herausge-
erkennt, dass die Definitionen immer auf die Kategorie des bern wird außerdem der Zusatz »Hrsg.« benutzt. Nach
Partizips hinauslaufen, wie vom Verfasser des Satzes in Bei- Möglichkeit ist die aktuellste Auflage/Ausgabe zu benut-
spiel (12) behauptet wird. Vanagas’ Darstellung selbst muss zen – es sei denn, es kommt auf den Inhalt einer älteren
dabei vom Verfasser nicht näher oder ausführlicher wie- Auflage/Ausgabe an. Im Literaturverzeichnis werden die
dergegeben; noch enthält Vanagas’ Darstellung die ›resü- Auflagennummer obligatorisch durch eine hochgestellte
mierte‹ Aussage, dass die lettische Forschung den Debitiv Zahl angegeben; das Jahr der Erstauflage sollte vorausge-
durchweg als Partizip ansehe. Das Resümee ist Ihre Leis- hend erwähnt werden. Die Jahreszahl der zitierten/benutz-
tung. Im Unterschied zu diesen Resümees sind Paraphrasen ten Auflage ist aber die, die zusammen mit dem Autorna-
eine indirekte Redewiedergabe, wenn auch eine zusam- men die Sigle bildet. Bei gleichem Erscheinungsjahr meh-
menfassende, und erfordern deshalb kein »vgl.« in der rerer Titel desselben Autors/Herausgebers ist mittels »a«,
Quellenangabe. »b«, »c« usw. zu unterscheiden: etwa »Müller (1999c)«.
Buch- und Zeitschriftentitel (und nur diese) werden kursiv
gesetzt. Es empfielt sich zudem, den Nachnamen des Autors
4 Zum Literaturverzeichnis / der Autoren durch Kapitälchen oder halbfett auszuzeich-
nen. Ältere Werke enthalten nicht immer alle bibliogra-
Das Literaturverzeichnis enthält sämtliche für Ihre Arbeit phisch notwendigen Angaben. Fehlende Informationen
verwendeten Werke – aber auch nur diese! zum Erscheinungsjahr sind durch »o. J.« zu kenn-
Werke, die Sie zwar nicht dirkt zitieren, aber die zeichnen; zum Erscheinungsort durch »o. O.«. Bei
Sie bei der Abfassung Ihrer Arbeit verwendete Wörterbüchern bietet sich oftmals eine abkür-
haben (z. B. Spezialbibliographien oder Karten- zende Sigle an: etwa »LKŽ 1949/2004« für den
material), sollten in einem gesonderten Verzeich- Lietuvių kalbos žodynas. In solchen Fällen nimmt
nis aufgeführt werden. Das Literaturverzeichnis die Abkürzung die alphabetische Stelle im Litera-
einer Haus-, Bachelor- oder Masterarbeit kann turverzeichnis ein.
man deshalb auch treffend mit »Verwendete Li- Bestimmte formale Aspekte eines Literaturverzeichnis-
teratur« übertiteln. »Bibliographie« heißt ein Verzeichnis ses sind Glaubensfragen – das bedeutet für Sie, Sie können
nur dann, wenn es Vollständigkeit hinsichtlich der zutref- es in Details auch anders machen (z. B. häufiger Kommata
fenden Forschungsliteratur anstrebt. verwenden anstelle von Punkten oder das »In:« weglassen,
Das Literaturverzeichnis besteht in der Regel aus zwei da das selbständige Hauptwerk eines Eintrags immer kursiv
Teilen: aus der Primärliteratur und aus der Sekundärlitera- ausgezeichnet ist). Wichtig ist aber, dass Sie konsequent
tur. Mit »Primärliteratur« sind die Quellen für das Belegma- vorgehen und ›Ihr System‹ nicht plötzlich wechseln.
terial gemeint, mit »Sekundärliteratur« die übrige verwen-
dete Literatur. Darüber hinaus ist es oft zweckmäßig, die 4.1 Beispiele für die Angabe von Monographien
beiden Teile des Literaturverzeichnisses wiederum in ge-
druckte Werke (z. B. Bücher, die in Bibliotheken stehen), di- A, John M. / et al. (1987): Principles of Dependency
gitale Publikationen (z. B. Aufsätze aus Fachzeitschriften, Phonology. Cambridge/USA–New York.
die zwar digital, aber ›in unabänderlicher Gestalt‹ vertrie- F, Gilles / T, Mark (2003): The Way We
ben werden) und Links auf Homepages (die u. U. am nächs- Think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden
ten Tag anders aussehen) zu unterteilen. Allerdings ist Complexities. New York 2002; Tb.
diese Gliederung nicht zwingend; oft gibt es gute Gründe, I, Sandra (22010): Sprachliche Innovation im
von ihr abzuweichen. Ist das Literaturverzeichnis über- politischen Diskurs. Frankfurt/M. 2006; erg.
schaubar (≤ 1 Seite), ist eine Gliederung ebenfalls unnötig. J, Nedas (2015): Krizės konceptas Lietuvių ir Vo-
Die bibliographischen Einträge haben die Absatzforma- kiečių kalbose = The Crisis Concept in Lithuanian and
tierung »hängend«. Wie weit dabei die obliquen Zeilen German. Šiauliai. (Summary of PhD thesis.)
unter der ersten eingerückt werden, ist Geschmackssache. L, Heinrich (101990): Elemente der literarischen
Ein Mindestmaß ist 5 mm. Zwischen den einzelnen biblio- Rhetorik. Eine Einführung für Studierende der klassi-
graphischen Einträgen wird weder eine Leerzeile, noch ein schen, romanischen, englischen und deutschen Philolo-
Extraabstand eingefügt. Die bibliographischen Einträge gie. Ismaning.
werden weder nummeriert noch mit Aufzählungszeichen L (1996). — Юрий М. Лотман: Внутри мыслящих
versehen. Vielmehr ist das Literaturverzeichnis alphabe- миров. Человек – Текст – Семиосфера – История.
tisch nach den Familiennamen der Autoren oder Herausge- Москва.
ber geordnet. Sonderzeichen bzw. diakritische ZeichenM (1923/46). — Karl Mühlenbach / J. Endzelin / E. Hau- —,— (2016): Von Wurzeln, Sprachzweigen und Stammbäu-
senberg: Karl Mühlenbachs Lettisch-deutsches Wörter- men. Konventionelle Metaphern in der Fachtermino-
buch. Redigiert, ergänzt und fortgesetzt von J. Endzelin. logie der Indogermanistik. In: Sprache in der Wissen-
4 Bde., Riga 1923/32. Vervollst. durch J. Endzelin / E. schaft. Germanistische Einblicke. Hrsg. v. Eglė Kon-
Hausenberg: Ergänzungen und Berichtigungen zu K. tutytė u. Vaiva Žeimantienė. Frankfurt/M., S. 251–264.
Mühlenbachs Lettisch-Deutschem Wörterbuch. Bd. 1 [i. (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissen-
e. Bd. 5]. Riga 1934/38. Und durch J. Endzelīns / E. schaft, 111)
Hauzenberga: Papildinājumi un labojumi K. Mülen-
bacha Latviešu valodas vārdnīcai. III sējums [i.e. Bd. 6]. 4.4 Beispiele für die Angabe von Aufsätzen in
Rīga 1946. Fachzeitschriften und anderen Periodika
O, Charles Kay / R, Ivor Armstrong (2013):
The Meaning of Meaning. A Study of the Influence of C, Eugenio (1967): Lexikalische Solidaritäten. In:
Language … New York 21927 (rev. edition); hiervon der Poetica 1, S. 293–303.
Reprint Mansfield Centre/USA. K, Ludwik (1951): Liryka Kniaźnina a poezja klasyczna.
R, Ivor Armstrong (2001): Selected Works, Przekłady Anakreonta. In: Eos. Organ polskiego towar-
1919–1938. Vol. 7: The Philosophy of Rhetoric (1936). zystwa filologicznego 45:2 [ersch. 1953], S. 25–54.
Hrsg. v. J. Constable. London–New York. Deutsche, K, Frank (2002): Historische Pragmatik. In: Mon-
gekürzte Fassung: Die Metapher. In: Theorie der Meta- tage/AV. Zeitschrift für Theorie und Geschichte audio-
pher. Studienausgabe. Hrsg. v. Anselm Haverkamp. visueller Kommunikation 11, S. 104–112.
Darmstadt 21996, S. 31–52. P, Anita (2011): Human beings, version 2.0. In: The New
York Times. Articles selected for Süddeutsche Zeitung
4.2 Beispiele für die Angabe von Einzelwerken mit deutli- 27. Juni 2011, S. 1. (Anhang der Süddeutschen Zeitung
cher Herausgeberschaft 145, 2011.)
S (2010a). — Hohlspiegel. In: Der Spiegel 8, S.150.
C, Ernst (81970). The Philosophy of Symbolic Forms. S (2010b). — Hohlspiegel. In: Der Spiegel 9, S.162.
Vol. 1: Language. Transl. by R. Manheim, preface and U, Andrejs / U, Danuta (1988): Lettland. [Enthält
introduction by Ch. W. Hendel. New Haven–London eine Zusammenstellung von Reden des Jahres.] In: Bal-
1955. tisches Jahrbuch 5, S. 39–104.
—,— (2001). Gesammelte Werke. Hamburger Aus- W, Elisabeth (2016): Das moralische
gabe. Bd. 11: Philosophie der symbolischen Bauchgefühl. [Detlef Esslinger interviewt Elisa-
Formen. Erster Teil: Die Sprache. Hamburg. beth Wehling.] In: Süddeutsche Zeitung
H, Anselm (21996), Hrsg.: Theorie der 31.12.2016, o. S. (rezipiert in digitaler Version, Ar-
Metapher. Studienausgabe. Darmstadt 1983. tikel-Identifizierer: 1.3315 629).
H (1994). — Quintus Horatius Flaccus: Ars
Poetica. Die Dichtkunst. Hrsg. u. Übers. v. E. Schäfer. 4.5 Verweise auf Internetseiten und auf Werke, die
Stuttgart. ausschließlich digital zugänglich sind
L (1990/94). — LCI. Lexikon der christlichen Ikonographie.
8 Bde.; hrsg. v. E. Kirschbaum, W. Braunfels et al.. Internetquellen lassen sich meist nicht in derselben be-
Rom–Freiburg et al. währten Form, die man von Monografien oder Aufsätzen
O, Lorelies / et al. (1991), Hrsg.: Deutsche Wortbil- kennt, in ein Literaturverzeichnis aufnehmen, da sie eine
dung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache. ganz andere Art von Referenz verlangen. Grundsätzlich
Eine Bestandsaufnahme des Instituts für Deutsche Spra- gilt, dass das verwendete Internetobjekt anhand Ihrer bi-
che, Forschungsstelle Innsbruck. Vierter Hauptteil: Sub- bliographischen Informationen eindeutig auffindbar sein
stantivkomposita. Komposita und kompositionsähnliche muss: In jedem Fall muss also die vollständige Internet-
Strukturen, [Bd.] 1. Düsseldorf. adresse angegeben werden; falls vorhanden, genügen in-
Z, Lew N. (2006), Hrsg.: Kulturelle Vorstellungswel- sofern URNs oder DOIs. Weiterhin sind (sofern bekannt)
ten in Metaphern. Frankfurt/M. et al. anzugeben: die Autor(en) oder Institution, die das Objekt
erstellt hat, der Titel der Quelle und bei fortlaufenden Ver-
4.3 Beispiele für die Angabe von Aufsätzen in öffentlichungen wie Online-Zeitschriften die ISSN.
Sammelbänden und anderen edierten Werken Allerdings muss man vorher noch unterscheiden, ob das
zitierte Internetobjekt bzw. digitale Werk
H (1989). — Prädikation. In: Historisches Wörterbuch a nur auf digitalem Wege bezogen wurde – etwa weil
der Philosophie. Vol. 7: P–Q. Hrsg. v. Joachim Ritter u. es der Verlag nicht nur im stationären Buchhandel als
Karlfried Gründer et al.. Basel, S. 1194–1211. Buch oder Zeitschrift, sondern auch digital über Inter-
L, Georges (1985): Zur Zerlegbarkeit von Wortbedeu- netplattformen vertreibt (z. B. als Download-PDF oder
tungen. In: Handbuch der Lexikologie. Hrsg. v. Chris- als epub-/cloud-Version) – oder ob es sich
toph Schwarze u. Dieter Wunderlich. Königsstein/Ts., b tatsächlich um eine rein digitale Publikation handelt.
S. 64–102. Für den Fall »a« kann das zitierte Werk im Literaturver-
P, Oswald (2003): Politische Veränderung – sprach- zeichnis wie jedes andere Druckwerk behandelt werden.
licher Wandel. In: Sprache und politischer Wandel. Hrsg. Denn bei den ›echten‹ Büchern und Zeitschriften fragt Sie
v. Helmut Gruber, Florian Menz u. Oswald Panagl. auch niemand, wie Sie an das fragliche Exemplar gekom-
Frankfurt/M., S. 331–345. men sind (ob etwa durch Lektüre in einer Bibliothek, durcheinen Scan oder durch Kauf). Gleichwohl ist es richtig, den netadressen kursiv aus; die Internetadresse bezeichnet das
Leser im entsprechenden Eintrag Ihres Literaturverzeich- ›selbständige‹ Werk, das einer bibliografischen Angabe zu
nisses darauf hinzuweisen, dass Sie eine digitale Fassung Grunde liegt. Außerdem bleibt dann auch bei ungünstigen
verwendet haben. So ist das z. B. auch beim letzten Eintrag Zeilenumbrüchen immer der Zusammenhang der Internet-
von Kapitel 4.4 (»Wehling 2016«) geschehen. adresse sichtbar.
Für den Fall »b« – und darunter fallen vor allem die ›rei-
nen‹ Internetseiten, die häufig aktualisiert, verändert oder
auch deaktiviert werden – ist außer den oben genannten 5 Plagiat
Angaben auch das Recherchedatum (d. i. das Datum des
letzten Zugriffs) anzugeben. Bei fehlender Seitennumme- Unter einem Plagiat versteht man die ungekennzeichnete
rierung sind Frame-, Kapitel- oder Absatzangaben zur bes- oder nicht angemessen gekennzeichnete Übernahme von
seren Auffindbarkeit von Belegen oder Zitaten wünschens- fremdem geistigen Eigentum in eigene Arbeiten, und zwar
wert. Unser Tipp: Speichern Sie die Internetseiten, die Sie unabhängig von dessen Herkunft (d. h. auch, wenn das geis-
benutzt bzw. zitiert haben, auf Ihrem Rechner ab. Sie kön- tige Eigentum aus dem Internet stammt). Die Übernahme
nen die abgespeicherten Seiten dann später leicht auf einer von fremdem geistigen Eigentum schließt als Tatbestand
CD-ROM Ihrer Arbeit beifügen, falls das für die Darstellung Fakten, Argumente, spezifische Formulierungen und spe-
oder Nachrecherche Ihrer Ergebnisse sinnvoll erscheint. zifische Terminologien sowie deren Paraphrasierung oder
Im Literaturverzeichnis Ihrer Arbeit sollten die digitalen Übersetzung ein. Unter den Tatbestand fällt ebenfalls die
Publikationen vom Typ »b«, formal gesehen, soweit wie Übernahme von Bildern, Grafiken, Diagrammen und ähn-
möglich wie gedruckte Quellen behandelt werden. Das ist lichen ›Elementen‹. Eine Arbeit, die nachweislich ein Pla-
immer dann gut möglich, wenn die digitale Seite oder das giat gemäß dieser Definition darstellt, wird als schwerer
digitale Objekt eine klare Autorschaft haben; als Jahresan- Prüfungsverstoß gewertet.
gabe kann dann das Jahr Ihres Zugriffs fungieren. Im ande-
ren Fall ist es besser, der Internetseite eine ›freie‹ Sigle zu
geben. So könnten Sie z. B. in Ihrem Text die Sigle »DP digi- 6 Weiterführende Literatur
tal 2015« oder »DeStatis-Seite 2018« verwenden und dazu
in Ihrem Literaturverzeichnis angeben: P, Klaus (21988): Duden. Wie verfaßt man wissen-
schaftliche Arbeiten? Ein Leitfaden vom ersten Stu-
DP (2015). — Lietuvių kalbos institutas, diensemester bis zur Promotion. Mannheim. (Die
Hrsg.: Faksimile von Mikalojus Daukšas Duden-Taschenbücher 21.)
»Postilla Catholicka …« (1599). Auf: www.lki.l R, Georg / S, Joachim / F,
t/seniejirastai/db.php?source=2 (abgerufen Norbert (152009), Hrsg.: Die Technik wissenschaft-
am 04.10.). lichen Arbeitens. Eine praktische Anleitung. Pa-
DS-S (2018). — Statistisches derborn et al. 21980. (UTB 724.)
Bundesamt, Hrsg.: Pressemitteilung Nr. 181 vom R, Jens / S, Torsten (32001): Das Zitat im In-
23.05.2018. »Bevorstehender Brexit führt zu Rekord- ternet. Ein Electronic Style Guide zum Publizieren, Bi-
wert an Einbürgerungen britischer Staatsangehöriger.« bliographieren und Zitieren. Hannover.
Auf: www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Press S, Ewald (182008): Die Form der wissenschaftlichen
emitteilungen/2018/05/PD18_181_12511.html (abge- Arbeit. Grundlagen, Technik und Praxis für Schule, Stu-
rufen am 22.09.). dium und Beruf. Heidelberg 61975; Wiebelsheim. (UTB
272.)
Internetadressen sind oftmals komplex. Deshalb werfen sie
in einigen Fällen Probleme beim Zeilenumbruch auf. Ein
Bindestrich als Trennungszeichen ist in diesem Zusammen- 7 Anhang
hang unzulässig, da er als Bestandteil der Adresse miss-
verstanden werden kann. Deshalb sind Trennungen nur Eine »Erklärung über die selbständige Abfassung der Prü-
mithilfe eines Leerzeichens möglich. fungsarbeit« ist obligatorischer Bestandteil einer jeden
Um auf das Beispiel »DeStatis-Seite 2018« zurückzu- schriftlichen Arbeit, die zur Erlangung eines Leistungs-
kommen: Möglicherweise ist die zitierte Presseerklärung in nachweises bzw. als Prüfungsleistung bei uns eingereicht
ein paar Jahren nicht mehr aufrufbar; aber die Seite »DeSta- wird. Bitte verwenden Sie das folgende Formular:
tis« ist geblieben. Deshalb entspricht das Verhältnis von di- ipk.uni-greifswald.de/fileadmin/uni-greifswald/fakultaet/
gitaler Presseerklärung zu DeStatis-Internetadresse in etwa phil/ipk/Studium/B.A._KoWi/Hinweise_zum_Studium/
dem von Aufsatz zu Zeitschrift. Zeichnen Sie deshalb Inter- Selbstaendigkeit_Einverstaendnis_DigitalePruefung.pdfSie können auch lesen