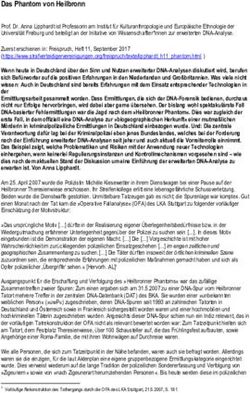Orexin-Expression und -Promotormethylierung bei alkoholabhängigen Patienten während des akuten Alkoholentzuges im Vergleich zur Langzeitabstinenz ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Orexin-Expression und -Promotormethylierung
bei alkoholabhängigen Patienten während des
akuten Alkoholentzuges im Vergleich zur
Langzeitabstinenz.
Der Medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
zur
Erlangung des Doktorgrades Dr. med.
vorgelegt von
Irina Kotin geb. LeinonenAls Dissertation genehmigt von der Medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Vorsitzender des Promotionsorgans: Prof. Dr. Markus F. Neurath
Gutachterin: Prof. Dr. Anna Teresa Biermann
Gutachter: Prof. Dr. Wolfgang Sperling
Tag der mündlichen Prüfung: 19.01.2021Inhaltsverzeichnis
1 Überblick ..................................................................................... 1
1.1 Abstract ........................................................................................... 1
1.1.1 Backgrounds and objectives .................................................. 1
1.1.2 Materials and Methods ........................................................... 1
1.1.3 Results and observations ....................................................... 2
1.1.4 Conclusion ............................................................................. 2
1.2 Zusammenfassung ......................................................................... 4
1.2.1 Hintergründe und Zielsetzung ................................................ 4
1.2.2 Material und Methoden .......................................................... 4
1.2.3 Ergebnisse und Beobachtungen ............................................ 5
1.2.4 Schlussfolgerung ................................................................... 5
2 Theoretische Grundlagen .......................................................... 7
2.1 Genetik ............................................................................................. 7
2.1.1 Historie der Genetik ............................................................... 7
2.1.2 Epigenetik .............................................................................. 7
2.1.3 DNA-Methylierung .................................................................. 8
2.2 Alkohol und Alkoholabhängigkeit ............................................... 13
2.2.1 Epidemiologie des Alkoholkonsums ..................................... 13
2.2.2 Ätiologie ............................................................................... 13
2.2.3 Definitionen des Alkoholkonsums ........................................ 15
2.2.4 Folgen und Prognose der Alkoholabhängigkeit ................... 18
2.2.5 Therapie der Alkoholabhängigkeit ........................................ 19
2.3 Orexin ............................................................................................ 21
2.3.1 Entdeckung des Orexins ...................................................... 21
2.3.2 Struktur des Orexins ............................................................ 21
2.3.3 Orexinrezeptoren ................................................................. 22
2.3.4 Funktionen des Orexins ....................................................... 25
2.4 Themenfindung ............................................................................. 323 Material und Methoden ............................................................ 33
3.1 Patienten und Design ................................................................... 33
3.2 PCR-Prinzipien .............................................................................. 35
3.3 RNA-Isolierung aus PAXgene Blood Tubes ............................... 35
3.3.1 Material ................................................................................ 35
3.3.2 RNA Isolierung ..................................................................... 37
3.3.3 RNA-Messung mittels Nanodrop ......................................... 39
3.3.4 cDNA-Synthese ................................................................... 39
3.3.5 Quantitative RT-PCR............................................................ 40
3.3.6 Auswertung der Messergebnisse ......................................... 42
3.4 Beurteilung der DNA Methylierung ............................................. 42
3.4.1 Material ................................................................................ 42
3.4.2 DNA-Extraktion .................................................................... 44
3.4.3 Photometrie .......................................................................... 45
3.4.4 Bisulfitierung ........................................................................ 45
3.4.5 Gelelektrophorese der PCR-Produkte ................................. 48
3.4.6 Aufreinigung der PCR-Produkte .......................................... 49
3.4.7 Photometrische Messung der DNA-Konzentrationen .......... 50
3.4.8 Elongation ............................................................................ 50
3.4.9 Auswertung der Ergebnisse ................................................. 51
3.5 Gelelektrophorese ........................................................................ 51
3.5.1 Material ................................................................................ 51
3.5.2 Durchführung ....................................................................... 52
3.6 Statistische Methoden .................................................................. 52
4 Ergebnisse ................................................................................ 54
4.1 Deskriptive Analyse ...................................................................... 54
4.1.1 Orexinexpression und Promotor-Methylierung .................... 54
4.1.2 Methylierung in Abhängigkeit vom Geschlecht .................... 55
4.1.3 Orexinexpression und Blutalkoholspiegel bei Aufnahme ..... 564.2 Methodische Statistik ................................................................... 56
4.2.1 Orexinexpression in Abhängigkeit von der Zeit .................... 56
4.2.2 Orexinexpression und mittlere Methylierung ........................ 57
4.2.3 Orexinexpression und WSA ................................................. 58
5 Diskussion ................................................................................ 58
5.1 Diskussion der Ergebnisse aus deskriptiver Statistik .............. 59
5.1.1 Orexinsexpression und Promotormethylierung .................... 59
5.1.2 Geschlechtsspezifische Orexin-Promotormethylierung ....... 60
5.1.3 Orexinexpression und Blutalkoholkonzentration .................. 60
5.2 Rolle des Orexins während der Alkoholabhängigkeit und
Abstinenz anhand aktueller Studienlage .............................................. 61
5.3 Ergebnisdiskussion der Methodischen Analyse in Anlehnung
an aufgelistete Forschungsergebnisse ................................................ 65
5.4 Limitierende Faktoren .................................................................. 67
5.5 Zusammenfassung und Zukunftsperspektive ........................... 69
Literaturverzeichnis ............................................................................. 71
Abkürzungsverzeichnis ........................................................................ 88
Tabellenverzeichnis ............................................................................. 91
Abbildungsverzeichnis ......................................................................... 921 1 Überblick 1.1 Abstract 1.1.1 Backgrounds and objectives Alcoholism is a disease, which is stigmatized negatively in our society. The transition from enjoyment to dependency can be a creeping process, that is often underestimated. The accelerating tolerance to ethanol on the one hand and the weaker activation of the reward system on the other hand, lead to an increase in dose. The infinite loop can lead from low-risk, over high risk, to harmful alcohol consumption, and thus can even end in dependence. Alcohol abstinence triggers vegetative and psychological symptoms which drive an affected person to consume alcohol again for regain a kind of steady state well-being. The withdrawal symptoms are triggered by a series of different neurological transmitters in the brain, that normally serve to sustain vital processes. Orexin is a neurotransmitter which is expressed in the lateral hypothalamus and plays a crucial role in food and fluid intake. Orexin regulates the sleep / wake rhythm and exerts influence on both the stress response and the reward system. This work deals with changes in orexin expression in peripheral blood leukocytes during acute alcohol withdrawal compared to long-term abstinent patients considering the promoter methylation of the orexin gene. 1.1.2 Materials and Methods The prospective and non-randomized study is a case-control study. A total of 68 patients with a diagnosis of alcohol dependence according to ICD-10 and DSM-IV criteria were recruited. The control group, consisting of 27 patients were examined in the long-term withdrawal of the Engelthal Hospital. They underwent a one-time blood sample test and an interview. The case group included 41 patients undergoing acute alcohol withdrawal, who were accommodated in the closed psychiatric ward of the University of Erlangen at three different time points. On the day of the presentation, on the 2nd and 7th day of the clinical hospitalization, a blood sample was taken with simultaneous questioning.
2 Craving was verified with the Obsessive Compulsive Drinking Scale (OCDS) and the severity of the withdrawal with the "withdrawal syndrome scale for alcohol and related psychoactive drugs" (WSA). The withdrawal symptoms were either treated with clomethiazole or with benzodiazepines. Afterwards, DNA as well as RNA was extracted from the blood samples. Specific orexin primers were designed and tested for PCR of the mRNA expression as well as methylation status of the orexin primer region. The statistical analysis was conducted using descriptive and mixed model analyses. 1.1.3 Results and observations A statistically significant difference of the Orexin A mRNA expression was observed at the three time points of the withdrawal in this study. Compared to the long-term abstinence, the orexin concentrations had increased significantly during the acute alcohol withdrawal in peripheral blood lymphocytes. There was also a significant association between orexin and the severity of withdrawal symptoms, including craving and body mass index. The stronger the withdrawal symptoms, the lower the Orexin A concentration. In contrast, it was not possible to find an association between the promoter methylation and orexin expression. There was no correlation between the blood alcohol concentration at admission and DNA-methylation. Gender also had no effect on orexin expression. 1.1.4 Conclusion Orexin is a neurotransmitter that controls vital processes. It regulates not only the food intake and sleep / wakefulness, it is also involved in stress and reward regulation. The interaction of orexin with other neurotransmitters in different brain areas and the associated changes in neuroplasticity, in the context of dependence, contribute to the symptoms of withdrawal as well as during abstinence. Orexin seems to influence the withdrawal symptoms and especially craving directly but also indirectly, so that the present study underpins this function. The reduction of orexin A secretion during withdrawal correlates with the severity of withdrawal symptoms. Low Orexin
3 concentration seems to lead to a dopamine deficiency which is very likely to contribute to anhedonia. The repressed expression of orexin, in the abstinence of alcohol, can be associated with strong mental and physical symptoms. This condition is often very stressful and unbearable for patients, contributing to explanations of high relapse rates. Orexin appears to play a central role in the formation and maintenance of withdrawal symptoms. Therefore, it might be able to play a role in therapies for alcohol dependence as feasible medications are already on the market for other indications such as obesity. Further studies are needed to elucidate the possible role of orexin as well as orexin antagonists in treatments of alcohol dependence.
4 1.2 Zusammenfassung 1.2.1 Hintergründe und Zielsetzung Alkoholismus ist eine Erkrankung, die in unserer Gesellschaft negativ stigmatisiert wird. Der Übergang vom Genuss zur Abhängigkeit kann ein schleichender Prozess sein, der oft unterschätzt wird. Die Dosissteigerung entwickelt sich zum einen aus der Toleranz gegenüber Ethanol und zum anderen aus einer schwächeren Aktivierung des Belohnungssystems. Diese „Endlosschleife“ kann vom risikoarmen über riskanten, bis hin zum schädlichen Alkoholkonsum führen und folglich sogar in Abhängigkeit enden. Eine drohende vegetative und psychische Entzugssymptomatik führt dementsprechend zum erneuten Konsum. Die Entzugssymptome werden durch eine Reihe unterschiedlicher Transmittersysteme im Gehirn ausgelöst, die normalerweise der Aufrechterhaltung lebenswichtiger Prozesse dienen. Orexin ist ein Neurotransmitter, der im lateralen Hypothalamus gebildet wird und eine entscheidende Rolle bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme spielt. Orexin reguliert den Schlaf-/Wachrhythmus und beeinflusst sowohl die Stressreaktion als auch das Belohnungssystem. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Veränderungen der Orexinexpression in peripheren Blut-Leukozyten während des akuten Alkoholentzuges im Vergleich zu langzeitabstinenten Patienten unter der Berücksichtigung der Promotormethylierung des Orexingens. 1.2.2 Material und Methoden Die durchgeführte prospektive und nicht randomisierte Studie entspricht einer Fall-Kontrollstudie. Dabei wurden insgesamt 68 Patienten mit einer Diagnose der Alkoholabhängigkeit nach ICD-10 und DSM-IV Kriterien rekrutiert. Als Kontrollgruppe wurden 27 Patienten im Langzeitentzug der Klinik Engelthal untersucht, die sich einmalig einer Blutentnahme und einem Interview unterzogen. Zur Fallgruppe gehörten 41 Patienten im akuten Alkoholentzug, die auf der geschlossenen Psychiatriestation der Universität Erlangen
5 untergebracht waren. Bei dieser Gruppe erfolgten die Untersuchungen zu drei Zeitpunkten. Am Vorstellungstag, am 2. und 7. Tag des klinischen Aufenthaltes, fanden jeweils eine Blutentnahme mit simultaner Befragung statt. Das Verlangen, also Craving wurde mit der Obsessive Compulsive Drinking Scale (OCDS) und der Schweregrad des Entzuges mit der „withdrawal syndrome scale for alcohol and related psychoactive drugs“ (WSA) verifiziert. Die Behandlung auftretender Entzugssymptomatik erfolgte entweder mit Clomethiazol oder mit Benzodiazepinen. Aus den Blutproben wurde sowohl mRNA als auch DNA isoliert, aus denen die Orexin mRNA Expression sowie die Promotor Methylierung des Orexin Gens mittels PCR bestimmt wurden. Die statistische Auswertung erfolgte mittels deskriptiver Statistik sowie anhand gemischter Modelle. 1.2.3 Ergebnisse und Beobachtungen Bei der durchgeführten Studie konnte ein statistisch signifikanter Unterschied der Orexin A Expression zu den drei Messzeitpunkten des Entzuges beobachtet werden. Im Vergleich zu den Langzeitabstinenten fanden sich im akuten Alkoholentzug deutlich erhöhte Orexin-mRNA-Konzentrationen in den peripheren Blutlymphozyten. Ein signifikanter Zusammenhang konnte auch zwischen dem Orexin und dem Schweregrad der Entzugssymptomatik, dem Craving und dem Body Mass Index verzeichnet werden. Je stärker die Entzugserscheinungen waren, desto niedriger war die Orexin mRNA. Demgegenüber präsentierte sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Promotormethylierung und Orexin-mRNA-Expression. Es konnte keine Korrelation zwischen der Blutalkoholkonzentration bei Aufnahme und der Methylierung verzeichnet werden. Auch hatte das Geschlecht keinen Einfluss auf die Orexinexpression. 1.2.4 Schlussfolgerung Orexin ist ein Neurotransmitter, der lebenswichtige Prozesse steuert. Es reguliert nicht nur die Nahrungsaufnahme sowie den Schlaf-/Wachrhythmus,
6 sondern ist auch an der Stress- und Belohnungsregulation beteiligt. Die zentrale Interaktion des Orexins mit anderen Neurotransmittern in verschiedenen Gehirnarealen und die damit verbundenen Veränderungen der Neuroplastizität im Rahmen der Abhängigkeit tragen zur Symptomatik während der Abstinenz entscheidend bei. Das Orexin scheint die Entzugssymptomatik und besonders das Craving direkt, aber auch indirekt zu beeinflussen, sodass die durchgeführte Studie einen weiteren Hinweis auf diese Funktion liefert. Die Reduktion der Orexin A-mRNA während des Entzuges korreliert mit der Stärke der Entzugssymptomatik. Möglicherweise trägt das durch Orexinmangel bedingte Dopamindefizit zur Anhedonie im Rahmen der frühen Alkoholabstinenz bei. Da Orexin Antagonisten bereits bei anderen Krankheiten wie Adipositas eingesetzt werden, könnten weitere Studien die Rolle einer solchen Medikation während des kurz- und längerfristigen Entzuges untersuchen.
7 2 Theoretische Grundlagen 2.1 Genetik 2.1.1 Historie der Genetik Geneá, die Abstammung oder auch genesis, der Ursprung, bilden den Stamm des Wortes „Genetik“, der durch Bateson definiert wurde (Bateson 2002). Die Liste der Forscher, die sich mit der Vererbungslehre beschäftigt haben, ist lang. Gregor Mendel wird heute als Begründer der Genetik anerkannt. Seine Kreuzungen an Erbsenpflanzen werden als Ursprung der Vererbungslehre angesehen und waren die entscheidenden Experimente zur Erstellung der Mendelschen Regeln (Mendel 1866). Miescher extrahierte 1868 aus Leukozyten-Zellkernen einen Zellbestandteil, der sich in seinen Eigenschaften von anderen Proteinen unterschied, und benannte diesen als „Nuklein“. Kossel entschlüsselte 1903 Zucker, Phosphorsäure und fünf verschiedene Basen als Strukturelemente der Nukleinsäure. Daraufhin wurden Chromosomen von Sutton und Boveri 1904 als Träger der Erbinformation identifiziert. Es dauerte über 50 Jahre bis es schließlich dem britischen Forscher Crick und dem Amerikaner Watson 1953 gelang, das Doppelhelixmodel der DNA, bestehend aus Fruktose, Phosphorsäure und DNA-Basen Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin, zu beschreiben (Dahm 2005). Jedoch ist die Individualität jedes Organismus nicht in der Struktur der DNA festgelegt, sondern wird unter anderem durch die epigenetischen Veränderungen und Einflüsse geschaffen. 2.1.2 Epigenetik In der Genetik wird die DNA als Informationsträger angesehen. Die Epigenetik beinhaltet die griechische Vorsilbe „epi“: über, und beschreibt somit die übergeordneten Vorgänge der Vererbung, die nicht mit einer Veränderung des DNA-Codes einhergehen (Jablonka, Goitein et al. 1985). Dabei werden Gene in ihrer Funktion, jedoch nicht in ihrer Sequenz beeinflusst (Rodenhiser, Mann 2006). So kann bei gleichem Genotyp der Phänotyp und folglich die Ausprägung von Eigenschaften variieren. Zu den wichtigsten
8
Modifikationensvarianten zählen Phosphorylierung (Cheung, Tanner et al.
2000), Acetylierung (Strahl, Allis 2000), Methylierung von Histonen (Jenuwein
and Allis 2001; Zhang and Reinberg 2001) aber auch die Methylierung der
DNA (Grewal and Moazed 2003).
2.1.3 DNA-Methylierung
2.1.3.1 Lokalisation und Funktion
Bei der DNA-Methylierung wird das Cytosin in Form einer chemischen
Reaktion modifiziert. S-Adenosyl-L-Methionin (SAM) fungiert als Donator der
Methylgruppe. Diese wird an das 5. Kohlenstoff des Cytosins mit Hilfe der
DNA-Methyltransferasen (DNMT) enzymatisch gebunden, sodass das 5-
Methylcytosin entsteht (Jeltsch 2002).
Abbildung 1: Methylierung des Cytosins
Das Methylcytosin liegt meist in 5'-CG-3'-Dinukleotiden, CpGs, vor. Bereiche
mit CpG-Kummulationen werden als CpG-Inseln bezeichnet und sind meist in
der Nähe wichtiger Gene lokalisiert (Costello und Plass, 2001). In über 50%
der Promotorregionen sowie im Bereich der Gene, die grundlegende
Zellfunktionen bestimmen, „housekeeping genes“, aber auch in
gewebsspezifischen Genen, sind CpG-Inseln repräsentiert (Larsen et al 1992).
In Promotorregionen aktiver Gene sind nur ca. 30 % der CpG-Inseln methyliert.
Das gesamte Genom der Säugetiere weist eine 70-80 % Methylierung von
Cytosin-Guanin-Sequenzen auf (Abdolmaleky et al. 2004).
Die DNA-Methyltransferasen (DNMT 1, 2, 3a und 3b) gehören einer
Enzymfamilie an und katalysieren die Methylierung spezifisch. Die DNMT 1 ist9 in allen Zellen vorhanden. Sie ist für die Übertragung der Methylgruppen an die Tochterzellen verantwortlich und dient der Erhaltung des durch den Matritzenstrangs vorgegebenen Musters. (Pradhan 1999; Yoder et al. 1997). DNMT 3a und 3b übernehmen die Aufgabe der de novo-Methylierung (Hsieh 1999; Okano et al. 1998). DNMT 2 methyliert die RNA-Sequenzen und ist im Cytoplasma vorzufinden (Goll et al 2006). Die Methylierung hat Einfluss auf die Struktur des Chromatins. Sie greift in die Interaktion zwischen DNA und Proteinen ein und wirkt folglich auch auf die Transkription (Razin, Cedar 1991; Bird 1992). Es sind 2 Mechanismen bekannt, die aufgrund der Methyl-Cytosine das Ablesen der DNA beeinflussen. Die methylierten CpGs hemmen einerseits das Andocken der Transkriptionsfaktoren an Promotorregionen und begünstigen andererseits in diesen Bereichen die Bindung transkriptionshemmender Proteine (Bird 2002). Diese werden zu einer Proteinfamilie zusammengefasst, da sie eine ähnliche methyl-CpG-bindende-Domäne aufweisen. Zu ihnen gehören MBD1, MBD 2, MBD 3, MBD 4 (Hendrich, Bird 1998; Bird 2002), MeCP 1 (Boyes, Bird 1992) und MeCP 2 (Kudo 1998; Nan et al. 1998). MeCP2 bindet nicht nur an die methylierten Promotorregionen, sondern inhibiert zudem die Histon- Deacetylasen und somit die Chromatinkondensation (Nan et al. 1998). Das MBD 4 gehört zu den Reparaturenzym, den DNA-Glycosylasen und spaltet die desaminierten 5-Methylcytosin-Basen von der DNA (Jin et al. 2005). Aufgrund der beschriebenen Transkriptionsinhibition können Rückschlüsse von der Anzahl und Kumulation an methylierten CpGs auf die Aktivität und Expression bestimmter Gene gezogen werden.
10 Abbildung 2: Das Prinzip der DNA-Methylierung in Anlehnung an Rodenhiser D., Mann M. 2006 2.1.3.2 Bedeutung und Veränderung des Methylierungsstatus. Die Methylierung der CpG-Inseln ist gewebsspezifisch, sodass sich die Proteinexpression einzelner Zellen unterscheidet (Kress et al. 2001). Beispielsweise produzieren Nervenzellen Neuropeptide, Hormone und Rezeptoren (Bird 2002). Entsprechend der Notwendigkeit kann die Methylierung auch verändert werden. Während der Schwangerschaft oder Stillzeit einer Frau werden z.B. in der Hypophyse Prolaktin und Somatotropin vermehrt exprimiert. Dies beruht auf einer transienten Änderung der CpG- Methylierung der genannten Gene (Kumar, Biswas 1988). Demgegenüber gibt es aber auch Methylierungen im Genom, die nicht mehr modifizierbar sind
11 (Reik et al. 2001). Während der Embryonalzeit werden bei der X- chromosomalen Inaktivierung Genabschnitte eines der beiden weiblichen Gonosomen mittels Methylierung ausgeschaltet (Panning, Jaenisch 1998). Dies bedingt ein funktionelles Mosaik an in- und aktiven Genen des väterlichen sowie mütterlichen X-Chromosoms bei weiblichen Individuen. Die DNA-Methylierung übernimmt eine wichtige Funktion beim sogenannten „genomischen Imprinting“ (Rodrigues J.A., Zilberman D. 2015). Bereits im Keimzellstadium wird eines der beiden elterlichen Allele inaktiviert, sodass die Expression des imprinten Gens entweder maternalen oder paternalen Ursprungs ist (Rodrigues J.A., Zilberman D. 2015). Der Phänotyp wird durch das aktive dominante Allel bestimmt, wobei das reprimierte Allel rezessiv weitervererbt wird. Das Imprinting ist reversibel, da jede Keimzelle ihre neue geschlechtsspezifische Prägung erfährt. 2.1.3.3 Methylierung und Krankheitsentstehung Die Methylierung ist zellspezifisch und hat eine wichtige Rolle bei der Regulation der Embryogenese, der X-chromosomalen Inaktivierung und dem genomischen Imprintig. Störungen, Fehler, Hypo- oder Hypermethylierung bestimmter DNA-Regionen können verschiedene Erkrankungen des Individuums nach sich ziehen (Razin, Cedar 1991; Bird 2002). Eine Hypermethylierung der Promotorregionen von z. B. Tumorsuppressorgenen verhindert deren Transkription und fördert somit die Krebsentstehung (Jones, Laird 1999). In kolorektalen Karzinomzellen konnten im Vergleich zu gesunden Körperzellen vermehrt hypermethylierte CpG-Inseln nachgewiesen werden (Feinberg et al. 1988). Eine Hypomethylierung hingegen kann sowohl zur Chromosomeninstabilität als auch zur Onkogenproduktion beitragen (Eden et al. 2003). Beispiele für Erkrankungen bedingt durch fehlerhafter Imprintingvorgänge in der Keimzellentwicklung sind das Prader-Willi- (PWS) und das Angelman- Syndrom (AS). Diese genetischen Erkrankungen gehen mit einer mentalen Retardierung sowie neurologischen und phänotypischen Veränderungen einher (Nicholls 2000, Walter 2003). Auch bei Patienten mit psychischen Erkrankungen konnten Methylierungs
12 abweichungen bestimmter Gene festgestellt werden. Um nur einige Beispiele zu nennen, geht die Schizophrenie mit einer Hypermethylierung des Reelin- Gens und Konzentrationsabfall dieses Proteins einher (Abdolmaleky et al. 2004). Zudem konnte eine Hypomethylierung des Gens der membrangebundenen Catechol-O-Methyltransferase (MB-COMT) nachgewiesen werden. Eine erhöhte Expression dieses Enzyms bedingt eine induzierte Inaktivierung der Neurotransmitter: Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin (Abdolmaleky et al. 2006).
13 2.2 Alkohol und Alkoholabhängigkeit 2.2.1 Epidemiologie des Alkoholkonsums Äthylalkohol gehört zur Gruppe der Alkohole und wird durch Gärung aus Zuckern gewonnen. Es wirkt berauschend und ist neben dem Nikotin eines der bekanntesten Suchtmittel. (Deutsche Hauptstelle für Suchthilfe e. V.). Die World Health Organisation (WHO) veröffentlicht im „Global Status Report on Alcohol and Health 2018“ weltweite Ergebnisse des Alkoholkonsums: Die Deutschen trinken jährlich 11,3 l Alkohol/Person und übersteigen den durchschnittlichen Konsum europaweit. Das beliebteste alkoholische Getränk der Deutschen ist und bleibt mit 58 % das Bier, gefolgt von Wein und Hochprozentigem. Männer trinken 2,5-mal mehr als Frauen, sodass sie im Jahr ca. 21,3 l Alkohol pro Person zu sich nahmen. Dabei ist anzumerken, dass die als unschädlich betrachtete Menge bei Frauen halb so hoch ist (10- 12g Alkohol/d) als bei Männern (20-24 g Alkohol/d). Die Zahlen des Konsums korrelieren mit den Prozentsätzen der Morbidität sowie den Folgeschäden. Eine Alkoholabhängigkeit nach ICD-10 konnte 2016 bei 5 % der Männer und 2 % der Frauen festgestellt werden (WHO 2016). Dementsprechend konsumieren rund 5,5 Mio. Deutsche Alkohol in gesundheitsgefährdender Art, wovon ca. 2,8 Mio. bereits alkoholabhängig sind. Die Mortalität infolge des Missbrauchs wird in Deutschland auf min. 74.000 Menschen/Jahr geschätzt (WHO 2018). 2.2.2 Ätiologie Das bio-psycho-soziale Modell spielt bei der Entstehung, Unterhaltung und Therapie der Alkoholabhängigkeit eine entscheidende Rolle. Der psychischen Komponente können z. B. Traumatisierung oder Verlusterlebnisse angerechnet werden. Die individuellen Mechanismen der Stressbewältigung, Motivation und Belohnung stellen wichtige Faktoren bei der Entstehung einer Alkoholabhängigkeit dar (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2019). Die sozialen Strukturen tragen aber auch zur Krankheitsentstehung bei (Enoch
14 and Goldmann 2001). Weitergegebene Werte, Normen und Einstellung zum Alkohol durch die Eltern und die sozialen Strukturen sind hierbei entscheidend. Die biologische Anfälligkeit wird u.a. durch genetische Prädisposition, fronto- cerebrale Veränderungen, aber auch Varianten im Alkoholmetabolismus beeinflusst. Mehrere Studien zeigten, dass nachkommende Generationen von Alkoholikern eine erhöhte Inzidenz zur Abhängigkeitsentwicklung aufweisen. Dabei sind eineiige Zwillinge deutlich stärker gefährdet als zweieiige und Geschwister (Mayfield 2008). Auch Gene wirken entweder direkt oder prädisponierend auf die Entstehung der Alkoholabhängigkeit. Impulsivität wird als Eigenschaft für einen Endophänotyp mit erhöhtem Suchtpotential angesehen. Genvariation des GABA-Rezeptors führt dabei zur veränderten, neuronalen Entladung. Dieser Polymorphismus ist auch bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung bekannt und geht häufig mit Alkoholsucht einher (Edenberg 2006). Durch Aktivierung des GABA-Rezeptors kann Alkohol die sedierende und anxiolytische Wirkung entfalten und zugleich die Koordination und die Entzugssymptomatik beeinflussen. Auch Veränderungen cholinerger oder dopaminerger Rezeptorgene sind mit einer höheren Suchtwahrscheinlichkeit assoziiert (Edenberg 2006). Psychische Erkrankungen wie Schizophrenie oder die bipolare Störung gehen mit höherem Alkoholabhängigkeits-Risiko einher (Mayfield 2008). Großen Einfluss haben auch die alkoholabbauenden Enzyme, die eine Suchtentwicklung verstärken, aber auch verhindern können. Polymorphismen des ADH-4- und des ADH-1-Gens führen zur Steigerung der Aktivität und Beschleunigen die Oxidierung des Alkohols (Goedde et al. 1992). Der Verbrauch des Co-Faktors NAD entspricht hierbei dem limitierenden Faktor der Oxidation. Bei normaler ALDH-Funktion kumuliert das toxische Acetaldehyd, was oft mit starker vegetativer Symptomatik, Tachykardie, Hyperhydrose, Nausea, Emesis, Flushing, Hyperventilation und Cephalgie einhergeht. Dies wird als „Flush-Syndrom“ bezeichnet und stellt einen protektiven Faktor gegen die Entstehung einer Alkoholabhängigkeit dar (Goedde et al 1992). Gleiches Prinzip gilt bei verzögertem Abbau durch die ALDH aufgrund der
15
Inaktivierung des ALDHII-Gen. Der ALDHII Mangel ist besonders bei Asiaten
bekannt und hat ebenso einen protektiven Effekt gegen Suchtentstehung.
Im Gegensatz dazu gehen Polymorphismen des ADH1C-Gens mit einer
Steigerung der Aktivität, jedoch ohne Flush-Syndrom einher. Bei dieser
Genvariante steigt das Karzinomrisiko des oberen Gastrointestinaltraktes, des
Colorektums und der Mamma stark an (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen
e.V. 2019).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entstehung einer
Alkoholabhängigkeit multifaktoriell bedingt sein kann und dass neben
genetischer Prädisposition auch psycho-soziale Faktoren eine wichtige Rolle
spielen.
2.2.3 Definitionen des Alkoholkonsums
2.2.3.1 Definition und Symptome des schädlichen Alkoholgebrauchs und der
Alkoholabhängigkeit
Alkoholismus wurde definiert als eine psychische Krankheit, die mit
chronischem Alkoholkonsum und schließlich mit Abhängigkeit einhergeht.
(Morse 1992; Schmidt 2005).
Elvin Morton Jellinek, der Studien über anonyme Alkoholiker auswertete,
beschrieb den Kontrollverlust als eines der wichtigsten Punkte seiner
Krankheitsdefinition (Jellinek 1960). Dieses Kriterium wurde von der WHO erst
verzögert in die Definition des Alkoholismus aufgenommen. Der
Kontrollverlust gehört aber bis heute neben der Dosissteigerung und der
Entzugssymptomatik zu den drei Hauptkriterien der Alkoholabhängigkeit
(WHO 2010).
Historisch gesehen wurde Missbrauch und Abhängigkeit in einem Begriff, dem
Alkoholismus lange Zeit vereint. Erst in den siebziger Jahren gelang es, diese
beiden Begriffe zu differenzieren und voneinander getrennt zu betrachten
(Feuerlein 1998).
Heutzutage kann entweder ein Alkoholmissbrauch oder eine
Alkoholabhängigkeit diagnostiziert werden. Um beides voneinander
abzugrenzen, müssen persönliche Eigenschaften sowie Art, Dauer, Häufigkeit
und Menge des Konsums verifiziert werden. Detaillierte Fragestellung nach16 der psychischen und physischen Symptomatik und Veränderungen im zeitlichen Verlauf sind sehr wichtig (Mann et al. 2016). Als schädlicher Gebrauch oder Missbrauch F10.1 wird Alkoholkonsum bezeichnet, der psychische und physische Krankheitsfolgen mit sich bringt. Häufig erfährt der Konsument Kritik gegenüber seinem Alkoholkonsum, was nicht selten zu negativen sozialen Konsequenzen führt (WHO 2010). Zur Diagnosestellung der Alkoholabhängigkeit gehören sowohl die Eigen- als auch die Fremdanamnese. Bei Erstgesprächen mit den Patienten können zur besseren Evaluationserhebung strukturierte Fragebögen, z. B. der Münchner- Alkoholismustest (MALT von Feuerlein), Trierer Alkoholismusinventar (TAI von Funke) oder die European addiction severity index (Europ-ASI von Gsellhofer) und der CAGE Fragebogen herangezogen werden (Möller 2009). Um die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit stellen zu können, müssen mindestens drei durch das ICD-10 vorgeschriebene Kriterien im letzten Jahr erfüllt sein: ICD-10, F10.2: Abhängigkeitssyndrom starker Drang, Alkohol zu trinken, Craving Kontrollverlust beim Konsum (Menge, Beginn, Ende) körperliches Entzugssyndrom bei Mengenreduktion oder Abstinenz Fortführen des Substanzgebrauch trotz Folgeschäden Vernachlässigung anderen Aktivitäten und Verpflichtungen Toleranzentwicklung Tabelle 1: ICD-10 F10.2 (DIMDI 2018) Die Abhängigkeit geht mit regelmäßigem Alkoholkonsum und den daraus resultierenden körperlichen sowie psychosozialen Veränderungen einher. Der Betroffene kann dem Drang nach Alkohol (Craving) nicht widerstehen und verliert oft die Kontrolle über sein Trinkverhalten. Dies kann mit Beginn
17 oder/und dem Ende des Trinkens, aber auch dem Überblick über die Konsummenge, im Zusammenhang stehen. Durch Adaptation des Körpers an kontinuierliche Alkoholzufuhr entwickelt sich eine Toleranz, die einen Konsumanstieg nach sich zieht. Auch scheitern oft die Versuche, aufgrund ausgelöster Entzugssymptomatik, das Alkoholtrinken zu reduzieren oder zu beenden. Der Alkoholkranke setzt somit den Konsum, trotz der Kenntnis über sowohl körperliche als auch psychosoziale Folgeschäden, fort. Die dadurch bedingte Vernachlässigung des Arbeitsverhältnisses, der Kontaktpflege und anderer Interessen isolieren sich nicht selten die Betroffenen und erleiden Komorbiditäten. Laborchemische Befunde der BAK, der Leberwerte und der CDT-Wert ergänzen die Diagnosestellung. (Mann K, et al. 2016; DIMDI 2018) 2.2.3.2 Alkohol-Entzugssyndrom ICD-10, F10.3 Bei regelmäßigem Alkoholkonsum entwickelt sich eine Toleranz, die für gleiche Wirkung einen höheren Bedarf an Ethanol erfordert. Beim Abhängigen geht das oft mit kontinuierlicher Steigerung der Trinkmenge einher. Wird im Verlauf die Alkoholeinnahme reduziert oder beendet, kann das Alkoholentzugssyndrom die Folge sein. Die Symptome können Stunden bis Tage nach dem Konsumende eintreten und sind dabei vielfältig sowie individuell verschieden. Führend ist jedoch meist die internistische, vegetative und neurologische Symptomatik in Form von Tachykardie, Hypertonie, Nausea, Hyperhydrose sowie Tremor. Aber auch psychische Folgen, z. B. Angst, Unruhezustände, depressive Verstimmungen und Schlafstörungen können auftreten. Begleitend fühlen die Betroffenen oft ein starkes Verlangen, sog. „Craving“, Alkohol zu trinken. Die gefährlichsten Konsequenzen eines Alkoholentzugssyndroms können ein Krampfanfall oder das Delirium tremens sein (Möller 2009). Das Delirium tremens entspricht einem Verwirrtheitszustand, der mit optischen Halluzinationen, Tremor, Verlust der Orientierung und starken vegetativen Symptomen einhergehen kann. Alkoholabhängige haben ein erhöhtes Risiko, nach einem Krampfanfall ein Delir zu durchleben. (Mann et al. 2016; DIMDI 2018)
18
2.2.4 Folgen und Prognose der Alkoholabhängigkeit
Bei den Folgen wird zwischen den psychischen und somatischen Krankheiten
und den sozialen Problementstehungen unterschieden (Edwards 1986).
Psychische Veränderungen sind individuell verschieden und können sich in
Form von z. B. Reizbarkeit, Aggressivität, Stimmungsschwankungen,
Konzentrations- und Gedächtnisstörung, amnestischen Syndromen aber auch
als Depressionen sowie Psychosen äußern.
Die akute Wernicke-Enzephalopathie, begleitet durch Störungen des
Bewusstseins, der Orientierung, des Gangs und der Okulomotorik, gehört zu
den psychoorganischen Folgeerkrankungen und entsteht durch einen
Thiaminmangel. Beim rezidivierenden Auftreten oder bei der Chronifizierung
kann sich das Korsakow-Syndrom entwickeln. Dieses wird mit
Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses und Konfabulationen
charakterisiert.
Im Verlauf können alle Organsysteme reversible aber auch irreversible
Veränderungen davontragen. Die Auswirkungen auf den Körper können
gravierend sein und führen zur durchschnittlichen Reduktion der
Lebenserwartung um 12 Jahre.
Mögliche Folgeerkrankungen werden im Weiteren stichwortartig aufgelistet:
- Mangelernährung, Vitaminmangel und Kachexie
- Akute und chronische Gastritis und -Ösophagitis
- Erhöhte Tumorinzidenz des Gastrointestinaltraktes
- Resorptionsstörungen
- Leberzirrhose
- Pankreatitis
- Endokrine und exokrine Pankreasinsuffizienz
- Kardiomypathie
- Polyneuropathie
Bei diesem umfangreichen und lebensbedrohlichen Ausmaß an
Folgeerkrankungen ist die Therapie der Alkoholabhängigkeit von großer
Bedeutung. Jedoch liegt die Erfolgsquote einer Abstinenz nur bei 15 % und
folglich die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall bei 85 %. (Möller 2009).19
2.2.5 Therapie der Alkoholabhängigkeit
Ein Teil der qualifizierten Entzugsbehandlung ist die körperliche Entgiftung
(QE). Hierzu werden die Behandlungen der Intoxikation, der
Folgeerkrankungen, der Entzugssymptomatik, aber auch Sicherstellung der
Vitalfunktionen und Vermeidung der Komplikationen im Entzug angerechnet.
Die QE beinhaltet auch einen psychosozialen Ansatz und schafft Stabilität für
die Abstinenz. Es sollen einerseits Betroffene zum Verändern motiviert,
andererseits Patienten an soziale, regionale Hilfsorganisationen angebunden
werden. Daneben finden die multidisziplinäre Behandlung der psychischen
und somatischen Folgeschäden, die medikamentöse Therapie und die
detaillierte Diagnostik der Ätiologie und der Multimorbidität der QE statt.
In der medikamentösen Behandlung des Alkoholentzuges muss die Stärke der
Symptomatik unterschieden werden. Leichte bis mittelschwere kann, schwere
Entzugssymptomatik muss hingegen medikamentös behandelt werden.
Abbildung 3: Pharmakotherapie des akute Alkoholsyndroms (Mann et al. 2016)
Bei leichtem bis mittelschweren Alkoholentzug können, bei Epilepsie in der
Anamnese sollten Antikonvulsiva, z. B. Carbamazepin, Valproatsäure,
Gabapentin, Oxcarbazepin, eingesetzt werden. Zur Krampfanfallprophylaxe ist
v. a. das Carbamazepin, das Mittel erster Wahl. Sowohl Benzodiazepine als
auch das Clomethiazol senken die Schwere und Häufigkeit der
Entzugssymptomatik. Die genannten Medikamente finden in Kombination mit20 Neuroleptika, z. B. dem Haloperidol, auch beim Delir ihren Einsatz. Die Behandlung vegetativer Begleitsymptomatik während des Entzugs kann mit Beta-Blockern oder Clonidin erfolgen. Entgleisungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes werden mittels Infusions- und Substitutionstherapie ausgeglichen. Bei länger bestehender Alkoholabhängigkeit ist eine Vitaminsubstitution, z. B. von Thiamin, notwendig. Zur Langzeit-Rezidivprophylaxe der Entzugssymptomatik finden meist Acamprosat, Naltrexon und Disulfiram Anwendung, was besonders dem „Craving“ entgegenwirken soll. Neben der medikamentösen Therapie stehen dem Patienten nach erfolgreichem QE mehrere Möglichkeiten der Anschlussbehandlung zur Verfügung. Es werden ambulante, ganztägig ambulante, teilstationäre und stationäre Interventionen angeboten. Es besteht die Möglichkeit einer ambulanten Weiterbetreuung in z. B. ambulanten Langzeit-Intensivtherapien für Alkoholkranke (ALITA) und integrativem ambulantem Kurzzeitbe- handlungsprogramm (IAK). Selbsthilfegruppen der „Anonymen Alkoholiker“ dienen der Krankheitsbewältigung, dem Erfahrungsaustausch Betroffener und erhalten therapeutische Wirkung. Neben der ambulanten Betreuung kann eine stationäre Langzeitbehandlung in einer Suchtklinik wie zum Beispiel in der psychiatrischen Klinik in Engelthal für mehrere Monate stattfinden (Mann et al. 2016).
21 2.3 Orexin 2.3.1 Entdeckung des Orexins Im Jahre 1998 erfolgte zum ersten Mal die Beschreibung eines neuen, im zentralen Nervensystem produzierten Botenstoffes. Das translatierte Produkt wurde in Neuronen des Lateralen Hypothalamus gespeichert. Das entdeckte Protein zeigte Ähnlichkeiten im Aufbau zur bereits bekannten Hormonfamilie, der Incretine. Diese beiden Tatsachen stellten die entscheidenden Kriterien zur Namensgebung des neu entdeckten Hormons Hypocretin dar. Dabei beinhaltet der erste Wortteil die Lokalisation der sezernierenden Neurone, den HYPOthalamus, der zweite die Grundstruktur des InCRETINs (de Lecea, Kilduff et al. 1998). Zeitgleich entdeckte eine andere Forschergruppe ebenfalls ein neues Neuropeptid. Die Sekretion des Transmitters konnte wiederum im lateralen Hypothalamus, aber auch in fornixnahen Regionen detektiert werden. Mäuse mit Läsionen in diesen Bereichen wiesen ein reduziertes Fressverhalten sowie einen Gewichtsverlust auf. Das Hormon habe einen Einfluss auf die zentrale Regulation der Nahrungsaufnahme und somit auf den Energiehaushalt. Entsprechend seiner Wirkung wurde Orexin nach dem griechischen Begriff für Appetit, „Orexis“, benannt (Sakurai, Amemiya et al. 1998). Erst später fand man heraus, dass beide zur gleichen Zeit beschriebenen Proteine identisch waren. Aus heutiger Sicht spiegeln beide Namen Hypocretin und Orexin die gleiche Aminosäuresequenz wider und werden simultan verwendet. 2.3.2 Struktur des Orexins Bei weiteren Betrachtungen des Neurotransmitters konnten zwei verschiedene Strukturformen festgestellt werden. Beide Orexine werden aus einer Vorstufe, dem Pre-pro-Orexin proteolytisch heraus gespalten. Dieses besteht aus einer 131 kb langen Promotorregion, zwei Exons und einem Intron (Sakurai, Moriguchi et al. 1999). Diese genetische Information ist auf dem 17q21-Chromosom gespeichert. Das Orexin A ist ein 33- und das Orexin B ein 28-Aminosäure (AS) langes Peptid. Die strukturell wichtige Eigenschaft des größeren Moleküls liegt in der
22
zweifachen Bisulfitierung der beiden α-Helices zwischen den Cysteinresten 6-
12 sowie 7-14 und sind in Abbildung fünf dargestellt (Sakurai, Amemiya et al.
1998; Kim, Hong et al. 2004). Orexin B ähnelt stattdessen in seiner
Dreidimensionalität anderen Neuropeptiden, so z. B. dem Neuropeptid Y.
Aufgrund der unterschiedlichen Peptidstruktur ist das Orexin A lipophiler und
kann im Gegensatz zum Orexin B die Blut-Hirn-Schranke passieren (Kastin,
Akerstrom 1999).
Beide steuern durch Bindung an Ox-Rezeptoren über verschiedene
Transduktionskaskaden eine Vielzahl von Zellprozessen.
Abbildung 4: Orexin und -Rezeptoren in Anlehnung an Tsujino und Sakurai 2013.
2.3.3 Orexinrezeptoren
Die Wirkung des Hypocretins auf Zellen erfolgt über Rezeptorbindung. Für
Ox1R weist das Orexin A eine höhere Affinität auf. Vom Ox2R wird das Orexin
selektiv gebunden und beide Varianten zeigen vergleichbare Affinität (Sakurai,
Amemiya et al. 1998). Während Ox2R eher die gleichen Strukturmerkmale der
beiden Neurotransmitter erkennt, scheint der Ox1R die komplexeren Merkmale
des Orexin A in der Bindungsstelle zu erfassen.
Sowohl Ox1R als auch Ox2R gehören der Familie der G-Protein gekoppelten
Rezeptoren an (de Lecea, Kilduff et al. 1998; Kim, Hong et al. 2004).23
2.3.3.1 Vorkommen der Orexinproduzierenden Neurone und -bindenden
Rezeptoren
Der Hauptort der Orexinproduktion begrenzt sich auf den lateralen und
posterioren Hypothalamus. Einige orexinhaltige Neurone konnten auch in der
Aria perifornica detektiert werden (de Lecea, Kilduff et al. 1998; Sakurai
Amemiya et al. 1998; Culter et al. 1999). Das menschliche Gehirn besitzt
70.000 Orexinneurone, deutlich mehr im Vergleich zum Rattencerebrum mit
circa 3000 Nervenzellen (Peyron, Tighe et al. 1998).
Die Nervenfasern erstrecken sich weitläufig im gesamten Gehirn (siehe
Abbildung 5). Die stärksten Projektionen wurden zum paraventrikulären
Thalamuskern, dem Nucleus arcuatus des Hypothalamus, dem
tubulomammillaren Kern, dem Locus coeruleus und den Raphe Kernen
nachgewiesen (Peyron, Tighe et al. 1998).
Abbildung 5: Projektion der Orexinneurone in Anlehnung an Tsujino N., Sakurai T. 2013.
Dabei soll die Stärke der Pfeile die vermehrte Projektion wiedergeben. Abkürzungen:
tuberomammillary nucleus (TMN); locus coeruleus (LC); laterodorsal tegmental nucleus
(LDT); pedunculopontine nucleus (PPT); Subfornicale Organ (SFO).
Entsprechend der zahlreichen Projektionen der Orexin Nervenfasern im
gesamten ZNS ist auch das Vorkommen der OxR weitreichend. Orexin A
entfaltet seine Wirkung über die Ox1R im Hippocampus, in den Raphe Kernen,
im Locus coereleus, im Induseum griseum, in der Amygdala, in der Stria
terminalis, in der Tenia tectorium, im präfrontalen, aber auch infralimbischem
Cortex und im verntralem sowie laterodorsalem Tegmentum.
Ox2R wird dagegen auf Neuronen des olfaktorischen Bündels, Hypophyse, der24 Lamina IV des Cortex, des Nucleus accumbens, der prätektalen Kerne des dorsomedialen Hypothalamus exprimiert. Nervenzellen der Paraventrikulären Kerne des Thalamus tragen hingegen beide Arten der Rezeptoren auf ihrer Oberfläche (Trivedi, Yu et al. 1998). Aber auch im peripheren Gewebe der Nebennieren, Nieren, Gonaden, Jejunum und Lunge werden in unterschiedlichen Konzentrationen die OxR nachgewiesen (Culter et al. 1999, Jöhren et al. 2001). Durch das umfangreiche Vorkommen der orexinhaltigen Nervenfasern und OxR wird der Einfluss sowohl auf das zentrale als auch autonome Nervensystem ersichtlich. 2.3.3.2 Interaktion der Orexinproduzierenden Neurone Orexinneurone projizieren in sehr viele Hirnareale. Hierzu gehören u. a. der ventrolaterale, präoptische Kern (VLP), basale Frontallappen (BF), posteriorere sowie dorsomediale Hypothalamus und ventrales Tegmentum (VT). Die Orexinneuronen enthalten aber auch Afferenzen, die als Zentrum der Emotionen definiert sind. Zu diesen zählen die Amygdala, der infralimbische Cortex, der Nucleus accumbens und die Stria terminalis (Sakurai T., Nagata R., Yamanaka A., et al. 2005). Die hormonproduzierenden Zellen, die an der Gewichtsregulation beteiligt sind, interagieren miteinander. Demzufolge werden die Orexinzellen auch durch Nervenfasern des Neuropeptid-Y-, des Agouti related Peptid- und den Melanin stimulierenden Hormonzellen – innerviert (Broberger, De Lecea et al. 1998). In vielen verschiedenen Studien gelang es bereits, die Wechselwirkungen anderer Transmitter und der Orexinneurone nachzuweisen. Orexin ist an einer Vielzahl von Prozessen beteiligt. Die einzelnen Funktionen und die Zusammenhänge sind sehr komplex und noch nicht bis ins Detail erforscht.
25 2.3.4 Funktionen des Orexins Orexin ist ein Peptid, welches an der Regulation des Schlaf-Wachrhythmus, des kardiovaskulären Systems, des autonomen Nervensystems und der Appetitregulation beteiligt ist. Dies wurde in unterschiedlichen Ansätzen vieler Studien bereits belegt. Die folgende Abbildung 6 spiegelt schematisch die Interaktion des Orexins in Bezug auf genannte Funktionen wieder. Abbildung 6: Interaktion der Orexinneurone mit anderen Gehirnarealen, Transmittern und Faktoren angelehnt an Tsujino N, Sakurai T. 2013 Die unterbrochenen Linien stellen den inhibierenden und die durchgezogenen den induzierenden Charaktereinfluss des entsprechenden Faktors dar. Verwendete Abkürzungen: laterale Hypothalamus (LH), posteriore Hypothalamus (PH), bed nucleus der Stria terminalis (BST), ventrolaterale preoptische Bereich (VLPO), locus ceruleus (LC), dorsale Raphe-Kerne (DR), tuberomammillare Nucleus (TMN), laterodorsale tegmentale Nucleus (LDT), pedunculopontine tegmentale Kern (PPT), ventrale Tegmentum (VT), suprachiasmatische Nucleus (SCN), dorsomedial Hypothalamus (DMH), arcuate nucleus Arc. 2.3.4.1 Schlaf-Wach-Rhythmus Die Aktivität monoaminerger Neurone des Hypothalamus, Hirnstamms, tuberomammillaren Nucleus, Locus ceruleus und der dorsalen Raphe-Kerne bedingen den Wachzustand. An genannten Lokalisationen induziert Orexin die
26
zentrale Sekretion von Serototin, Noradrenalin, Dopamin, Histamin und
Acetylcholin. Im Gegenzug werden die Orexinneurone über eine negative
Rückkopplung durch diese Neurotransmitter zum Teil wieder inhibiert. Orexin
ist somit an der Aufrechterhaltung des Wachzustandes beteiligt und hält diesen
solange aufrecht, bis der Schlafensdruck die Orexinwirkung übersteigt (Carter
et al. 2009; Gallopin et al. 2000).
Orexinneurone erhalten die Informationen aus dem suprachiasmatischen Kern
(SCN) und unterliegen folglich dem zirkadianen Rhythmus. (Sakurai et al.
2005).
Auch wenn Orexin während des Schlafs in seiner Funktion supprimiert wird,
übernimmt es wiederum die entscheidende Funktion im Aufwachprozess.
Denn in Tierstudien konnte durch Photostimulation der Orexinneurone der
Übergang aus dem Schlaf- in den Wachzustand provoziert werden
(Adamantidis et al. 2007). Die simultane Lichtstimulation der LC-Neurone
erhöhte signifikant die Wahrscheinlichkeit und trug zum Weck-Mechanismus
aus der NREM-Schlafphase bei (Carter et al. 2009). Orexin scheint folglich im
Weckprozess eine große Bedeutung zu haben.
Die Unfähigkeit wach zu bleiben und somit häufige Wechsel zwischen dem
Wach- und Schlafzustand sowie plötzliches Eintreten in die REM- oder NREM-
Schlafphase, charakterisiert die Erkrankung der Narkolepsie. In Studien
zeigten sich bei Ratten mit Läsionen im lateralen Hypothalamus, die somit ein
Defizit an hypocretinhaltigen Neuronen aufwiesen, deutliche Veränderungen
der Schlafphasen (Chemelli, Willie et al. 1999; Gerashchenko, Kohls et al.
2001; Salin-Pascual, Gerashchenko et al. 2001).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Hypocretin eine besondere
Stellung bei der Regulation und Stabilisierung des Schlaf-Wach-Rhythmus
einnimmt.
2.3.4.2 Funktion des Orexins auf das autonome Nervensystem und während
der Stressreaktion
Emotionaler und Psychischer Stress kann Orexinneurone aktivieren. Mögliche
Stressoren können Fremdeindringen, Entzug von Nahrung, Kälte oder
Immobilisation sein (Sakurai et al. 1998; Salin-Pascual et al. 2001). Das27 Orexin ist an autonomer Stressreaktion beteiligt und wirkt folglich sympathikomimetisch. Es beeinflusst neben Blutdruck und Herzfrequenz, die Atmung, Körpertemperatur und den Stoffwechsel (Lubkin et al. 1998; Williams et al. 2007; Tupone et al. 2011). CRH-Neurone enthalten Orexinafferenzen, die zur Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse beitragen. Aus diesem Grund führten Orexininjektionen zum Anstieg der Cortison-Plasmaspiegel bei Mäusen (Hagan et al. 1999, Winsky-Sommerer et al. 2004). Hypocretin wird durch die Zentren der Stressregulation u. a. dem limbischen System, der Amygdala sowie dem BST innerviert. Bei Patienten mit Panikstörungen konnte ein Anstieg der Orexinkonzentration im Liquor festgestellt werden (Johnson et al. 2010). Demgegenüber blieb die Stressantwort in Form von Aktivierung des kardiorespiratorischen Systems und der Bewegung, bei Mäusen mit Orexin-Mangel aus (Kayaba et al. 2003; Kuwaki 2011). Dem Orexin wurde bereits nach der Entdeckung ein sympatomimetischer Effekt zugeschrieben. Die intracerbrale Injektion von Hypocretin führte zur Steigerung des Blutdruckes und der Herzfrequenz in Tiermodellen (Shirasaka T et al. 1999, Xiao F, Jiang M et al. 2013). Im Umkehrschluss wurde bei Mäusen mit salzinduzierter Hypertension vermehrte Orexinaktivität verzeichnet, die wiederum durch Rezeptorblocker antagonisiert und sukzessive der Blutdruck gesenkt werden konnte (Huber, Fan et al. 2017). Die zentrale Applikation des nicht selektiven Orexinrezeptor-Antagonisten Almorexant, bei hypertensiven Mäusen hatte eine signifikante Reduktion des Blutdrucks zur Folge (Jackson, Dampney et al. 2016). Sowohl intragastrale als auch intraperitoneale Applikation von selektiven OX2R-Blockern senkte nur den Blutdruck. Die Antagonisierung des Ox1R reduzierte zudem noch die Herzfrequenz (Beig et al. 2015; Huang et al. 2010). Ein hoher Stellenwert kommt dem Orexin auch bei der Atemregulation zu. Die Hypocretinneurone werden durch Übersäuerung der Zellen oder Anstieg der Kohledioxidkonzentration zur Produktion angeregt (Williams RH et al. 2007). Durch Antagonisierung mit Rezeptorblockern wurde in Tierstudien eine schwächere Reaktion auf Hypoxie und Hyperkapnie verzeichnet. Dies führte zur Abnahme sowohl des Atemvolumens als auch der Atemfrequenz
28 (Fonseca et al. 2016). Das Orexin beeinflusst des Weiteren die zentrale Thermoregulation des braunen Fettgewebes (BAT) (Tupone, D. et al. 2011). Summativ stimuliert Orexin das sympathische Nervensystem und reguliert den Energieverbrauch. Aus den aufgeführten Studien geht klar hervor, dass Orexin eine wichtige Rolle sowohl bei der Herz-Kreislaufregulation als auch Stressreaktion einnimmt. Somit liegt eine Funktion des Orexins auch im Alkoholentzug als Sonderform einer Stressreaktion mit Dysregulation des autonomen Nervensystems nahe. 2.3.4.3 Appetitregulation Orexin wirkt als Transmitter sowohl im ZNS als auch peripher an Organen und einzelnen Geweben. Dabei sind die Funktionsweise und die multifaktoriellen Interaktionen dieses Proteins bisher nicht ins Detail verstanden und erforscht. Der laterale Hypothalamus ist als Zentrum des Essverhaltens bekannt, sodass der Nachweis von Orexinneuronen an dieser Stelle auf die Appetitregulation des Proteins schließen ließ (Sakurai et al. 1998; Edwards et al.1999). Der Einfluss auf die Gewichtsregulation wurde bereits bei der Entdeckung beschrieben und das Orexin nach dem Appetit (griech. Orexis) benannt (Sakurai, Amemiya et al. 1998). Nager mit Läsionen im LH und denen intracisternal Orexin-Antikörper injiziert wurden, zeigten nicht nur vermindertes Fressverhalten, sondern auch einen herabgesetzten Sättigungspunkt und folglich eine Gewichtsabnahme (Sakurai, Amemiya et al. 1998; von der Goltz et al. 2010; Yamada, Okumura et al. 2000). Einen Anstieg der Nahrungsaufnahme konnte hingegen nach Beimpfen perifornicaler, lateraler, dorsomedialer, periventrikulärer Kerne des Hypothalamus, des Nucleus accumbens und der tegmentalen Region mit dem Hypocretin beobachtet werden (Lubkin, Stricker-Krongrad 1998; Ida, Nakahara et al. 1999; Sweet, Levine et al. 1999; Kotz, Teske et al. 2002; Thorpe, Kotz 2005). Während der zentrale Orexin A-Bolus in der Cisternenregion appetitanregend wirkt und die Produktion des Magensaftes steigert, bedingt eine Applikation direkt ins Peritoneum diesen Effekt nicht (Takahashi, Okumura et al. 1999).
Sie können auch lesen