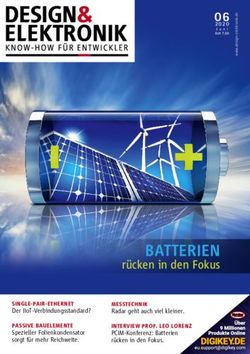Rentenpolitik ist mehr als Mathematik - Der Chefökonom - 11. Juni 2021 - Handelsblatt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der Chefökonom – 11. Juni 2021 Rentenpolitik ist mehr als Mathematik Eine sichere Rente ist möglich, doch der Preis dafür ist exorbitant hoch. Ein Ausweg wäre, das System der gesetzlichen Rente mehr auf Armutsvermeidung zu fokussieren und die Ansprüche von Gutverdienern zu begrenzen. von Professor Bert Rürup Das Grundprinzip der gesetzlichen Rentenversicherung ist einfach: Wer in einem Jahr viel Geld in die Versicherung zahlt, der bekommt dafür eine höhere Rente als jemand, der im gleichen Jahr weniger Beiträge einzahlt. Die jährlich erworbenen Ansprüche werden aufaddiert und ergeben so den lebenslangen Rentenanspruch. Die Idee hinter diesem 1957 etablierten Äquivalenzprinzip ist, dass der am Lohn gemessene soziale Status während der Erwerbsphase auch im Rentenalter beibehalten wird. Soziale Umverteilung innerhalb des Systems ist nicht beabsichtigt. Dieses in Deutschland einer Monstranz gleich hochgehaltene Prinzip ist den meisten OECD-Staaten nicht vermittelbar, da dort niedrige Renten wie selbstverständlich aufgestockt werden. Nun steht Deutschland kurz vor dem Beginn eines massiven, fast zwanzig Jahre anhaltenden Alterungsschubs, der - wenn nicht gegengesteuert wird - das Rentensystem an den Rand des Zusammenbruchs bringen könnte. Derzeit fließt bereits etwa ein Viertel des Bundeshaushalts in die gesetzliche Rentenversicherung, 2040 dürften es 44 und 2060 gar 55 Prozent sein, wie der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium in seinem Anfang dieser Woche erschienenen Gutachten eindrucksvoll vorgerechnet hat. Ein Grund für die sich abzeichnende Schieflage des Systems sind die von der amtierenden Regierung Ende 2018 eingezogenen "Haltelinien", nach denen der Beitrag nicht über 20 Prozent und das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinken darf. Zwar gelten diese Haltelinien zunächst nur bis 2025, doch gibt es gewichtige politische Stimmen, die fordern, sie dauerhaft festzuschreiben. Diese Zahlen machen deutlich, dass die Zeit reif für eine umfassende Rentenreform ist - zumal die letzten beiden Bundesregierungen durch ihre markanten, vorrangig klientelspezifischen Leistungsausweitungen alle früheren Bemühungen zur Erhöhung der finanzwirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Rentenversicherung konterkariert haben.
Letztlich gibt es vier Stellschrauben, die für eine Reform justiert werden können: Renteneintrittsalter, Rentenniveau, Rentenbeitrag und Bundeszuschuss. Eine nachhaltige Stabilisierung der gesetzlichen Rente durch eine Ausweitung des Versichertenkreises ist Augenwischerei. Denn aus den dann höheren Beiträgen erwachsen mit zeitlicher Verzögerung stets höhere Leistungsansprüche. Optimale Lösungen gibt es nicht; jedes Drehen an einer Stellschraube hat Verteilungswirkungen, die letztlich nur politisch entschieden werden können. Soziale Gerechtigkeit kann in einer Demokratie mit wechselnden politischen Mehrheiten nie etwas anderes sein als die Diagonale eines sich im Zeitverlauf ändernden Parallelogramms der gesellschaftlichen Kräfte. Rentenpolitik ist nun einmal mehr als Mathematik. Kopplung von Rentenalter und Lebenserwartung? Der Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium schlägt vor, das gesetzliche Rentenalter regelgebunden mit der Lebenserwartung zu verknüpfen und mit der Lebenserwartung ansteigen zu lassen: bis 2040 auf 67,8 Jahre und bis 2050 auf 68,6 Jahre. Leben die Versicherten im Schnitt ein Jahr länger, sollen davon acht Monate in Erwerbstätigkeit und vier Monate im Ruhestand verbracht werden - ein Werturteil, das man teilen kann, aber nicht teilen muss. Derzeit scheidet diese Option wegen mangelnder Akzeptanz in der Bevölkerung aus. So ist denn auch neben der FDP keine Partei in Sicht, die sich diese Forderung vieler Ökonomen zu eigen macht. Sind nun aber zudem zwei weitere Schrauben durch "Haltelinien" blockiert, droht das System in der Tat zu kollabieren. Der einzige Ausweg sind dann immer höhere Zuschüsse aus Steuermitteln, wodurch der Bund früher oder später seiner Handlungsfähigkeit beraubt und womöglich das Bundesverfassungsgericht einschreiten würde, da es die Budgethoheit des Parlaments in Gefahr sähe. Erschwerend hinzu kommt, dass zwar heute das Risiko von Altersarmut sehr gering ist, in Zukunft aber - vor allem in Ostdeutschland - deutlich steigen wird. Zudem führt die politisch gewünschte steigende Akademisierung der Gesellschaft dazu, dass immer größere Bevölkerungsteile keine Chance haben, auf die bei der Rentenberechnung unterstellten 45 Versicherungsjahre zu kommen. Hinzu kommt, dass bei vielen Berufstätigen, etwa in den immer wichtiger werdenden Pflegeberufen, die körperlichen Belastungen einer weiteren Erhöhung des Renteneintrittsalters entgegenstehen. Strukturwandel und Digitalisierung werden überdies dazu führen, dass Erwerbsbiografien öfter unterbrochen werden, weil sich Zeiten von abhängiger Beschäftigung und Selbstständigkeit abwechseln. Das rentenpolitische Leitbild des 20. Jahrhunderts, der lebenslange Industriearbeiter, wird im 21. Jahrhundert immer seltener der Realität entsprechen. Dies bedeutet freilich nicht, dass Altersarmut ein Massenphänomen zu werden droht. Weite Teile der Mittelschicht werden neben der gesetzlichen Rente betriebliche Versorgungsansprüche erworben 2
oder privat vorgesorgt haben. Nach einer Analyse im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung wird die Armutsrisikoquote der über 66-Jährigen von etwa 16 Prozent in den Jahren 2015 bis 2020 auf 20 Prozent in der zweiten Hälfte der 2030er-Jahre zunehmen. Die Grundsicherungsquote steigt in diesem Zeitraum von rund 5,5 auf etwa sieben Prozent. Weit mehr als 90 Prozent der Älteren werden also auch dann nicht auf staatliche Fürsorge angewiesen sein, selbst wenn - als ein fernes Echo der Wiedervereinigung - die Quoten in Ostdeutschland merklich höher als im Westen sein werden. Die heilige Kuh der Rentenpolitik auf der Schlachtbank Wollte man diese Zunahme der Altersarmut innerhalb des bestehenden Systems der gesetzlichen Rentenversicherung lösen, müsste man das Rentenniveau für alle deutlich anheben. Das aber wäre ähnlich treffsicher, wie Grundsicherungsempfänger durch eine allgemeine Mehrwertsteuersenkung entlasten zu wollen. Ein höheres Rentenniveau wäre exorbitant teuer und würde massive Beitrags- oder Steuererhöhungen erfordern. Daher gilt es, Wege zu suchen, die Rentenversicherung sowohl finanziell nachhaltiger als auch armutsfester zu machen und damit die Akzeptanz des Systems zu erhöhen. Und so ist es richtig, dass der Wissenschaftliche Beirat eine Abkehr vom Äquivalenzprinzip ins Spiel bringt und damit fast beiläufig eine heilige Kuh der deutschen Rentenpolitik zur Schlachtbank führt. Nach diesem "Degressiv-Modell" würden die Rentenansprüche mit steigendem Erwerbseinkommen immer langsamer steigen. Wer sein Leben lang stets das Doppelte des Durchschnittseinkommens verdient, bekäme dann nicht eine doppelt so hohe Rente wie ein Durchschnittsverdiener, sondern deutlich weniger. So könnten bei gegebenen Einnahmen kleine Renten überproportional erhöht werden - ganz so, wie dies in der Mehrzahl der Industrieländer heute schon der Fall ist. Kann Österreich ein Vorbild sein? Einen in der Wirkung ähnlichen, aber intelligenteren Weg hat Österreich gewählt. Hier ist das Rentenniveau für alle Neurentner zunächst deutlich höher als in Deutschland. Allerdings steigen die Renten dann nicht wie bei uns entsprechend der Lohnentwicklung, sondern werden lediglich entsprechend der meist geringeren Inflationsrate angepasst. Relativ begünstigt werden dadurch jene, die vergleichsweise nur für eine kurze Zeit Rente beziehen, also relativ früh sterben. Nun haben Menschen mit niedrigem Einkommen statistisch eine geringere Lebenserwartung als Menschen mit hohem Einkommen. Die Rentenversicherung ist also heute vor allem für die bessergestellten Langlebigen ein gutes Geschäft. Die österreichische Rentenanpassungsregel korrigiert im Ergebnis diese regressive Wirkung, und die Anzahl der 3
Armutsgefährdeten sinkt. Der hinzunehmende Preis dafür ist, dass ausnahmsweise sehr Langlebige mit niedrigen Einkommen von den allgemeinen Wohlstandssteigerungen abgekoppelt werden und damit Gefahr laufen, im hohen Alter in die Grundsicherung abzurutschen. Nun ist Rentenpolitik mehr als Statistik und muss daher nicht nur die begrenzten finanziellen Möglichkeiten zur Kenntnis nehmen, sondern auch nach zielgenauen Alternativen suchen und zudem die Ängste der Menschen berücksichtigen. Dabei kann man von anderen Staaten lernen, als Hauptaufgabe eines Rentensystems dessen Armutsfestigkeit zu akzeptieren. Ein hohes Rentenniveau beim Start in den Ruhestand kann sich fast selbst finanzieren, wenn es im Verlauf des individuellen Rentenbezugs relativ schnell fällt. Den Beziehern niedrigerer Einkommen wäre damit wesentlich besser geholfen als mit der neuen, wenig zielgenauen Grundrente, die viele besonders von Armut Gefährdete ausklammert. Doch je größer die Versprechen im Wahlkampf sind, desto enttäuschter werden die Wähler sein, wenn in der nächsten Legislaturperiode die Leistungen nicht nur nicht ausgeweitet werden, sondern im Interesse finanzieller Nachhaltigkeit sogar beschnitten werden müssen. Man mag zwar darauf hoffen, dass wie 2009 einer tiefen Krise ein gesamtwirtschaftlich goldenes Jahrzehnt folgen und es scheinbar Geld vom Himmel regnen wird. Doch Grund zu dieser Hoffnung gibt es angesichts der Alterung und des sinkenden Potenzialwachstums definitiv nicht. Nichtstun ist keine Option; die nächste Regierung wird daher um eine sehr weitreichende Rentenreform nicht herumkommen. Die Früchte des langen und beschäftigungsintensiven Aufschwungs des letzten Jahrzehnts sind längst verteilt. Die Zeit drängt, sich endlich diesen Realitäten zu stellen. 4
Alterssicherung Laschet und Habeck lehnen Rente mit 68 ab Die Debatte über ein höheres Rentenalter ist in vollem Gange. Doch im Wahlkampf lässt sich damit schlecht punkten. Manchmal bedarf es des sprichwörtlichen Tropfens, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Wirtschaftsministerium, das "schockartig steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025" heraufbeschwor, war so ein Tropfen. Seither wird hitzig über die Zukunftsfestigkeit der Rentenfinanzen diskutiert - und das Renteneintrittsalter. Der Beirat empfiehlt, es an die steigende Lebenserwartung anzupassen, sodass etwa im Jahr 2042 die Rente mit 68 erreicht wäre. Kein populäres Thema für Wahlkämpfer. Die Rente mit 68 sei "ein Vorschlag eines wissenschaftlichen Gremiums", sagte CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet auf dem GovTech-Gipfel des Handelsblatts. "Ich sehe nicht, dass das jetzt umgesetzt wird." Natürlich werde man irgendwann möglicherweise auch über eine Veränderung der Lebensarbeitszeit nachdenken müssen. Aber jetzt gehe es zunächst darum, die Rente mit 67 umzusetzen, die 2031 erreicht wird. Auch Grünen-Chef Robert Habeck warnte bei der Handelsblatt-Veranstaltung vor einer "polemischen Debatte" über ein höheres Rentenalter. "Es ist kein Tabu für mich, darüber zu reden, aber im Wahlkampf rate ich davon ab." Der Fokus auf die Rente mit 68 verstelle den Blick auf andere Lösungen. Einfangen lässt sich die Debatte aber nicht so schnell wieder. Das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) bringt in einem neuen Kurzbericht gar die Rente mit 70 ins Spiel, um den Beitragssatzanstieg zu bremsen und das Sicherungsniveau zu stabilisieren. Nach geltendem Recht würde in der IW-Simulation der Rentenbeitrag bis 2060 auf 23,6 Prozent steigen und das Rentenniveau auf 44,4 Prozent sinken. Wird dagegen die erwartete Steigerung der Lebenserwartung im Verhältnis 2:1 auf das Erwerbsleben und die Rentenphase aufgeteilt, wäre ab dem Jahr 2052 die Rente mit 70 erreicht. Der 7
Beitragssatz stiege dann bis 2040 auf 21,4 Prozent und bliebe danach bis 2060 annähernd konstant bei 21,3 Prozent. Das Rentenniveau läge 2060 dann noch bei 45,6 Prozent. Damit könnten die bis 2030 definierten Haltelinien" von maximal 22 Prozent Beitragssatz und mindestens 43 Prozent Sicherungsniveau "dauerhaft unterschritten beziehungsweise übertroffen werden", schreibt IW-Forscher Jochen Pimpertz. Grüne und SPD werben im Wahlkampf mit einer dauerhaften Stabilisierung des Rentenniveaus bei mindestens 48 Prozent. Finanziert werden soll das dadurch, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu bringen und die Einnahmebasis der Rentenversicherung durch die Einbeziehung aller Erwerbstätigen zu verbreitern. Olaf Scholz: "Horrorszenarien" SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte den Beratern von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) denn auch vorgeworfen, "Horrorszenarien" an die Wand zu malen, "mit denen Rentenkürzungen begründet werden sollen, für die es keinen Anlass gibt". Auch Altmaier hatte sich die Vorschläge seines Beratergremiums nicht zu eigen gemacht. "Die Minister Altmaier und Scholz machen sich grober Wirklichkeitsverweigerung schuldig, wenn sie den Verschleiß des Rentensystems nicht endlich angehen", kritisiert Sarna Röser, Bundesvorsitzende des Wirtschaftsverbands Die Jungen Unternehmer. Wer nichts tue, nehme in Kauf, dass die junge Generation immer weiter und stärker belastet werde. Dabei habe das Bundesverfassungsgericht in seinem Klimaurteil gerade erst mehr Generationengerechtigkeit angemahnt. Altmaiers Beirat hatte errechnet, dass ohne Änderung des Eintrittsalters 2060 deutlich mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts als Zuschuss in die Rentenkasse fließen müsste, um einen Beitrag von maximal 20 Prozent und ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent finanzieren zu können. In ihrem "Wahlprogramm" mit Forderungen an die Parteien machen sich die Jungen Unternehmer dafür stark, das Geld lieber für dringende Zukunftsaufgaben aufzuwenden, statt den "Nanny-Staat" zu verfestigen. D. Delhaes, S. Kersting, F. Specht 8
Sie können auch lesen