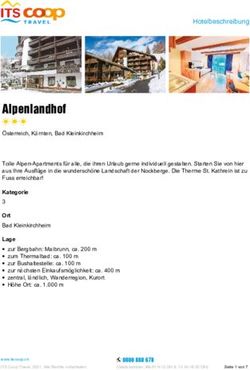Rentenproblematik der Schweiz - 7 unangenehme Fakten - Merkblatt Rentenproblematik der Schweiz
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Rentenproblematik der Schweiz
1. Die 2. Säule spielt vor allem für die höheren Einkommensklassen eine wichtige Rolle
Je höher das Durchschnittseinkommen, desto grösser der Anteil der 2. Säule am Bruttoeinkommen.
Bei Durchschnittseinkommen im ersten Quantil (= unterste 20% der Einkommensverteilung) ist die
AHV mit 80% fast die einzige Quelle für die Altersrente. Im 4. und 5. Quantil (= oberste 40% der Ein-
kommensverteilung) machen die Beiträge aus der 2. Säule jeweils über 40% aus.
2% 3% 3% 2% 3% 3%
100%
4% 5% 7%
90% 7%
5% 4% 13%
4% 3%
9% 23%
80% 4%
20%
70% 4%
32%
43%
60% 35%
50%
43%
80%
40%
68%
30% 54%
44% 45%
20%
10% 27%
0%
1. Quintil 2. Quintil 3. Quintil 4. Quintil 5. Quintil Durchschnitt Grafik1
Die 2. Säule spielt als Pfeiler der Altersvorsorge für die oberen Einkommensklassen in Hinsicht auf das
Verhältnis eine zentrale Rolle. Rentenkürzungen würden sich insbesondere auf Rentenbezüger im 5.
Quantil direkt auf jene Einkommensquelle auswirken, die im Durchschnitt am meisten zum Brutto-
einkommen der Rentnerhaushalte beiträgt.
2. Die Demografie hat eine enorme Wirkung
Das BVG-Obligatorium wurde 1985 eingeführt. In den über 30 Jahren seit dieser Einführung hat sich
das Umfeld, in dem die Schweizer Pensionskassen operieren müssen, drastisch verändert. Die Demo-
grafie spielt dabei eine der zentralsten Rollen. Denn die Schweizer Bevölkerung wird immer älter, und
zwar massiv. Die Restlebenserwartung mit 65 Jahren ist seit 1985 bei Männern um knapp 5 Jahre an-
gestiegen. Bei Frauen um 3.6 Jahre.²
1 Vgl. Berufliche Vorsorge: Kapital oder Rente? – Credit Suisse, August 2018.
² Quelle: Bundesamt für Statistik 2/6+ 5 Jahre
+ 3.6 Jahre
Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, wurde der Umwandlungssatz 2004 von 7.2% auf 6.8% ge-
senkt sowie das Frauenrentenalter von 62 auf 64 Jahre erhöht. Diese Massnahmen tragen der Ent-
wicklung aber ungenügend Rechnung.
3. Die aktuellen Umverteilungen sind systemfremd
Das angesparte Alterskapital der Versicherten reicht nicht mehr für die gesamte Rentenbezugsdauer
aus. Die Differenz muss vom Kollektiv finanziert werden. Diese Umverteilungen sind im System nicht
vorgesehen. Sie entstehen, wenn die Lebenserwartung von Neurentnern unterschätzt und der Um-
wandlungssatz dementsprechend zu hoch angesetzt wird.
2017: CHF 7.1 Millarden
Aktuell werden rund 7.1 Milliarden Schweizer Franken von Beitragszahlern auf Rentner umverteilt.3
Diese Beträge sind deutlich höher als ursprünglich geschätzt. Das zeigt, dass die bis anhin zur Milde-
rung dieser Umverteilung getroffenen Massnahmen beim technischen Zinssatz und Umwandlungs-
satz nicht genug effektiv waren.
4. Die Pensionskassen wollen den Umwandlungssatz sofort senken
Weil die entsprechenden Umverteilungen im System nicht vorgesehen sind, machen die Pensions-
kassen Druck. Sie möchten eine Senkung des Umwandlungssatzes – auch auf dem obligatorischen
Teil. Und das möglichst schnell. Der Schweizer Pensionskassenverband Asip forderte im August 2018
die Senkung des Umwandlungssatzes bis spätestens 2022.
3 Medienmitteilung des Schweizer Pensionskassenverbands ASIP – August 2018.
3/6Die Gründe dafür sind nachvollziehbar. Der Befund ist gleichermassen unbequem wie klar: Die Ren-
ten sind gemessen an der aktuellen Lebenserwartung viel zu hoch. Die Oberaufsicht der beruflichen
Vorsorge geht davon aus, dass die Renten bei rechnerisch korrekter Festlegung rund 25% tiefer sein
müssten4. Die Pensionskassen rechnen bis 2022 mit einem durchschnittlichen Umwandlungssatz (Ob-
ligatorium und Überobligatorium) von 5.5%. Angemessen wäre aber ein deutlich tieferer Umwand-
lungssatz. Der versicherungstechnisch korrekte Umwandlungssatz für das Jahr 2015 lag bei 5%.5
5. Der Anlageertrag als «dritter Beitragszahler» hinkt hinterher
Neben den Versicherten und den Arbeitgebern gilt der Anlageertrag als «dritter Beitragszahler». Das
Problem: In einem Tiefzinsumfeld lassen sich mit risikolosen Anlagen kaum Renditen erzielen. Als Re-
aktion auf das Zinsumfeld haben Schweizer Pensionskassen die Anlageportolios neu zusammenge-
stellt. Sie verlagern sich auf andere Anlagen und gehen mitunter auch höhere Risiken ein – zumindest
Schweizer Renditeimmobilien sind bei institutionellen Anlegern in Zeiten von Negativzinsen belieb-
ter denn je. 2013 betrug der Immobilienanteil in den Anlageportfolios im Durchschnitt 20%. 2017
waren es bereits 23%. Gesetzlich erlaubt sind maximal 30%.6
6. Pensionskassen fegen die Risiken aus dem System
Aktuell gilt für Löhne bis 84ˈ600 Franken, die im Rahmen des Bundesgesetzes über die berufliche Vor-
sorge (BVG) obligatorisch versichert sind, ein Rentenumwandlungssatz von 6,8 Prozent. Eine weite-
re Senkung dieses Satzes gilt als unumgänglich. Im überobligatorischen Teil ist der Leistungsabbau
noch drastischer. Denn dort gelten keine gesetzlichen Mindestvorgaben. Und genau dort, wo es keine
Leitplanken gilt, drücken die Vorsorgeeinrichtungen die Rentner aus ihrem System. Das Stichwort
lautet «Langleberisiko». Wenn die Vorsorgeeinrichtungen fürchten müssen, die Leistungen seien län-
gerfristig nicht finanzierbar, geraten sie unter Druck – und sind dementsprechend froh über jeden
einzelnen, der sich im Alter von 65 Jahren für einen Kapitalbezug entscheidet.
Jahreslohn
0 21ˈ150 84ˈ600 (in CHF)
Obligatorium Überobligatorium
Gesetzlich vorgegebener Keine gesetzlichen Mindestvor-
Umwandlungssatz 6.8% gaben für Pensionskassen
Manche Kassen gehen dabei sogar noch weiter: Sie schreiben den Kapitalbezug für Beträge ab ei-
ner gewissen Höhe, explizit vor – und lassen dem Versicherten somit überhaupt keine Wahl. Zu den
prominentesten Beispielen gehören die Pensionskassen von IBM, Credit Suisse oder Novartis. Diese
verpflichten ihre Mitglieder bereits heute, bei Lohnanteilen von 84’600 (IBM), 126’900 (Credit Suisse)
bzw. 150’000 (Novartis) das Kapital zu beziehen.7
4 Die Renten in der Zweiten Säule sind viel zu hoch – NZZ, August 2018. 7 Vgl. Zwang zum Kapitalbezug bei der Pensionskasse – Tages Anzeiger, Sept. 2016.
5 Ebd.
6 Vgl. Immobilienanlagen werden riskanter – NZZ, Juni 2018.
4/67. Kapitalbezüge sind keine Seltenheit
Rente, Teilbezug oder Vollbezug. Wer vor der Pensionierung steht, muss sich für eines dieser Model-
le entscheiden. Doch wie verbreitet sind Kapitalbezüge in der Schweiz? Kapitalbezüger sind in der
Minderheit – doch nicht so sehr, wie man vielleicht meinen würde. Rund ein Drittel der Schweizerin-
nen und Schweizer entscheidet sich aktuell für den Bezug des ganzen Altersguthaben in Kapitalform.
Frauen etwas häufiger als Männer.
100%
80% 31% 30% 32%
60% 18% 23% 12%
40%
50% 48% 55%
20%
0%
Total Männer Frauen
Nur Rente
Kapital und Rente
Quelle: Bundesamt für Statistik (NRS), Credit Suisse Nur Kapital Grafik8
Die Wahrscheinlichkeit eines Kapitalbezug und die Höhe der bezogenen Kapitalleistungen steigen
dabei im Allgemeinen mit dem Bildungsniveau. Bei Personen mit einer Ausbildung auf Tertiärstufe
(Universität, Fachhochschule, höhere Bildung) haben 40% der Rentner aus der Periode 2015 / 2016
ihr Altersguthaben zumindest partiell in Kapitalform bezogen. Die durchschnittlichen Kapitalbeträge
lagen dabei bei knapp CHF 300’000.
Ausbildungsniveau
Teritärstufe 34% 60% 298
Sekundarstufe II 30% 61% 195
Sekundarstufe I 23% 67% 84
Ja, einmalig Ja, mehrmalig Nein Bezogene Kapitalleistung
Quelle: Bundesamt für Statistik, (SAKE, NRS), Credit Suisse Grafik9
Denken Sie über einen Kapitalbezug nach?
Im Angesicht von sinkenden Umwandlungssätzen und drohenden Rentenkürzungen
denken immer mehr Leute über einen Kapitalbezug nach. Immobilieninvestitionen
sind dabei ein essentieller Bestandteil der eigenen Anlagestrategie. Crowdinvesting in
Immobilien ist eine neue Investitionsform, die es erlaubt, mit bereits geringen Mit-
teln im Grundbuch eingetragener Eigentümer von Renditeimmobilien zu werden und
regelmässig ausgeschüttete Renditen zu erwirtschaften.
8 Vgl. Vgl. Berufliche Vorsorge: Kapital oder Rente? - Credit Suisse, August 2018.
9 Ebd.
5/6Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie sind nicht als persönliche Empfehlung aufzufassen und berücksichtigen weder die Anlageziele noch die Anlagestrategien oder die finanzielle Situation oder Bedürfnisse einer bestimmten Person. Die Infor- mationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer finanziellen Transaktion irgendeiner Art dar. Crow- dhouse gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Die Informationen sind nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Ohne schriftliche Genehmigung von Crowdhouse dürfen diese Informationen weder vervielfältigt noch an Dritte verteilt beziehungsweise weitergegeben werden. Crowdhouse erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Im Zusammenhang mit Immobilienanlagen bestehen diverse Risiken (u.a. Abhängigkeit von konjunkturellen Entwicklungen, Bewer- tungsrisiko, Marktrisiko bezüglich Mieterträgen, Zinsentwicklung, begrenzte Liquidität im Immobilienmarkt, Risiken im Zusammen- hang mit der Erstellung, Instandsetzung- und haltung von Liegenschaften). Eine nicht abschliessende Aufzählung solcher Risiken kann unter https://crowdhouse.ch/de/risikohinweise abgerufen werden. Es wird empfohlen, sich vor jeder Investition in Immobilienanlagen von einem Finanz- und/oder Steuerexperten beraten zu lassen. Crowdhouse AG Customer Relations info@crowdhouse.ch Lerchenstrasse 24 +41 (0) 44 377 60 60 8045 Zürich www.crowdhouse.ch
Sie können auch lesen