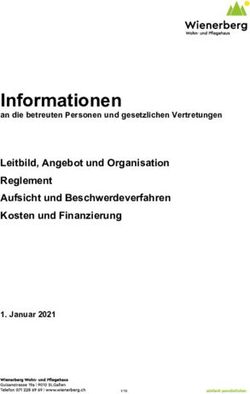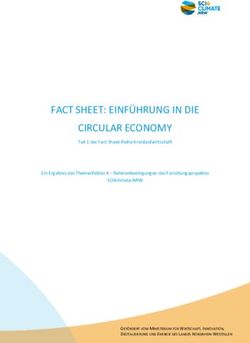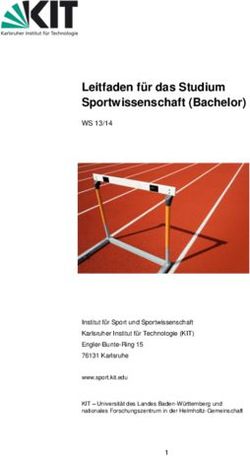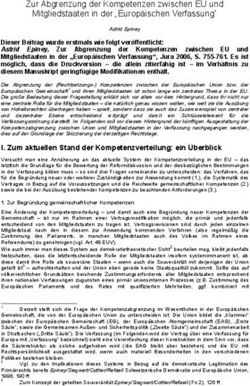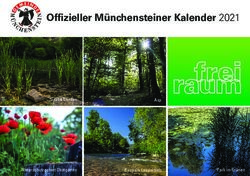Robert Habeck und Herbert Diess: Grünen-Chef und VW- CEO im Interview
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Robert Habeck und Herbert Diess: Grünen-Chef und VW- CEO im Interview Der Grünen-Chef und der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen treffen aufeinander – in der Zentrale des Konzerns in Wolfsburg. Man sollte erwarten, dass sich Robert Habeck und Herbert Diess in allem uneins sind. Doch so einfach ist das nicht. Ansgar Graw Veröffentlicht am 07.05.2019 "Nichts klingt schöner als ein großer Automotor?" Grünen-Chef Robert Habeck (r.) und Volkswagen-CEO Herbert Diess Quelle: Martin U. K. Lengemann/WELT Der patinaveredelte Käfer, 22 Millionen mal produziert, darf natürlich nicht fehlen. Und ein Stück entfernt glänzt der künftige ID, ein SUV mit Elektroantrieb – im Showroom in der Wolfsburger VW-Zentrale ist die Geschichte des Autos ebenso präsent wie seine Zukunft. Hier diskutieren
auf Einladung von WELT Volkswagen-Chef Herbert Diess und der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck über Mobilität, Klimapolitik und hohe Preise für Elektroautos. Sie stimmen in etlichen Punkten überein – aber längst nicht in allen. WELT: Herr Diess, Herr Habeck, wer von Ihnen ist der größere Autoenthusiast? Robert Habeck: Sicher Herr Diess. Herbert Diess: Ja, ich mag Autos sehr. Sie sind Garant der individuellen Mobilität an sich. Sie ermöglichen es breiten Bevölkerungsschichten, sich frei zu bewegen. Habeck: Das teile ich. Mobil zu sein bedeutet oft, frei zu sein. Sich frei bewegen zu können, möglichst ohne Einschränkung unterwegs zu sein, das empfinde auch ich als ein großes Verdienst der Moderne. Für mich hat das Auto aber diesbezüglich schon seit Längerem an Reiz verloren. Lesen Sie auch WELT: Inwiefern? Habeck: Als ich Abitur gemacht habe, 1989, war es das große Ding, sich mit Kumpels ein altes Auto zu kaufen und auf Tour zu gehen. Unseres hat damals so 500 Mark gekostet, glaub ich. Aber auf der Tour durch Südeuropa ist uns das Ding zweimal aufgebrochen worden, wir hatten Pannen, und am Ende mussten wir es verschrotten. Das war dann doch ziemlich lästig. Und es ist doch so: Die Fahrzeit selbst ist nicht wirklich frei. Man kann beim Fahren nicht arbeiten, schlafen, lesen oder einfach gar
nichts tun. Und man hat es immer am Bein, muss einen Parkplatz suchen, tanken, sich um die Instandhaltung kümmern, Reparaturen bezahlen, weil immer mal was kaputt ist, dann ärgert man sich. Diess: Aber beim Auto hat es seitdem extreme Fortschritte gegeben, insbesondere bei der Sicherheit. Habeck: Fahren muss man ja trotzdem noch selber. Diess: Ja, fahren muss man selber, aber das macht vielen ja auch Spaß ... Habeck: Das Fahren kann Spaß machen. Aber im Stau stehen, Parkplatz suchen, tanken, Öl wechseln, an die Inspektion denken, Reifen wechseln nervt ... Diess: ... und jetzt nimmt das Auto weitere sensationelle Entwicklungen. Es wird in absehbarer Zeit klimaneutral mit erneuerbarem Strom sauber fahren. Es wird unglaublich sicher durch die Sensortechnik. Ich kann mir vorstellen, dass wir in zehn, 20, spätestens 25 Jahren praktisch keine Verkehrstoten mehr haben, keine Radfahrer, die unters Auto geraten. Was dann noch bleibt, sind die Staus, und da brauchen wir Verkehrsplanung. Aber das Auto wird sehr nachhaltig und kann dann im Wettbewerb standhalten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Habeck: Dass das möglich ist, glaube ich gern. Und gut, wenn VW jetzt nach jahrelangem Irrweg auf dem Weg zu strategischer Klarheit ist und sich dafür auch mit dem Bundesverkehrsminister und den Mitbewerbern anlegt. Ich habe den Eindruck, dass viele Akteure in der Wirtschaft und der Industrie inzwischen weiter sind als maßgebliche Teile der deutschen Politik. Wenn diese Akteure wirklich durchziehen und VW zum Beispiel zeigt, dass Automobile anders werden, regenerativer, nachhaltiger, sicherer, dann kommen wir auch politisch auf eine andere Ebene. VW-Vorstand Diess gestaltet die WELT von Dienstag https://www.welt.de/politik/d eutschland/plus193010241/R obert-Habeck-und-Herbert- Seit 2011 haben die Gastausgaben bei WELT Tradition. Nach Künstlern und Designern ist nun erstmals ein Vertreter der deutschen Wirtschaft eingeladen, eine Ausgabe zu gestalten: der VW-Vorstandsvorsitzende
Herbert Diess. Quelle: WELT/Thomas Laeber Und trotzdem meine ich, dass das nicht das Ende der Entwicklung ist. Das ist jetzt vielleicht so ähnlich wie der Übergang von Schallplatten zu CDs. Aber inzwischen streamen viele und haben überhaupt keine Hardware mehr. Und das wird die eigentliche Herausforderung: Man will bequem von A nach B kommen, und vor allem jungen Leuten ist es schon jetzt nicht mehr so wichtig, dass sie das mit dem eigenen Auto tun, sondern Hauptsache, sie sind mobil. Autokonzerne werden also zu Mobilitätsunternehmen. Diese Entwicklung kann bedeuten, dass es weniger Autos gibt. Diess: Wir gehen auch davon aus, dass das Auto teilweise ersetzt wird durch besseren öffentlichen Nahverkehr, auch durch Fahrräder in der Stadt oder durch das Teilen von Autos. Aber wir sind überzeugt, dass das Auto auch in Zukunft seine wichtige Rolle weiter spielen wird. Nicht nur als Eigentum, sondern häufiger geteilt oder gemietet. Aber aus dem Verkehrssektor können wir es uns nicht wegdenken. Sharing- oder Taxidienste stoßen auch an Limits. Und dann gibt es den kulturellen Aspekt: Ein Auto ist heute mehr als nur ein Transportmittel. Es ist Ausdruck des persönlichen Stils. Menschen wollen sich differenzieren, man sucht die richtige Marke, man sucht sich ein Auto, das einem Spaß macht. Habeck: Wir brauchen Autos weiterhin als Fortbewegungsmittel, und das werden auch noch viele Autos sein – aber nicht mehr so viele wie bisher. Dafür werden diese intensiver genutzt werden. Elektrischer Antrieb, erneuerbare Energien, eine gute Ladeinfrastruktur und eine bessere Ausnutzung der Autos durch geteilte Mobilität – das ist doch kein schlechtes Szenario. Dann werden also im Idealfall weniger Autos die Städte verstopfen, aber der Verkauf von Autos wird nicht zwingend einbrechen. Lesen Sie auch
WELT: Da sind Sie sicher? Habeck: Während heute ein Privatauto im Durchschnitt nur eine Stunde am Tag gefahren und 23 Stunden geparkt wird, wird ein Sharing-Auto viel intensiver genutzt und muss darum ein paar Jahre früher ersetzt werden. Autos werden quasi ein Stück weit in gemeinschaftlichen Besitz übergehen. Und Mobilität wäre dann der Wunsch, möglichst zügig ohne Einschränkungen, vielleicht dabei noch lesend, von einem Ort zum nächsten zu kommen. WELT: Wenn wir uns einig sind, dass die Art von Mobilität, wie wir sie jetzt in den Städten haben, dysfunktional geworden ist, wenn wir uns einig sind, dass zur Erreichung der Pariser Klimaziele eine Mobilitäts- und Verkehrswende nötig ist, lautet doch die Frage: Wie nimmt man die Menschen mit? Hollywood und die gesamte Popkultur sind vom Auto mit Verbrennungsmotor geprägt. Was bieten die Grünen als Ersatz an? Das Liegefahrrad? Was ist ähnlich aufregend und was klingt so schön, wie einen Zwölfzylinder mit sechs Liter Hubraum von 3000 auf 6000 Umdrehungen zu bringen? Habeck: Nichts klingt schöner als ein großer Automotor? Okay, das mag für manche so sein. Aber als Politiker habe ich in einer liberalen Gesellschaft nicht den Job, Leuten zu sagen, was sie schön finden sollen oder nicht, wie häufig sie duschen, wie oft sie Filme streamen, in welcher Beziehung sie leben, wie und welche Motorengeräusche sie bevorzugen. Menschen sollen sich frei entfalten können. In der Politik dagegen geht es darum, die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenspiels zu organisieren über Werte, auf die wir uns einigen. Das sind ökologische Werte, aber auch soziale Werte. Wie kann man in Dörfern und in Städten die
Voraussetzungen für Lebensqualität schaffen? Fahrempfinden ist also keine politische Angelegenheit, die Sicherheit auf Straßen und die Gefahr durch zu große Geschwindigkeit dann aber schon. „Ich kann mit der Verteuerung von CO2 gut leben“ https://www.welt.de/politik/d eutschland/plus193010241/R obert-Habeck-und-Herbert- Volkswagen-Chef Herbert Diess und der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck diskutieren auf Einladung von WELT über Mobilität, Klimapolitik und hohe Preise für Elektroautos. Dabei gibt es unerwartetes Lob. Quelle: WELT/Kevin Knauer Diess: Ich glaube, wir haben festgestellt, dass wir übereinstimmend auch individuelle Mobilität weiterhin sehen als Grundbedürfnis und Grundrecht des Menschen. Deswegen kann ich mit der grünen Politik der Energiewende, der Verteuerung von CO2 gut leben. Und ich kann mir vorstellen, dass wir diesen Wandel in der Mobilität gemeinsam gestalten können, auch wenn der schwierig sein wird ... Habeck: ... das habe ich bislang aus Ihren Kreisen noch nicht so häufig gehört ... Diess: ... denn wir werden zunächst Arbeitsplätze verlieren. Diesen Wandel müssen Politik und Wirtschaft gemeinsam gestalten. Da habe ich überhaupt keine Berührungsängste. Ein bisschen Angst habe ich bezüglich der Freiheit der Bewegung. Ich habe nichts gegen Regulierung, aber halte nichts von Gängelung und Einschränkung. Und da bekomme ich bei manchen grünen Aussagen schon Gänsehaut, etwa dass wir nur noch dreimal im Jahr fliegen dürfen. Oder die Forderung nach Fahrverboten. Wir gewinnen nichts dadurch, dass wir alles in der Welt übermäßig regulieren. Wir brauchen Rahmenbedingungen und eine gewisse Regulierung, ohne die es nicht funktioniert. Habeck: Ich will jetzt keine Schärfe reinbringen ...
Keine Berührungsängste: Diess (l.) und Habeck Quelle: Martin U. K. Lengemann/WELT WELT: Doch, bitte! Habeck: ... aber ich möchte doch erinnern: Wir sitzen hier in der Zentrale von VW, und wenn Sie Fahrverbote kritisieren, dann liegt das daran, dass Regeln nicht eingehalten wurden – und zwar von Ihrem Konzern. Wenn es Fahrverbote in deutschen Städten gibt, dann sitzen wir in den Räumen, in denen die Ursache des Problems zu suchen ist. Niemand will Fahrverbote. Aber wenn Gerichte diese anordnen, dann liegt die Schuld ursächlich doch nicht bei der Politik, die Regeln gemacht hat, sondern bei den Automobilkonzernen, die Regeln bewusst gebrochen haben. Aber wenn der ganze Schlamassel dazu geführt hat, dass VW jetzt umdenkt, dann sind Sie immerhin weiter als der Bundesverkehrsminister. Die Aufgabe der Politik ist doch, einen klaren Rahmen zu setzen, die grundlegenden Dinge anzugehen und für die Wirtschaft Planungssicherheit zu schaffen. Deswegen hadere ich ja auch so mit dem Vorschlag von Dieter Janecek ... WELT: ... dem Grünen-Bundestagsabgeordneten, der drei Flüge pro
Person und Jahr gestatten wollte ... Habeck: ... ich finde den Vorschlag falsch, weil er das individuelle Verhalten formen will. Das wäre wie ein persönliches Kilometerbudget im Autoverkehr. Oder eine Kalorienmenge Fleisch oder Milch. Das wird ziemlich sicher den vielen unterschiedlichen Lebenssituationen nicht gerecht. Besser sind allgemeine Regeln: Grenzwerte für Abgase, ein klares Ausstiegsdatum aus dem fossilen Verbrennungsmotor, ein Tempolimit für mehr Sicherheit auf den Autobahnen. Aber wenn wir das individuelle Verhalten individuelles Verhalten sein lassen wollen, wofür ich sehr bin, dann setzt das voraus, dass wir über Regulierungen, Grenzwerte auf einer ordnungspolitischen Ebene und über finanzielle Förderung umso klarer definieren, wohin die Reise geht – und das ist aus meiner Sicht hin zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. WELT: Konkret: Welche Verkehrs-, Wirtschafts- und Innovationspolitik würde ein Bundeskanzler Habeck machen? Diess: Ja, das wäre auch für uns interessant zu wissen. Habeck: Wenn wir das Kanzleramtsgerede bitte streichen und stattdessen über ernsthafte politische Antworten reden … Wir sollten da, wo es um politische Förderung geht, die Priorität auf die elektrische Mobilität setzen, und zwar aus pragmatischen Gründen. Wenn wir andere alternative Entwicklungen parallel in gleicher Intensität fördern würden, also auch noch eine Tankstellen-Infrastruktur für Wasserstoff-Autos mit Steuergeldern aufbauen, dann wird das sehr, sehr teuer. Und auch der Staat muss wirtschaftlich investieren. Die elektrische Mobilität ist auf dem Weg, sich weltweit als die Zukunftsform durchzusetzen – zumindest für die nächsten Jahrzehnte. Lesen Sie auch
WELT: Die Konsequenz? Habeck: Beim normalen Autoverkehr sollten wir die Elektrifizierung vorantreiben. So wie beispielsweise Baden-Württemberg mit dem dritten Landesprogramm Elektromobilität wirklich Ernst machen mit einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Wenn andere Mobilkonzerne auch auf Wasserstoff setzen, ist das ihre unternehmerische Entscheidung. Nur können sie aus meiner Sicht nicht noch eine öffentliche Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur erwarten – sonst haben wir lauter parallele, teure Infrastrukturen. Wir brauchen viel Geld für den schnellen Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektroantriebe. Im Bereich der Elektromobilität ist aber auch die Entwicklung am weitesten. Das hat Priorität. Dazu kommt die Beschleunigung des Stromnetzausbaus. Die steuerlichen Subventionen für Diesel und für Dienstwagen müssen in den nächsten Jahren rigoros ökologisch umstrukturiert werden. WELT: Kein Dienstwagen soll mehr steuerlich gefördert werden? Auch nicht der, den sich ein Mittelständler selbst kauft? Habeck: Bei Dienstwagen gibt es ja jetzt schon die Regel, dass E-Mobile nur den halben Steuersatz des Dienstwagenprivilegs bezahlen. Ich denke, absehbar sollte das Dienstwagenprivileg nur noch für emissionsfreie Fahrzeuge gelten. Damit hätte man einen starken Anreiz, die Fahrzeugflotte ökologisch umzurüsten, und würde die Konzerne ermutigen, den Weg zu einer emissionsfreien Mobilität zu gehen. Denn wann sich die Elektromobilität durchsetzt, kann man inzwischen ziemlich genau einschätzen.
Studien gehen davon aus, dass um die Mitte des nächsten Jahrzehnts der Elektromotor in Anschaffung und pro gefahrenem Kilometer günstiger werden wird. Wir überschätzen oft die Möglichkeiten in der Gegenwart und unterschätzen die Möglichkeiten in der Zukunft. Es gibt bei VW das Ziel, bis 2030 40 Prozent E-Wagen zu haben. Aber was, wenn viele Menschen früher sagen: E-Mobile sind sauberer, leiser, günstiger, und ein Auto mit Verbrennungsmotor will ich gar nicht mehr? Dann geht’s schneller, dann kauft keiner mehr den Benziner. Die Zeit läuft uns davon. Auch der Industrie. Darum bin ich für eine klare strategische Entscheidung. Lesen Sie auch WELT: Da stimmt Herr Diess zu? Es gibt keine Technologie-Offenheit? Diess: Da sind wir in der Tat einer Meinung. Wir können uns nicht die Entwicklung von zwei oder noch mehr ambitionierten Ladeinfrastrukturen leisten. Politik steht immer in Haushaltszwängen, und die Leute sagen zu Recht: „Wir wollen eine vernünftige Verwendung unserer Steuern.“ Also muss man sich entscheiden, und alle Indikatoren sprechen dafür, dass E- Mobilität kurz- und mittelfristig die leistungsfähigste alternative Technologie ist. Es geht darum, die festgelegten Klimaziele zu erreichen. Dafür müssen wir jetzt zielgerichtet handeln. Habeck: Wir brauchen Klarheit: Wir müssen jetzt konsequent auf E- Mobilität setzen, wenn wir die Klimaziele noch erreichen wollen. Wenn wir so lange mit Benzin und Diesel fahren, bis das Wasserstoff-Auto konkurrenzfähig ist, wird es zu spät sein. Technologieoffenheit darf nicht dazu führen, dass am Ende nichts passiert.
Diess: Die Technologie ist verfügbar und muss nur wenige Hürden überwinden. Einerseits fehlen jetzt noch die attraktiven Autos mit den großen Reichweiten. Aber die kommen nächstes Jahr von uns und von Wettbewerbern. Die andere Frage ist die des regenerativ erzeugten Stroms. Es macht keinen Sinn, Elektroautos zu fahren, wenn Kohlekraftwerke den Strom erzeugen. Sehr schwierig wird es allerdings, kleine Autos noch vermarktbar zu machen. Unser VW Up geht bei knapp über 10.000 Euro los, als E-Auto müsste er vor allem aufgrund der teuren Batterien auf 17.000 bis 18.000 Euro springen. Das ist nicht attraktiv für den Kunden. Deswegen ist unser Petitum an die Politik, etwas zu tun für die kleinen Autos. Die Elektrifizierung im Preissegment nach unten zu bringen wird eine große Herausforderung. Wenn wir da nicht politisch steuern, wird Mobilität für Einkommensschwächere nicht mehr erschwinglich. Und wir sehen gerade in Frankreich, was passiert, wenn man breite Gruppen der Gesellschaft ausschließt von der Mobilität. Lesen Sie auch WELT: Ist das Infrastrukturproblem lösbar? Diess: Wenn wir uns klar für Elektro entscheiden, muss auch die Politik ran, das können die Automobilhersteller nicht alleine. Es geht ja auch um neue regulatorische Voraussetzungen etwa für Mietshäuser. Da muss man den Menschen die Möglichkeit geben, sich eine Ladebox installieren zu lassen. Man braucht daneben öffentlichen Raum, etwa auf Parkplätzen, um schnell laden zu können, und ein relativ dichtes Netz an den Autobahnen. Deswegen müssen wir uns jetzt schnell dafür entscheiden, in den nächsten
zwei Jahren. Natürlich werden wir weiter forschen am Wasserstoffantrieb, der hat auch Zukunft. Aber bis dahin vergehen noch mindestens zehn Jahre. Zunächst ist Elektromobilität die Lösung, samt Plug-in-Hybriden als Übergangstechnologie. WELT: Herr Diess, dass Herr Habeck eben gesagt hat, wir säßen in der Zentrale des Konzerns, der die Debatte über Stickoxide durch die Diesel- Schummelei erst ausgelöst habe, schlucken Sie so? Diess: Das schlucke ich so, weil wir in den USA ja gegen Regeln verstoßen haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen: Für die hohen Stickoxid- Werte in den deutschen Städten sind wir natürlich nicht allein verantwortlich. Obwohl sich die Pkw deutlich verbessert haben und die Stickoxidemissionen seit 1995 trotz des heute stärkeren Verkehrs um 70 Prozent reduziert wurden, reicht das nicht, um die Grenzwerte dauerhaft zu erfüllen. Das hat mit Kohlekraftwerken, Heizungen oder Schiffen in den Häfen genauso zu tun. In einer großen deutschen Stadt wird beispielsweise ein Kohlekraftwerk betrieben, das hat so starke Stickoxidemissionen wie alle Dieselautos der Stadt zusammen. Wir haben den Bürgermeister gefragt, wann er das Kraftwerk abschalten wird. Das ist aber nicht vorgesehen. Trotzdem: Bis 2020 oder 2021 werden wir die 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft erreichen. Habeck: Ich muss Ihnen teilweise widersprechen. Wir sollten natürlich die Schiffe in Häfen mit sauberem Landstrom versorgen und Kohlekraftwerke abschalten. Aber die Stickoxide in den Straßen kommen ganz wesentlich von den Dieseln der Euro 5. In Kiel gibt es einen Straßenzug, bei dem die Grenzwerte überschritten werden. Als Umweltminister war das eine meiner Baustellen. Die Schiffe, die tatsächlich ein ökologisches Problem darstellen, pusten in Kiel ihre Abgase aber woandershin. An der betroffenen Straße spielten ältere Dieselautos eine entscheidende Rolle. Viele Kommunen hätten keine Probleme mit den Grenzwerten, wenn zumindest die Euronorm 5 so eingehalten würde, wie es dem Kunden versprochen wurde. Da gibt es schon einen ursächlichen
Zusammenhang. Lesen Sie auch WELT: Müsste man Anreize schaffen für kommunale Verkehrsträger, damit sie Busse und andere Fahrzeuge nur noch als E-Fahrzeuge betreiben? Habeck: Viele Kommunen und Länder machen das schon, auch beim öffentlichen Personennahverkehr. Sie fördern Ladestationen und bezuschussen E-Busse. Ich denke, öffentlicher Personennahverkehr und private Pkw werden immer stärker ineinandergreifen. In wenigen Jahren werden viele sich sozusagen die Möglichkeit mieten, von einem Ort zum nächsten zu kommen und verschiedene Fahrzeuge dafür nutzen, die verfügbar sind mit einer Flatrate, so ähnlich wie beim Handy. Allerdings ist derzeit das Problem, dass E-Busse gar nicht so einfach zu bekommen sind. Ein Wort noch zu Fahrverboten. Sie werden von Gerichten angeordnet, und deswegen ist die Aussage, es wird mit mir keine Fahrverbote geben, im Kern ein Appell, Gerichtsurteile und damit den Rechtsstaat zu ignorieren. Das muss man sich mal klarmachen, was da gesagt wird. Wenn Repräsentanten des Staates dazu aufrufen, Gesetze und Gerichtsurteile zu missachten, können wir den Rechtsstaat beerdigen. WELT: Wenn wir den Verkehr in den Innenstädten reduzieren wollen, zum einen wegen der Emissionen, zum anderen wegen der ökologisch wie ökonomisch schädlichen Staus, wäre dann, Herr Habeck, nicht Road- Pricing ein Weg, also die Einführung von Gebühren auf die Benutzung bestimmter Straßen?
Diess: Da bin ich dagegen. Ich kann nicht 50 Prozent der Leute womöglich finanziell überfordern. Das ist ein falscher Ansatz, weil man damit eine Diskriminierung von Bevölkerungsschichten erreicht, die die heutige Freiheit genießen. Herr Habeck, Sie haben es ja selbst gesagt, als Student waren Sie Teil davon, Sie sind auch ans Mittelmeer gefahren. Die Schienen werden digital, fehlen nur noch die Züge https://www.welt.de/politik/d eutschland/plus193010241/R obert-Habeck-und-Herbert- Um Staus zu verhindern und die Pünktlichkeit zu erhöhen, sollen die Schienen der Bahn mit digitaler Ausrüstung ausgestattet werden. Die Bundesregierung ist auch bereit, die passenden Schienen zu bezahlen, nicht aber die notwendige Ausstattung der Wagen. Quelle: WELT / Lukas Axiopoulos WELT: Wenn Genosse Diess die Frage an Herrn Habeck schon beantwortet hat ... Diess: ... jedenfalls muss uns noch Besseres als Road-Pricing einfallen. Natürlich müssen wir den öffentlichen Nahverkehr stärken, wir brauchen auch Fahrräder, und wir müssen schauen, dass wir die Menschen in kleineren Autos durch die Städte fahren lassen. Heute benötigt ein Auto 20 Quadratmeter Verkehrsfläche. In der Regel fahren 1,1 Personen mit 1,5 Tonnen Stahl durch die Stadt. Da müssen wir versuchen, die Belegung zu verändern, beispielsweise durch Sharing. Und wenn die Fahrzeuge der nächsten Generation elektrisch und selbstfahrend sind, werden die Abstände zwischen ihnen kleiner, sodass es auch dadurch zu weniger Staus kommt. Ich finde, wir müssen an technischen Lösungen arbeiten und nicht durch Straßengebühren dafür sorgen, dass die Hälfte der Leute nicht mehr in die Stadt reinkommt. Habeck: In einigen Städten gibt es ja eine City-Maut, in London, Oslo, Mailand … Aber die Städte sollten autonom entscheiden können, wie sie am besten den Verkehr lenken. Auf der Autobahn erleben wir ja gerade das scheuersche Desaster mit der Maut. Besser, sozialer und effizienter für das Ziel einer ökologischen Steuerung des Verkehrs erscheint es mir, bei der Mineralöl- und Kfz-Steuer anzusetzen.
WELT: Und wenn man das ganz auf die Verbrauchsteuer abwälzt, also keine Kfz-Steuer mehr erhebt, sondern nur den Mineralölverbrauch besteuert? Sodass derjenige, der sein Auto viel in der Garage stehen hat, deutlich weniger belastet wird als der Vielfahrer? Diess: Der individuelle Verkehr ist doch bereits stark reguliert und besteuert. Wir haben eigentlich schon eine CO2-Steuer in Form der Mineralölsteuer. Dadurch wird die Tonne CO2 beim Diesel mit rund 280, 300 Euro besteuert, beim Benziner sogar mit über 400 Euro. Darum ist es relativ teuer, mit dem Auto von Berlin nach, sagen wir, Stuttgart zu fahren. Wer die Strecke fliegt, zahlt die Hälfte. In anderen Sektoren wird mit der CO2-Emission viel laxer umgegangen. Wir haben auf unserem Betriebsgelände ein Kohlekraftwerk. Das stellen wir bis 2023 um auf Gas und sparen damit 1,5 Millionen Tonnen CO2 ein. Das ist so viel, wie 870.000 Fahrzeuge im Jahr emittieren. Die Umstellung kostet uns 400 Millionen Euro, das sind 14 Euro pro Tonne Einsparung. Einsparungen im Pkw-Bereich durch Umstellung auf Elektromobilität kosten 500 Euro pro Tonne. Ich habe Angst, dass wir durch unseren sehr starken Fokus auf das Auto nicht effizient umsteuern. Habeck: Insgesamt ist es falsch, dass schmutzige Energie billiger ist als saubere. Aber wenn man alles nur über Verbrauchsteuern machen will, schafft man tatsächlich ein soziales Problem, weil Verbrauchsteuern immer sozial degressiv wirken, weil sie für Menschen mit geringeren Einkommen spürbarer sind als für Besserverdienende. Und wenn man heute alle klimaschädliche Wirkung voll umlegen würde, dann käme man laut Umweltbundesamt auf einen CO2-Preis von 180 Euro pro Tonne. Das ist sozialpolitisch gar nicht durchhaltbar. Um eine klimafreundliche Mobilität durchzusetzen, ist das auch gar nicht nötig, weil die Erneuerbaren so günstig geworden sind. Der CO2-Preis sollte aber so hoch sein, dass die erneuerbaren Energien faire Marktchancen haben. WELT: In jedem Fall wird fossile Energie für den Verbraucher teurer. Habeck: Preise sind ein effizienter Mechanismus der Marktwirtschaft.
Aber um negative soziale Auswirkungen zu vermeiden, haben wir das Konzept des „Energiegeldes“ entworfen: Fossile Brennstoffe werden moderat teurer, sodass sich eine Lenkungswirkung entfaltet. Doch der Staat zahlt es in gleichen Anteilen an alle Menschen wieder aus, sodass jeder zu Weihnachten oder zu Neujahr eine Rückerstattung oder Vorauszahlung als Energiegeld erhält. Und damit kehrt sich die soziale Wirkung der Verbrauchsteuern um. Durch das Energiegeld werden einkommensschwächere Haushalte durch einkommensstärkere Haushalte unterstützt. Man hat einen gewissen Umverteilungseffekt. WELT: Die Steuern werden’s richten? Habeck: Nicht allein. Ein CO2-Preis ist ein nötiges, aber kein hinreichendes Instrument. Ironischerweise hilft das gern so verpönte Ordnungsrecht. Es schützt unser Portemonnaie. Also, gesetzlicher Kohleausstieg, und die alten, längst abgeschriebenen Kohlekraftwerke brauchen dabei nicht auch noch eine Entschädigung. Und der Ausstieg aus dem fossilen Verbrenner kann auch gesetzlich festgelegt werden. Insgesamt aber rechne ich damit, dass die Nachfrage nach klimafreundlicher Mobilität uns sowieso alle überholt. In dem Moment, wo der elektrisch gefahrene Kilometer günstiger ist als der mit dem Verbrennungsmotor und die Anschaffung eines E-Autos nicht teurer, möglicherweise sogar günstiger wird, wird sich alles ändern. Herr Diess kann das besser beurteilen, aber nach dem, was ich lese, könnte das ungefähr Mitte des Jahrzehnts der Fall sein. Also könnte alles auch schneller passieren. WELT: Und wenn dann alle Probleme gelöst sind, verzichten die Grünen auch auf ein Tempolimit auf den Autobahnen? Habeck: Das Tempolimit ist vor allem eine Sicherheitsfrage. WELT: Stimmt nicht. Laut den Unterlagen des ADAC gibt es keine signifikanten Zahlen, die belegen würden, dass ein Tempolimit zu einer Verbesserung der Sicherheit führen würde.
Habeck: Es gibt auch andere Studien. WELT: Der ADFC wäre besser? Habeck: Nein, aber die Polizei und die Unfallforscher der Versicherungen. Wenn man mit 180 Stundenkilometern unterwegs ist, von Ihren Beschleunigungen auf 6000 Umdrehungen gar nicht zu reden, und plötzlich schert ein Fahrzeug mit 120 Stundenkilometern aus, ist es doch logisch, dass die Unfallgefahr und Unfallwucht steigt. Lesen Sie auch WELT: Wird bei E-Mobility die Feinstaubbelastung nicht größer, weil die Autos schwerer sind und der Reifenabrieb, vielleicht auch der Bremsabrieb dadurch steigen? Diess: Beim Bremsen wird es weniger Abrieb geben, weil sich durch das Heruntergehen vom Gaspedal der Stromzufluss umdreht, dann bremst vor allem der Motor selbst durch Rekuperation. Aber ich gebe Ihnen recht, die Feinstaubbelastung durch Reifenabrieb wird es weiterhin geben, weil die Autos in der Tat schwerer werden. Unterm Strich sinken aber die Emissionen. Habeck: Werden die Autos wirklich schwerer, Herr Diess? Klar, die Batterie ist schwer, aber wir müssen ja nicht den VW-Touareg als E-Auto bekommen. Die Autos wurden in den letzten Jahren enorm aufgepumpt. Der Verbrennungsmotor ist effizienter geworden, aber das wird aufgefressen durch die Größe und das Gewicht der Autos. Wenn der Plan ist, elektrische SUVs zu bauen, dann hätte ich Sorgen. Ich hatte die VW- Strategie jetzt so begriffen, dass Sie in leichtere und kleinere Autos
reinwollen. Diess: Herr Habeck, das ist der Punkt. Sie sagen, Regulierung ist wichtig, und das sehe ich auch so. Die deutsche Autoindustrie ist heute auch erfolgreich durch Regulierung. Wir haben die Autobahnen, wir haben eine Dienstwagensteuer, die dazu geführt hat, dass wir den höchsten Premium- Anteil der Welt haben mit fast 40 Prozent an der Autoflotte. Das führt zu einem starken Heimatmarkt für die Premiumhersteller, und darum können sie auch im Export stark sein. Die jetzige Regulierung mit dem Flottenziel 95 Gramm als Emission im Durchschnitt aller Neuzulassungen führt dazu, dass man sich im Prinzip als Premiumhersteller leichter tut, diese Zielsetzungen zu erreichen. WELT: Weil? Diess: Unsere Strategie geht so: Wir machen als Erstes den Audi e-tron elektrisch, dann kommt der Porsche Taycan, also Autos im Preissegment 80.000, 90.000, 100.000 Euro, die zusätzliche Kosten durch die teurere Batterie gut verkraften. Damit und vor allem mit Plug-in-Hybriden erreichen wir die Flottenziele. Das bedeutet unterm Strich, dass die CO2- Vorgaben und die Flottenziele zunächst einmal nicht dazu führen, dass die Autos kleiner werden. Unser kleinstes Auto mit Verbrennungsmotor, der VW Up, ein gut durchdachter Viersitzer mit drei Zylindern, liegt heute bei einer Emission von nur 95 Gramm, erreicht also genau das Flottenziel. Aber die Flottenziele gehen demnächst auf unter 60 oder auf 20, 30 Gramm. Da macht es für uns überhaupt keinen Sinn mehr, Ups zu verkaufen. Lesen Sie auch
WELT: Der Up wird sterben? Diess: Für den Up würden ab den kommenden Jahren hohe Strafzahlungen fällig oder eine teure Elektrifizierung. Um mindestens 2000 bis 3000 Euro müsste man das Auto teurer machen, um die Flottenziele zu erreichen. Kleinere Autos lassen sich dann nicht mehr verkaufen. Hingegen lässt sich ein elektrischer SUV, der um null Gramm Emission gerechnet wird, im Markt verkaufen. Das führt dazu, dass wir tendenziell eine Verteuerung haben werden bei den Einstiegsmodellen. Und das macht mir Sorgen, weil das dazu führen könnte, dass Mobilität nicht mehr für alle erschwinglich sein wird. Dabei ist das kleine Elektrofahrzeug mit kleiner Batterie, das vor allem Kurzstrecken fährt, ökologisch attraktiver. Das ist nicht optimal. Habeck: Das ist nicht meine Beobachtung. Die Leute, die heute E-Mobile fahren, sind ja häufig Handwerksbetriebe oder Selbstständige. Die kaufen keine e-trons – sondern vielleicht kleine E-Autos, aber nicht von VW, sondern von ausländischen Herstellern ... Diess: Viele gibt es ja noch nicht ... Habeck: ... denn die meisten Leute wollen und können kein Auto für 130.000 Euro kaufen, sondern suchen irgendwas zwischen 10.000 und 30.000 Euro, und selbst das ist für viele viel Geld. Ihre Argumentation ist vielleicht aus Sicht der deutschen Automobilhersteller richtig, die auf die großen Modelle gesetzt haben. Aber wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Andere Hersteller bieten E-Mobile aus dem mittleren und dem Kleinwagensegment zu viel günstigeren Preisen an. Diess: Das würde ich infrage stellen. Aber auch wir bewegen uns natürlich. Wir machen eine Top-down-Einführungsstrategie, so wie Tesla auch, also zunächst Porsche und Audi. Und dann kommt im nächsten Jahr der Volkswagen ID, in der Größe des Golf. Das ist unser Kernsegment, und da werden wir ein sehr attraktives Elektrofahrzeug anbieten, beginnend bei unter 30.000 Euro, was ein gut ausgestatteter Golf Diesel heute auch kostet.
Habeck: Na also. Also warum dann der Start mit den großen Autos? Diess: Das macht ökonomisch Sinn für uns, weil wir da einen positiven Deckungsbeitrag erzielen können über ein attraktives Fahrzeug. Wir glauben, die Volumen auch absetzen zu können, wenn wir die Infrastruktur dafür haben. Aber die Elektrifizierung ist aufgrund der teuren Batterie eben sehr viel leichter bei größeren als bei kleinen Autos. Die Batterie wird auch perspektivisch nicht so schnell günstiger, darum bezweifle ich das von Ihnen genannte Ziel, schon 2023 den Break-even zum Elektrofahrzeug zu erreichen. Ich sehe den eher 2025, 2026, wenn die Benziner bis dahin durch zusätzliche Auflagen teurer geworden sind. Zunächst machen große Elektrofahrzeuge für den Hersteller mehr Sinn, auch wenn ökologisch der elektrische Kleinwagen die bessere Lösung wäre. Habeck: Das ist jetzt eine Wette auf den Markt. Ich kann verstehen, wenn Ihre Konzernstrategie so ansetzt. Aber die Zahl der Kunden, die sich ein Auto um 100.000 Euro leisten kann, ist begrenzt. Wenn Sie 2025 kein E- Mobil für unter 20.000 Euro anbieten, dann werden Sie – so fürchte ich – im Markt scheitern. Den Up mit Verbrennungsmotor will bis dahin auch keiner mehr. Und dann muss sich VW konzentrieren auf Porsches und SUVs, aber dann sind Sie nicht mehr Volkswagen, dann bieten Sie nur noch Premiumwagen an und müssten sich in PW umbenennen. Irgendjemand anderes wird dann das Volkswagensegment füllen. Das wird so kommen wie bei den kleinen elektrischen Postautos, die kein Automobilkonzern herstellen wollte oder konnte. Und dann hat ein Professor mit seinen Studierenden von der RWTH Aachen so ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt, und es funktioniert und verkauft sich wie geschnitten Brot. Wenn Sie sagen, preiswerte E-Kleinwagen lohnen sich für Sie nicht, sage ich voraus: Für andere wird es sich lohnen. Vielleicht für China. Diess: Nein, das hat nichts mit dem Anbieter zu tun, sondern ganz einfach mit dem Fakt, dass ein E-Fahrzeug durch die teure Batterie auf absehbare Zeit deutlich teurer sein wird als ein Auto gleicher Größe mit Verbrennungsmotor.
Habeck: Ich verstehe die Logik, dass man mit höherpreisigen Modellen erst einmal die Einführungskosten bezahlt. Das ist für Menschen mit normalem Gehalt ein Problem, aber aus der Unternehmensperspektive ökonomisch zumindest nachvollziehbar. Doch zu sagen, mittelfristig wird sich das auch nicht lösen, das verstehe ich nicht. Diess: Natürlich streben wir an, von 30.000 auf 20.000 Euro zu kommen. Unsere ID-Modelle werden wir ja ab knapp 30.000 Euro anbieten. Und an kleineren und günstigen Modellen arbeiten wir. Trotzdem bedeutet das, dass wir die kleinsten Wagen zuletzt mit E-Antrieb ausstatten werden. Autobosse einigen sich auf Zukunftsplan https://www.welt.de/politik/d eutschland/plus193010241/R obert-Habeck-und-Herbert- VW, Daimler und BMW haben sich auf einen Plan zum Antrieb der Zukunft geeinigt. Batterieelektrische Autos und Hybride seien „das Gebot der Stunde“. Die Ladeinfrastruktur für Elektro-Autos soll ausgebaut werden. Quelle: WELT/ Lukas Axiopoulos WELT: Was also sollte Herr Habeck als Kanzler für Sie machen, damit diese kleinen Autos früher und für 15.000 Euro kommen? Subventionen bereitstellen? Diess: Er sollte überlegen, wie man die kleinen Autos fördern kann, weil das ökologisch der richtige Weg wäre. Habeck: Auch hier würden wir auf die richtigen Marktanreize setzen und ein Bonus-Malus-System in der Kfz-Steuer einführen. Rein elektrische Fahrzeuge zahlen weniger oder keine, Spritschlucker mehr. Ein solches System ist sozial gerecht und kann ökologisch lenken. Und wir müssen Mobilität digitalisieren. Bis hin zu öffentlichen Plattformen, damit das gemeinsame Verabreden und Teilen der Mobilität einfacher wird. WELT: Auf Kuba sind die wenigen Autobesitzer schon verpflichtet, Menschen mitzunehmen, die am Straßenrand warten. Habeck: Das meine ich nicht mit Teilen. Irgendjemand wird die Mobilität in den Städten, in Ballungsräumen und auf dem Land digital organisieren. Ich kann mir unter Umständen vorstellen, dass wir elektrische Kleinwagen
unterstützen, indem sie im ersten Jahr den Strom umsonst bekommen. Das nennt man ein Anreizsystem. Auch das gehört zu einer Marktwirtschaft. VW-Vorsitzender Diess (2.v.l.) und Grünen-Chef Habeck (2.v.r.) im Gespräch mit WELT-Chefredakteur Ulf Poschardt (r.) und WELT-Chefreporter Ansgar Graw Quelle: Martin U. K. Lengemann/WELT
Sie können auch lesen