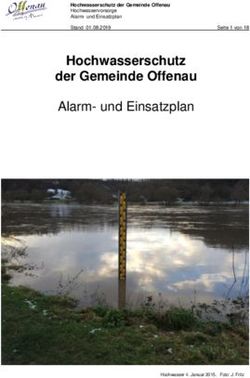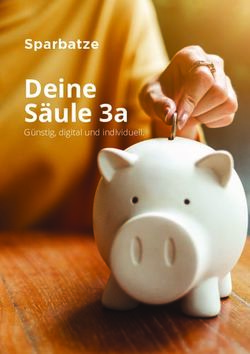Schlecht sehen - gut leben - Leben mit einer Sehbehinderung im Alter - UZH
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kooperationspartner: Zentrum für Gerontologie Schlecht sehen – gut leben. Leben mit einer Sehbehinderung im Alter Ringvorlesung FS 2017 „Gesundes Altern mit hoher Lebensqualität – trotz Vulnerabilität?“ Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich 29. März 2017 Alexander Seifert (Sozialpädagoge und Soziologe) a,b a Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich (UZH) b Universitärer Forschungsschwerpunkt UFSP „Dynamik Gesunden Alterns“ der UZH Vortrag in Kooperation mit: Stefan Spring, Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen (SZB) Christian Birkenstock, Fachstelle Sehbehinderung Zentralschweiz (fsz) 29.03.2017 Seite 1
Zentrum für Gerontologie Ablauf Teil 1 (ca. 30 min.): Alexander Seifert, Zentrum für Gerontologie Gesundes Altern mit hoher Lebensqualität trotz Sehbehinderung – Erfahrungen aus der COVIAGE Studie Teil 2 (ca. 25 min.): Christian Birkenstock, Fachstelle Sehbehinderung Zentralschweiz (fsz) Psychosoziale Bewältigung durch Low Vision Beratung 29.03.2017 Seite 2
Zentrum für Gerontologie
Die 5 Sinne des Menschen
Riechen Sehen
Schmecken
Hören
Tasten
Hintergrundbild: Created by
Asierromero - Freepik.com
29.03.2017 Seite 3Zentrum für Gerontologie
Ausgangslage
• Demographischer Wandel
• Zunahme der Zahl älterer
Personen mit Sehbehinderungen
• Medizinische und gesellschaftliche Herausforderungen
• Medizinische Versorgungen (Kosten)
• Gesellschaftliche Bedeutung / Pflegerische Versorgung
• Herausforderungen für das Individuum
• Doppelte Belastung (Alter und Sehbehinderung)?
• Trotz Relevanz kaum Schweizer Forschungsliteratur
• Sozialwissenschaft/Psychologie/Sozialarbeit
29.03.2017 Seite 4eine Sehschädigung. In der vierten Lebensdekade sind gegen zwei, in der
siebten Dekade bereits etwa sieben von hundert Personen sehbehindert.
Danach nimmt die Häufigkeit von Sehschädigungen markant zu: In der
neunten Lebensdekade nimmt die Sehleistung auf Grund des
Alterungsprozesses bei allen Personen ab – bei vielen von ihnen so stark, dass
Zentrum für Gerontologie trotz Brillen und Kontaktlinsen etwa Zeitungslesen, Erkennen von Gesichtern
oder Orientierung in einer neuen Umgebung nicht mehr möglich sind.
Zusätzlich treten vermehrt Krankheiten der Sinnesorgane auf. Mit 70 Jahre
Sehbeeinträchtigungen im Alter haben bereits über zehn Prozent der Personen optische und medizinisch
nicht mehr ausgleichbare Sehprobleme und spüren deren Auswirkungen im
Ein statistisches Graufeld Alltag. Schliesslich ist etwa jede sechste Person über achtzig Jahre und fast
die Hälfte der über Neunzigjährigen in ihren Sehfunktionen deutlich und
dauerhaft eingeschränkt.
Anteil der Bevölkerung in Prozenten, der für
sich selbst eine Sehbehinderung bzw. eine
Hörbehinderung angibt
(Bundesamt für Statistik)
BfS 2011, aus Spring 2012
Anteil der Bevölkerung in Prozenten, der für sich selbst eineAnteil
Sehbehinderung bzw.Sehbehinderung nach Alter
Personen mit einer
eine Hörbehinderung angibt. Beschreibung Grafik: Die Kurve verläuft ab 0.3 Prozent bei den Kleinkindern immer stärker
Spring
Die Angabe „ns“ bedeutet, dass für diese Gruppe mit dem vorliegenden
ansteigend 2012
Datenmaterial keine
bis 48.7 Prozent für die Gruppe der über 95-Jährigen. Überlagert stehen die Angabe
fürBundesamt
statistisch genügend sichere Angabe gemacht werden kann. Quelle: zusammengefasste Altersgruppen: 0-19 Jahre 0.4 Prozent; 20-39 Jahre 1.3 Prozent,
für Statistik.
29.03.2017 14 Seite 5
Auch die Aussagekraft der Schweizerischen Gesundheitsbefragung mussGesellschaft und Berufswelt wollen und müssen die betroffenen
Personen aber weiterführen. Der Abschluss der Erwerbsarbeit bringt sie
eine spezielle Herausforderung mit sich: Sie wissen, dass sie als
„Mensch mit Sehbehinderung“ ins Rentenalter und ins hohe Alter
eintreten werden.
Schliesslich leben über 76’000 Menschen im höheren und hohen Alter
Zentrum für Gerontologie
mit einer Sehschädigung. Sie müssen sich mit den Fragen des Alterns
und mit früher oder später auftretenden Gebrechen und
Sehbeeinträchtigungen im Alter
Abhängigkeiten bei sich und im persönlichen Umfeld befassen. Die
Sehbehinderung, ob bestehend oder neu auftretend, bedeutet für die
Falschgedeutete Symptome und Mehrfachbeeinträchtigungen
Bewältigung des Alltags eine zusätzliche Erschwernis. Oft kommt eine
Verminderung des Hörvermögens dazu. Das wirkt sich gerade bei
sehbehinderten Personen besonders einschneidend aus. Die beiden
Sinnesschädigungen verstärken sich in ihrer Wirkung gegenseitig. Dies
erfordert sehr viel Kraft für die betroffene Person, aber auch für das
unterstützende Umfeld.
Im Allgemeinen In der stationären Pflege
RAI Daten (2016; Seifert & Spring 2016):
• 42% Sehbeschädigung
(14% davon schwere SB)
• 48% Hörschädigung
(13% davon schwere HB)
• 27% Doppelte Sinnesbeeinträchtigung
(Sehen und Hören)
• Die Diagnose der Sinnesbeeinträchtigungen
korreliert oft mit der Diagnose einer kognitiven
Beeinträchtigung!
Für den Alltag bedeuten Seh- und Hörverluste nicht
nur Einschränkungen in der Kommunikation und
Informationsaufnahme, sondern auch
Missverständnisse, Kränkungen und einen daraus
resultierenden sozialen Rückzug.
Spring 2012
hbehinderung hat viele Gesichter
schreibung Kuchendiagramm mit der Aufteilung der ca. 325‘000 sehbehinderten Menschen in Seifert & Spring 2016
r Schweiz auf Altersgruppen: Den Kuchenabschnitten sind Felder zugeteilt, welche die
29.03.2017
ersmässige Situierung von mindestens 4‘000 mehrfachbehindert-sehgeschädigten Personen Seite 6
d mindestens 10‘000 hörsehbehinderte Personen andeuten. Ein zusätzliches Feld weist auf dieZentrum für Gerontologie
Das Projekt COVIAGE
Kooperationspartner:
Studie COVIAGE
(Coping with visual impairment in old age)
2013-2018
In Kooperation mit dem SZB (Schweizerischer
Zentralverein für das Blindenwesen)
• Literaturrecherche
• qualitative Vorstudie (N = 22)
• quantitative Bevölkerungsbefragung (N = 1299)
• regelmässige Experten-Workshops (N = 14)
29.03.2017 Seite 7Zentrum für Gerontologie
Alter und Sehprobleme: Eine doppelte Belastung?
Gerade die Beeinträchtigungen der
Sinnesorgane haben „aufgrund ihrer
Umweltrelevanzen unmittelbare
Auswirkungen auf die
Alltagsgestaltung im Alter und den
weiteren Verlauf des
Alternsprozesses“
(Tesch-Römer & Wahl, 2012, S. 407).
29.03.2017 Seite 8Zentrum für Gerontologie Bereiche eines guten Lebens im Alter nach Lawton (1983) Psychologisches Wohlbefinden Depression Verhaltenskompetenz Mortalität Basale Aktivitäten tägl. Leben Angst Instrumentelle Aktivitäten tägl. Leben Subjektive Lebensqualität Selbständigkeit Lebensqualität Freizeit Wohlbefinden Soziale Kontakte Objektive Umweltbedingungen Mobilität Unterstützung Sturzrisiko Lebens- und Wohnbedingungen Kognitive Ressourcen 29.03.2017 Seite 9
Zentrum für Gerontologie
Subjektive Lebensqualität / Psychologisches Wohlbefinden
• Subjektive Lebensqualität
• Nach Diagnose: Verringerung der sub. Lebensqualität,
Neubewertung der Lebensqualität
• Psychologische Herausforderungen
• Verlust der Autonomie
• Anpassungsprozess nach der Diagnose
• Bewahrung Selbständigkeit und psychologisches Wohl
• Ängste
• Tagtägliche Ängste (Orientierung, Mobilität, Abhängigkeiten, etc.)
• Angst vor Erblindung
• Selbstwahrnehmung
• Sehbehinderung wahrnehmen und akzeptieren
(Stigmata „Behinderung“)
29.03.2017 Seite 10Zentrum für Gerontologie
Verhaltenskompetenz
• Aktivitäten des täglichen Lebens
• Einschränkungen im Alltag
• Verlust von bisher ausgeführten Aktivitäten
• Freizeit / Hobbys
• Rückzug und Vermeidung von Freizeitaktivitäten
• Soziale Kontakte
• Vermeidung, Missverständnisse, Einschränkung
• Mobilität
• Räumlicher Rückzug in die eigene Wohnung
(Wohngebiet), Wichtigkeit von „bekannten Orten“
• Bewältigungsstrategien und Neuerlernen
29.03.2017 Seite 11Zentrum für Gerontologie Objektive Umweltbedingungen 1. Wohn- und Lebenssituation (auch Alterspflegeeinrichtungen) 2. Familie und soziales Umfeld 3. Medizinische Versorgung 4. Hilfsangebote und Hilfsmittel 5. Gesellschaftliche Wahrnehmung / Stigmata „Behinderung“ 29.03.2017 Seite 12
Zentrum für Gerontologie
Früh- und Spätsehbehinderte
Sehbehinderung im / und Alter Spätsehbehinderte
Forschungsdisziplin Forschungsdisziplin
u.a. Heilpädagogik u.a. Gerontologie
Praxisorientierung Alter Praxisorientierung
(Seh-)Behinderung
u.a. Pädagogik, u.a. Beratung,
Rehabilitation, Training, Förderung,
Entwicklung, Pflege, Geragogik,
Eingliederung, Geriatrie, Stabilisierung
Förder- / der Lebensqualität,
Behandlungspläne, Alltagskompetenzen
Frühsehbehinderte
Alltagskompetenzen
Transfer
Behinderungsspezifisches Wissen
Gerontologisches Wissen
29.03.2017 Seite 13Zentrum für Gerontologie
Bewältigung von Sehbeeinträchtigungen
PERSON
BELASTUNGEN
Aktuell Zukunft
BEWÄLTIGUNG SUBJEKTIVE
(COPING) LEBENSQUALITÄT
RESSOURCEN
- Individuelle Ziele/Wertung (Soll/Ist)
- Erlernte Bewältigungsstrategien
Potenzial Nutzung
Soziales Umfeld
Externe Unterstützung
Umwelteinflüsse
(formell / informell) Seifert 2016
29.03.2017 Seite 14Zentrum für Gerontologie
29.03.2017
Seifert 2017
Seite 15Zentrum für Gerontologie
Gesellschaftliche Sensibilisierung
• Familie
• Soziales Umfeld
• Nachbarschaft
• Stadtplanung
• Anbieter von Dienstleistungen
• Politik
• Gesellschaft
Aktuelle SZB-Kampagne: Schlecht sehen? Und doch gut leben!
http://www.schlechtsehen-gutleben.ch/home/
29.03.2017 Seite 16Zentrum für Gerontologie
Fazit und Ausblick
1. „Sehbeeinträchtigungen im Alter“ ist ein grosses Thema mit geringer
Schweizer Forschungsexpertise und teilweise geringerem
gesellschaftlichen Bewusstsein (Das Thema zum Thema machen!)
2. Es ist für die Betroffenen selber mit tagtäglichen Einschränkungen
und Neubewertungen der eigenen Lebensqualität verbunden
3. Durch Nutzung von persönlichen, sozialen, medizinischen und
technischen Ressourcen kann trotz Sehbeeinträchtigung ein
selbstbestimmtes und gutes Leben im Alter geführt werden
• Frühzeitig bestehende Beratungsangebote nutzen!
29.03.2017 Seite 17Zentrum für Gerontologie
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Alexander Seifert
alexander.seifert@zfg.uzh.ch
Praktischer Hinweis
Diverse Beratungsstellen unterstützen Sie gerne in folgenden Punkten:
• Praktische Fragen, Gesprächsangebote
• (Technische) Hilfsmittel
• Lebenspraktische Fähigkeiten für den Alltag, Sozialberatung
Infos z.B. via:
http://www.sensus60plus.ch
http://www.schlechtsehen-gutleben.ch/home/
Schweizerischer Zentralverein für das
Blindenwesen SZB
http://www.szb.ch Schützengasse 4
CH-9001 St. Gallen
Telefon 071 223 36 36
29.03.2017 Seite 18Sie können auch lesen