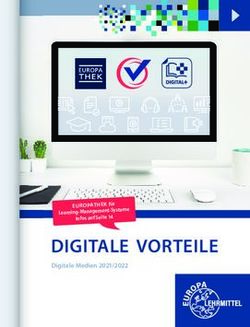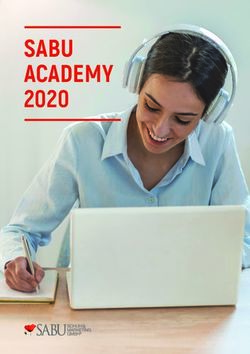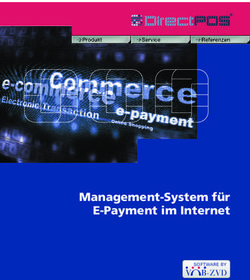Wandel der Sprach- und Debattenkultur in sozialen Online-Medien - Ein Literaturüberblick zu Ursachen und Wirkungen von inziviler Kommunikation ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Wandel der Sprach- und Debattenkultur
in sozialen Online-Medien
Ein Literaturüberblick zu Ursachen und Wirkungen
von inziviler Kommunikation
Anna Sophie Kümpel, Diana Rieger
www.kas.deImpressum Herausgeberin: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., 2019, Berlin Ansprechpartner: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. Thomas Köhler Leiter der Hauptabteilung Politik und Beratung Hauptabteilung Politik und Beratung T: +49 30 / 26 996-3550 thomas.koehler@kas.de Sabine Stoye Projektkoordinatorin Wandel der Sprach- und Debattenkultur Hauptabteilung Politik und Beratung T: +49 30 / 26 996-3517 sabine.stoye@kas.de Daphne Wolter Koordinatorin Medienpolitik Hauptabteilung Politik und Beratung T: +49 30 / 26 996-3607 daphne.wolter@kas.de Gestaltung: yellow too Pasiek Horntrich GbR Satz: Janine Höhle, Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. Die Printausgabe wurde bei der Druckerei copy print Kopie & Druck GmbH, Berlin gedruckt. Printed in Germany. Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland. Der Text dieser Publikation ist lizenziert unter den Bedingungen von „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 inter- national”, CC BY-SA 4.0 (abrufbar unter: https://creativecommons.org/licenses/ by-sa/4.0/legalcode.de). ISBN 978-3-95721-546-8
Wandel der Sprach- und Debattenkultur in sozialen Online-Medien Ein Literaturüberblick zu Ursachen und Wirkungen von inziviler Kommunikation Anna Sophie Kümpel, Diana Rieger
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 5 2. Begriffsklärungen und Perspektive des Beitrags 9 3. Ursachen für die Wahrnehmung von mehr Inzivilität in sozialen Online-Medien 13 4. Wirkungen von Inzivilität in sozialen Online-Medien 19 5. Gegenmaßnahmen: Wie lässt sich Inzivilität in sozialen Online-Medien verhindern? 25 6. Fazit und Ausblick 31 Literaturverzeichnis 35
1. Einleitung
Online-Medien sind zu einem selbstverständlichen Weg für eine „democratic utopia“ (Papacharissi,
Bestandteil unseres Alltags geworden. Gemäß der 2004, S. 260) zu ebnen (siehe auch Chen, 2017,
ARD/ZDF-Onlinestudie sind mehr als 90 Prozent S. 38 ff.). Tatsächlich scheinen Nutzer*innen
der Deutschen online, mehr als die Hälfte von ihnen sozialer Online-Medien im Vergleich zu Face-to-
nutzt das Internet täglich (Frees & Koch, 2018). Ins- Face-Settings stärker gewillt, ihre eigene Meinung
besondere soziale Online-Medien spielen für viele zu vertreten und sich auch über sensible Themen
Nutzer dabei eine wichtige Rolle und wurden 2018 auszutauschen (Ho & McLeod, 2008). Dies wiede-
von mehr als 30 Prozent der Gesamtbevölkerung rum kann sich positiv auf das Kompetenz- und
mindestens einmal wöchentlich genutzt (ebd.). Autonomieerleben sowie den Zusammenhalt in
(virtuellen) Gruppen auswirken (für einen Über-
Während insbesondere soziale Netzwerksei- blick siehe Christopherson, 2007).
ten (SNS) wie Facebook und Twitter anfänglich
vor allem der interpersonalen Vernetzung und Die veränderten Kommunikationsbedingungen
Selbstdarstellung dienten, sind die Plattformen ziehen jedoch fraglos nicht nur positive Entwick-
indes auch zu einer zentralen Schnittstelle für die lungen nach sich. Soziale Online-Medien bieten
Medien-, Informations- und Nachrichtennutzung auch einen Nährboden für „Inzivilität“, die wir in
geworden (Hölig & Hasebrink, 2018; Kümpel, diesem Beitrag als Kommunikationsform definie-
2019). Angesichts der vielfältigen Potentiale für ren, die interpersonale oder deliberative Normen
Partizipation, Interaktion und Anschlusskommu- überschreitet und etwa in Form von aggressiven
nikation haben sie zudem dazu beigetragen, dass Nutzerkommentaren, Shitstorms, Flaming, Trolling
a) die Teilhabe an öffentlichen Diskursen dras- oder Hassrede in (teil-)öffentlich zugänglichen
tisch vereinfacht wurde, b) Nutzer*innen flexibel Diskussionen beobachtet werden kann (siehe das
zwischen Kommunikator- und Rezipientenrolle folgende Kapitel für eine ausführliche Begriffsklä-
wechseln können und c) journalistische Inhalte rung). Obwohl diese Beobachtung alles andere
sowie politische Debatten auch von „normalen“ als neu ist und bereits in frühen Arbeiten zu den
Bürgeren öffentlichkeitswirksam kommentiert sozialpsychologischen Aspekten computerver-
und problematisiert werden können (Neuberger, mittelter Kommunikation diskutiert wurde (siehe
2017). Dies gilt auch für weitere Formen sozialer z.B. Kiesler, Siegel, & McGuire, 1984), scheint das
Online-Medien wie Foren und Online-Communities, Risiko einer Konfrontation mit inzivilen Diskursen
Kommentarsektionen auf Nachrichten-Webseiten in sozialen Online-Medien zugenommen zu haben
sowie Videoplattformen und Wikis, denen wir uns (Coe, Kenski, & Rains, 2014; Kaakinen, Oksanen,
im Rahmen dieses Beitrags widmen werden. & Räsänen, 2018; Rost, Stahel, & Frey, 2016; Su
u. a., 2018). Eine Analyse von über 243 Millionen
Indem sie einen öffentlichen Raum bereitstellen, Nutzerkommentaren, die unter Beiträgen der
in welchem Nutzer*innen ihre eigenen Meinun- Facebook-Seiten von 42 US-Nachrichtenmedien
gen, Perspektiven und Fachkenntnisse einbringen hinterlassen wurden, zeigte jüngst, dass zwischen
können, wurde sozialen Online-Medien gerade in 25 und 41 Prozent dieser Posts inzivile Kommuni-
ihrer Anfangsphase ein hohes deliberatives Poten- kation enthalten (Su u. a., 2018).
zial zugeschrieben (Rowe, 2015b; Ruiz u. a., 2011).
Viele Beobachter*innen sahen nicht zuletzt in der Auch für Deutschland lassen sich einige Indikato-
Anonymität des Netzes die Möglichkeit, soziale ren für (eine Zunahme von) Inzivilität finden. So
Unterschiede zu nivellieren, einen produktiven brachte etwa die Einführung des Netzwerkdurch-
gesellschaftlichen Austausch zu fördern und so den setzungsgesetzes (NetzDG) – das SNS-Betreiber
5Wandel der Sprach- und Debattenkultur in sozialen Online-Medien
verpflichtet, Hassreden, beleidigende, verleum- diskutieren wir sowohl mögliche Ursachen der
dende und andere rechtswidrige Inhalte innerhalb Wahrnehmung einer inzivilen Sprach- und Debat-
von 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde zu tenkultur als auch Wirkungen auf die Nutzer*innen
sperren – eine entsprechende Berichtspflicht der sozialer Online-Medien. Der Fokus auf Inzivilität
Anbieter mit sich. Die Berichte offenbaren, dass soll dabei jedoch nicht suggerieren, dass die Kom-
Nutzer*innen von Facebook, Twitter, YouTube und munikation im Internet ausschließlich negative
Google+ im Zeitraum von Januar bis Juli 2018 mehr Effekte produziert oder gar provoziert. Er ergibt
als 500.000 Beiträge gemeldet haben (Gollatz, sich vielmehr aus der Annahme, dass die gesell-
Riedl, & Pohlmann, 2018). Daneben zeigen Berichte schaftlichen Auswirkungen in diesem Bereich
von jugendschutz.net, dass die Zahl von Verstößen grundsätzlich als gravierender erscheinen sowie
gegen Jugendschutzbestimmungen im Internet dem Ziel, eine Diskussion über mögliche Gegen-
von rund 6.000 registrierten Fällen im Jahr 2015 maßnahmen anzuregen. Auch solche Möglichkei-
(M. Glaser, Herzog, Özkilic, & Schindler, 2016) auf ten zur Verhinderung bzw. Verminderung von
über 7.500 im Jahr 2017 angestiegen ist (M. Glaser, Inzivilität nehmen wir in diesem Beitrag explizit
Herzog, Özkilic, & Schindler, 2018). Vor diesem in den Blick und bieten so Ansatzpunkte für die
Hintergrund ist es auch kaum verwunderlich, dass Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der
die überwiegende Mehrheit deutscher Jugendli- diskursiven Qualität.
cher angibt, in sozialen Online-Medien bereits mit
extremistischen Posts oder Hasskommentaren in
Kontakt gekommen zu sein (Reinemann, Nienierza,
Fawzi, Riesmeyer, & Neumann, 2019).
Es ist somit keine Übertreibung, wenn man Inzivi-
lität als zentrales Merkmal der Online-Kommuni-
kation beschreibt. Wer in sozialen Online-Medien
aktiv ist, trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit auf
Hass, Beleidigungen und Pöbeleien, die sich
sowohl auf einzelne Nutzer*innen und öffentli-
che Akteure als auch auf ganze gesellschaftliche
Gruppen beziehen können. Die aktive Nutzung
sozialer Online-Medien macht es jedoch nicht
nur wahrscheinlicher, mit Inzivilität in Kontakt zu
kommen, sondern auch selbst zum Opfer von ent-
sprechenden Kommunikationsformen zu werden
(Costello, Hawdon, & Ratliff, 2017; Ybarra, Mitchell,
Wolak, & Finkelhor, 2006). Neben den fraglos
schwerwiegenden Auswirkungen auf die jeweili-
gen Opfer, kann die Konfrontation mit Inzivilität
auch (unbeteiligte) Beobachter*innen selbst,
sowie deren Wahrnehmungen, Intentionen und
eigenes Kommunikationsverhalten beeinflussen.
Ein umfassendes Verständnis der Ursachen und
Wirkungen von Inzivilität in sozialen Online-Medien
ist daher unerlässlich.
Der vorliegende Beitrag widmet sich daher den
negativen Aspekten eines Wandels der Sprach-
und Debattenkultur in sozialen Online-Medien.
Im Rahmen eines narrativen Literaturüberblicks
62. Begriffsklärungen und
Perspektive des Beitrags
Wie eingangs beschrieben, fokussiert der vorlie- auf schriftliche Kommentare/Posts von Nut-
gende Beitrag auf Inzivilität (engl. incivility) in zer*innen), ist in der Definition auch der bildba-
sozialen Online-Medien. Bevor wir jedoch auf die sierte oder auditive Ausdruck von Inzivilität in
Ursachen und Wirkungen von inziviler Kommu- Form von sogenannten Memes, Videoclips oder
nikation eingehen, soll zunächst geklärt werden, Soundschnipseln mitgedacht. Im Rahmen dieser
was genau darunter zu verstehen ist und welche übergeordneten Definition lassen sich relevante
(Sub-)Phänomene wir im Rahmen unserer Analyse (Sub-)Phänomene unterscheiden, die zwar alle
in den Blick nehmen.1 als inzivil gelten können, sich jedoch insbeson-
dere mit Blick auf die Zielgerichtetheit der Kom-
Inzivilität gilt als „notoriously difficult term to munikation, das Ausmaß sowie die zugrundelie-
define“ (Coe u. a., 2014, S. 660) und wird je nach genden Beweggründe kontrastieren lassen.2
Schwerpunkt konkreter Studien und Projekte
unterschiedlich konzeptualisiert. Unser Fokus Ein insbesondere in den letzten Jahren zunehmend
liegt zunächst auf Inzivilität, die sich in (teil-)öffent- diskutiertes Phänomen ist die Online-Hassrede
lichen Diskussionen und Debatten auf sozialen (engl. hate speech), die den sprachlichen Ausdruck
Online-Medien manifestiert, somit prinzipiell für von Hass gegen gesellschaftliche Gruppen (so zum
andere Nutzer*innen beobachtbar ist und daher Beispiel aufgrund einer sexuellen Orientierung,
ein Problem auf gesellschaftlicher Ebene darstellt Religionszugehörigkeit, aufgrund des Geschlechts,
bzw. darstellen kann. Trotz dieses Fokus auf der Ethnie) beschreibt und sich insbesondere
öffentliche Kommunikation schließen wir sowohl durch die Verwendung von Ausdrücken auszeich-
Inzivilität auf persönlicher Ebene („personal-level net, die der Verunglimpfung und Herabsetzung
incivility“; Interaktionen, die sich durch Beleidi- eben dieser Gruppen dienen (siehe Blazak, 2009;
gungen, Respektlosigkeit und aggressive Kommu- Meibauer, 2013; Schmitt, 2017; unter dem Begriff
nikationsformen auszeichnen) als auch Inzivilität schädliche Rede [engl. harmful speech] auch Leets
auf öffentlichkeitstheoretischer Ebene („public-level & Giles, 1999). Hassrede kann in sozialen Online-
incivility“; Verstöße gegen kommunikative Normen Medien verschiedene Formen annehmen, wobei
des bürgerschaftlichen Diskurses sowie demokra- grundsätzlich zwischen offenen, „in your face“
tische Werte) in unsere Definition mit ein (Chen, und stärker verdeckten und impliziten Praktiken
2017; Coe u. a., 2014; Muddiman, 2017; Papacha- der Diskriminierung unterschieden werden kann
rissi, 2004). (Ben-David & Matamoros-Fernández, 2016; Bor-
geson & Valeri, 2004).
Wir verstehen Inzivilität in sozialen Online-Me-
dien auf dieser Basis als normüberschreitende Von der Online-Hassrede abzugrenzen sind
Kommunikation, die sich auf Normen der inter- sogenannte Shitstorms (außerhalb des deut-
personalen und/oder deliberativen Kommunika- schen Sprachraums wird in der Regel von online
tion bezieht und in (teil-)öffentlich zugänglichen firestorms gesprochen), die durch das plötzliche
Diskussionen auf sozialen Netzwerkseiten, Foren, und „sturmartige“ Auftreten von negativer Kritik
Online-Communities, Kommentarsektionen auf an Unternehmen oder im öffentlichen Interesse
Webseiten sowie Videoplattformen oder Wikis stehenden Personen charakterisiert sind (siehe
beobachtet werden kann. Obwohl der Großteil z.B. Johnen, Jungblut, & Ziegele, 2018; Pfeffer,
bisheriger Forschungsarbeiten auf textbasierte Zorbach, & Carley, 2014; Rost u. a., 2016). Inzivile
Formen von Inzivilität fokussiert (insbesondere Kommunikation ist hier jedoch nicht die Folge
9Wandel der Sprach- und Debattenkultur in sozialen Online-Medien
von Hass gegen grundlegende Attribute sozialer (Hmielowski, Hutchens, & Cicchirillo, 2014; Moor,
Akteure (z.B. Ethnie, Geschlecht), sondern viel- Heuvelman, & Verleur, 2010; O’Sullivan & Flana-
mehr von öffentlicher Missbilligung moralisch gin, 2003), ist davon abgesehen aber der am
fragwürdiger Handlungen oder Äußerungen wenigsten klar umrissene Begriff. Insbesondere
bekannter Personen oder Organisationen. Wie in frühen Arbeiten war Flaming häufig der Ober-
der namensgebende Sturm zeichnen sich Shit- begriff für eine Vielzahl inziviler Kommunikations-
storms durch ein plötzliches Auftreten und einen formen, wird in der wissenschaftlichen Auseinan-
ebenso schnellen Rückgang aus – die Inzivilität dersetzung jedoch immer seltener genutzt. Nicht
entlädt sich somit in einem relativ engen Zeitfens- zuletzt deshalb argumentieren einige Autor*in-
ter und ist in der Regel auf ein spezifisches, als nen (ausführlich etwa Jane, 2015), dass sich die
unmoralisch empfundenes, Ereignis fokussiert. Forschung weniger darauf fokussieren sollte, mit
„chirurgischer Präzision“ (S. 80) n ach Definitionen
Im Gegensatz zur Hassrede gelten Flaming und zu suchen, sondern die Aufmerksamkeit vielmehr
Trolling als Formen der Inzivilität, die primär auf die übergreifenden Probleme richten sollte,
den interaktionalen Normverstoß (persönliche die mit Inzivilität in sozialen Online-Medien in
Ebene von Inzivilität) beschreiben und sich in aller Verbindung stehen. Entsprechend wollen auch
Regel nicht auf gesellschaftliche Gruppen, son- wir in unserem Beitrag vorrangig auf generali-
dern konkrete Einzelpersonen beziehen. Und im sierbare Ursachen und Wirkungen von Inzivilität
Gegensatz zum Begriff des Shitstorms, der stark eingehen, ohne dabei jedoch die Besonderheiten
in einer Makrologik verhaftet ist und vor allem relevanter (Sub -)Phänomene zu ignorieren.3
bei einer beobachtbaren Häufung von Inzivilität
gegen öffentlich bekannte Akteure/Organisationen
genutzt wird, werden die Begriffe Flaming und
Trolling auch dann verwendet, wenn es sich um
singuläre und individuell eingesetzte Formen inzivi-
ler Kommunikation handelt.
Trolling wird vor allem mit Blick auf den disruptiven
Charakter der Kommunikation beschrieben und
lässt sich mit der Formel „Stören um des Störens
willen“ anschaulich beschreiben (siehe z.B. Buckels, 1 Während ein Wandel der Sprach- und Debattenkultur bzw.
Trapnell, & Paulhus, 2014; Craker & March, 2016; Erscheinungsformen von Inzivilität auch aus linguistischer
oder sprachphilosophischer Perspektive beleuchtet werden
Rieger, Dippolt, & Appel, im Druck). Sogenannte kann, nehmen wir in diesem Beitrag einen kommunika-
Trolle (d.h. Nutzer*innen, die Trolling-Verhalten tionswissenschaftlichen Standpunkt ein. Angesichts der
zeigen) verfolgen das Ziel, andere Nutzer*innen Interdisziplinarität des Fachbereichs berücksichtigen wir
dabei auch Arbeiten aus angrenzenden Bereichen der
bewusst zu provozieren und so zu emotionalen
(Sozial-)Psychologie oder Politikwissenschaft, sofern sie
Reaktionen zu bewegen. Die Auswahl der Opfer einen explizit sozialwissenschaftlichen Fokus haben und
erfolgt anders als bei Hassredner*innen nicht den Gegenstand unserer Analyse teilen.
systematisch, sondern eher willkürlich und oppor- 2 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die nachfol-
gend beschriebenen (Sub-)Phänomene – ähnlich wie der
tunistisch. Im Sinne der Begriffsherkunft – Trolling
von uns als Oberbegriff gewählte Term der Inzivilität – in
bezeichnet ursprünglich eine spezifische Angel- der wissenschaftlichen Auseinandersetzung sehr unter-
technik, bei der ein Köder hinter einem fahrenden schiedlich definiert und gemessen werden. Unsere Defini-
Boot hergezogen wird – sind dabei prinzipiell alle tionen beschreiben daher gewissermaßen den „kleinsten
gemeinsamen Nenner“.
Nutzer*innen gefährdet, die bei der Provokation
3 Explizit ausklammern werden wir in diesem Beitrag das
„anbeißen“. Phänomen des Cybermobbings bzw. Cyberbullyings (für
einen Überblick siehe Fawzi, 2015), da dieses in aller Regel
Flaming hingegen wurde zumeist hinsichtlich der auf eine sehr spezifische Form der Inzivilität unter Kindern
und Jugendlichen beschränkt ist und Wirkungen primär aus
Nutzung „aufgeheizter“ – im Sinne von aggres-
einer Opfer-Perspektive diskutiert.
siver und feindseliger – Sprache charakterisiert
103. Ursachen für die Wahr-
nehmung von mehr Inzivilität
in sozialen Online-Medien
Während die kommunikationswissenschaftliche Unsicherheit und Ungerechtigkeit umzugehen.
Forschung keine Aussagen darüber treffen kann, Insbesondere Mitglieder von – oft grob genera-
wie oder warum sich Sprache im linguistischen lisierten – Fremdgruppen müssen in solchen
Sinne verändert, kann sie dennoch Antworten dar- Situationen als Sündenbock herhalten und
auf finden, warum von vielen Beobachter*innen werden daher mit Inzivilität konfrontiert. Nach
in sozialen Online-Medien eine negative Verände- islamistisch motivierten Terroraktivitäten werden
rung der Sprach- und Debattenkultur sowie ein beispielsweise Muslim*innen häufig zu Opfern
Anstieg von Inzivilität wahrgenommen wird. von Hassrede, da sie aufgrund ihrer religiösen
Zugehörigkeit mit den Attentätern assoziiert
Dabei wäre zunächst die (1) gesteigerte Sichtbar- oder gleichgesetzt werden (siehe z.B. Awan, 2014,
keit und öffentliche Zugänglichkeit von Debat- 2016; Chetty & Alathur, 2018).
ten und Diskursen zu nennen (siehe z.B. Blom,
Carpenter, Bowe, & Lange, 2014, S . 1316–1317; Eng mit diesem ersten Punkt verbunden sind (2)
Chen, 2017, S. 58; Coe u. a., 2014, S. 658; Neu- vereinfachte Möglichkeiten zur schnellen und
baum & Krämer, 2017, S. 464; Neuberger, 2017, weiten Verbreitung von Inhalten. Die Affordanzen
S. 104). Insbesondere auf sozialen Netzwerkseiten sozialer Online-Medien regen in besonderem
haben die Nutzer*innen die Möglichkeit, eine Maße dazu an, Informationen und Diskussionen
Vielzahl von Unterhaltungen zu beobachten: Seien weiterzuverbreiten und mit anderen zu teilen
es Diskussionen unter den Tweets von Donald (Kümpel, Karnowski, & Keyling, 2015; Osatuyi,
Trump, Debatten in den Kommentarspalten 2013), was die Sichtbarkeit – insbesondere von
von auf Facebook geteilten Nachrichtenartikeln hitzigen Debatten – weiter erhöht. So spricht
oder Threads zu aktuellen politischen Themen in eine Vielzahl an Studien dafür, dass vor allem
Online-Communities wie Reddit. Die „socially medi- emotional aufgeladene und erregende Inhalte in
ated publicness“ (Baym & boyd, 2012) von SNS sozialen Online-Medien eine weite Verbreitung
ermöglicht Nutzer*innen dabei jedoch nicht nur erfahren (z.B. Berger, 2011; Hasell & Weeks,
das Zuschauen, sondern auch die aktive eigene 2016; Stieglitz & Dang-Xuan, 2013). Im Kontext
Teilnahme. Wer über ein entsprechendes Benut- der US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2012 etwa
zerkonto verfügt, kann sich nahezu aufwandslos finden Hasell und Weeks (2016), dass Ärger positiv
selbst in Diskussionen einschalten. Ein Interesse an mit dem Teilen von politischen Informationen in
der Teilnahme an oder zumindest der Beobach- Verbindung steht: Nutzer*innen, die aufgrund
tung von Diskursen in sozialen Online-Medien ihrer Mediennutzung wütend auf den jeweils
scheint vor allem bei akuten gesellschaftlichen gegnerischen Präsidentschaftskandidaten waren,
Veränderungen oder disruptiven Ereignissen teilten und kommentierten häufiger Beiträge in
(z.B. nach Terroranschlägen) zuzunehmen. Stu- sozialen Online-Medien – was die empfundene
dien in diesem Bereich suggerieren, dass derar- Wut somit auch für (viele) weitere Nutzer*innen
tige Situationen oder Vorfälle zudem zu einem sichtbar machte. Komplementiert werden diese
Anstieg von Inzivilität führen können (Kaakinen früheren Befunde durch eine aktuelle Analyse der
u. a., 2018; Oksanen u. a., 2018): So ist etwa die auf Facebook meistgeteilten und -kommentierten
Verwendung von Hassrede für manche Nutzer*in- Nachrichtenbeiträge. Weiterverbreitet und disku-
nen ein (Aus-)Weg, um mit der empfundenen tiert wurden im ersten Quartal 2019 vorrangig jene
13Wandel der Sprach- und Debattenkultur in sozialen Online-Medien
Meldungen, die Angst induzieren oder polari- Klarnamen erbitten (und sich viele Nutzer*innen –
sieren, beispielsweise Posts über Abtreibungen etwa bei Facebook – angesichts des Vernetzungs-
oder illegale Immigration (Owen, 2019). Dies gedankens daran orientieren), gibt es vielfältige
wiederum lässt den dazugehörigen Diskussionen Möglichkeiten, die eigene Identität zu verbergen.
mutmaßlich noch mehr Aufmerksamkeit zuteil- Schon früh wurde argumentiert, dass die (relative)
werden, da die Algorithmen sozialer Netzwerk- Anonymität computervermittelter Kommunikati-
seiten jene Beiträge, die viel Auseinandersetzung onsräume zu Enthemmung und einer Verringe-
(engl. engagement) in Form von Shares, Likes oder rung des Verantwortungsbewusstseins beitrage
Kommentaren provozieren, prominenter im und Nutzer*innen online Handlungen ausführen,
Neuigkeiten-Bereich anderer Nutzer*innen plat- die sie in der persönlichen Kommunikation nie
zieren (DeVito, 2017; Owen, 2018). Argumentiert erwägen würden (Postmes, Spears, & Lea, 1998;
wird vor diesem Hintergrund auch, dass soziale Suler, 2004). Der Zusammenhang von Anonymität
Online-Medien Verbreiter*innen von Hass unab- und unmoralischem Verhalten wurde darüber
sichtlich dazu verhelfen können, ihre aggressiven hinaus jedoch auch mit Prozessen der Deindividu-
Ansichten und Aussagen in Diskussionen einzu- ation erklärt (Kiesler u. a., 1984; Reicher, Spears,
schleusen. Klein (2012) spricht in diesem Zusam- & Postmes, 1995; Spears & Lea, 1994). So geht
menhang von „Information Laundering“ und das in der Sozialpsychologie entwickelte SIDE-
beschreibt damit die Idee, dass soziale Online- Modell (social identity model of deindividuation
Medien Hass-Gruppen und vergleichbare Akteure effects) davon aus, dass Anonymität die Zugehö-
dazu befähigen, ihre „illegale Währung“ (in rigkeit zu sozialen Gruppen bewusster machen
diesem Fall: Hassbotschaften) reinzuwaschen und kann und so die Orientierung an (wahrgenomme-
in Umlauf zu bringen. Am Beispiel von extremen nen) Gruppennormen steigert. Ein abschätziger
politischen Parteien und Organisationen in Spa- Kommunikationsstil erscheint in manchen Foren
nien zeigen Ben-David und Matamoros-Fernández oder Kommentarspalten als „ganz normal“ und
(2016) diesbezüglich, wie sowohl offene Hassrede prägt so auch das Verhalten von neuen Diskussi-
und eher subtilere Formen von Diskriminierung onsteilnehmer*innen (Chen & Lu, 2017; Hsueh,
über Facebook in Zirkulation gebracht werden. Yogeeswaran, & Malinen, 2015; Sood, Antin, &
Die Autor*innen diskutieren dabei auch die Churchill, 2012; Stroud, Scacco, Muddiman, &
Rolle der SNS-Anbieter kritisch, die einerseits die Curry, 2015; Sukumaran, Vezich, McHugh, & Nass,
Verbreitung von Hassrede und Inzivilität offiziell 2011). Analog zur sogenannten Broken-Win-
verbieten, andererseits aber durch Share-, Like- dows-Theorie (Wilson & Kelling, 1982), nach der
und Kommentar-Features die ideale Infrastruktur ein Zusammenhang zwischen dem Verfall von
für „the circulation and accumulation of subtle Stadtteilen und der dort beobachteten Delinquenz
associations of hate and discrimination“ (ebd., besteht, kann so auch für inzivile Online-Diskus-
S. 1187) bereitstellen. sionen ein negativer Ausstrahlungseffekt auf
andere beteiligte Akteure angenommen werden.
Sprechen diese ersten beiden Aspekte vorrangig Wird indes eine positive und zivile Diskussionsat-
für eine stärkere Wahrnehmung eines Wandels der mosphäre geschaffen, so verbessert sich auch das
Sprach- und Debattenkultur hin zu mehr Inzivili- Kommunikationsverhalten der Teilnehmer*innen
tät, gibt es Hinweise darauf, dass (3) veränderte sichtlich (Fredheim, Moore, & Naughton, 2015).
Kommunikationsbedingungen und (Gruppen-) Ob Anonymität per se tatsächlich mit mehr Inzivil-
Normen in sozialen Online-Medien negatives ität in der Kommunikation in Verbindung steht, ist
Kommunikationsverhalten in der Tat forcieren nicht eindeutig zu beantworten. Während einige
können. Viel diskutiert wurde in diesem Kontext Studien für einen solchen Zusammenhang spre-
die Rolle von Anonymität (siehe z.B. Brown, 2018; chen (Rowe, 2015b; Santana, 2014; Zimmerman
Matzner, 2016; Puryear & Vandello, 2018; Rösner & Ybarra, 2016), finden andere keine Effekte von
& Krämer, 2016; Rowe, 2015a; Santana, 2014; Anonymität auf die Diskussionsqualität oder die
Zimmerman & Ybarra, 2016). Auch wenn einige Nutzung aggressiver Sprache (Berg, 2016; Rösner
soziale Online-Medien die Verwendung von & Krämer, 2016).
143. Ursachen für die Wahrnehmung von mehr Inzivilität in sozialen Online-Medien
Die in sozialen Online-Medien erlebbare Anonym- oder die eigene soziale Identität als bedroht erlebt
ität geht jedoch mit weiteren Besonderheiten der werden (J. Glaser, Dixit, & Green, 2002). Während
Kommunikationssituation einher, die ebenfalls Inzivilität in diesen Fällen eher als unbeabsichtigte
(negative) Auswirkungen auf Struktur und Inhalt Folge eines konkreten kommunikativen Ziels
von Debatten haben können. Da die meisten entsteht, gibt es auch Hinweise darauf, dass inzi-
Diskussionen auch in Online-Settings textbasiert vile Kommunikationsformen bewusst eingesetzt
stattfinden, fehlt es an zentralen sozialen Hinweis- werden, um sich von einer – wie auch immer im
reizen, die im Face-to-Face-Kontext der Regulation Einzelfall definierten – Fremdgruppe abzuset-
von Kommunikation dienen (siehe z.B. Brown, zen und so wiederum den Zusammenhalt in der
2018; Dutton, 1996; Joinson, 2007; Kiesler u. a., Eigengruppe zu stärken (Upadhyay, 2010). Dabei
1984; Lapidot-Lefler & Barak, 2012; Postmes spielt auch eine Rolle, wie stark die Eigengruppe
u. a., 1998; Suler, 2004). Die Unsichtbarkeit der symbolisch bedroht wird: In rassistischen Cha-
Gesprächspartner*innen, das Fehlen von Augen- träumen in den USA etwa wurden Themen wie
kontakt sowie der Wegfall von Gestik, Mimik und die interkulturelle („gemischtrassige“) Ehe oder
Intonation können dazu beitragen, dass Inzivilität der Zuzug von Afroamerikaner*innen in „weiße“
von den Nutzer*innen sozialer Online-Medien als Nachbarschaften als Auslöser von Inzivilität
weniger schwerwiegend und verletzend wahrge- identifiziert (J. Glaser u. a., 2002). Motivationen in
nommen wird. Entsprechend gibt es deutlich Zusammenhang mit der Abgrenzung „Wir” gegen
weniger Hemmnisse, sich aggressiver, beleidigen- „die Anderen” zeigen sich auch für die Verbreitung
der oder hasserfüllter Kommunikationsformen von Online-Hassreden: Die verbale Herabwürdi-
zu bedienen. gung einer Fremdgruppe zielt explizit auf deren
Ausgrenzung, bestätigt aber gleichermaßen auch
Fokussiert man auf die Ursachen eines Wandels die eigene Gruppenidentität (McNamee, Peterson,
der Sprach- und Debattenkultur, dürfen insbe- & Peña, 2010; Schmitt, 2017). Interessanterweise
sondere aus kommunikationswissenschaftli- kann aber auch das couragierte Einschreiten in
cher Perspektive schließlich auch (4) motivatio- hasserfüllte Online-Diskussionen (mehr) Hass
nale Aspekte und Persönlichkeitsmerkmale produzieren: Wer sich an Diskussionen mit
nicht außer Acht gelassen werden. Ein Wissen Hassrede-Anteilen beteiligt, wird mit größerer
darüber, warum und welche Nutzer*innen inzivile Wahrscheinlichkeit selbst zum Opfer (Costello
und aggressive Kommentare schreiben, Hass- u. a., 2017).
botschaften verbreiten, oder trollen, ist daher
ebenso wichtig wie der Blick auf die veränderten Mit Blick auf Persönlichkeitsmerkmale und
Informationsumgebungen und Kommunika- situative Einflüsse zeigt sich zudem, dass eine
tionsbedingungen. Ein Grund dafür, warum Disposition für verbale Aggression (Cicchirillo,
Diskussionen in sozialen Online-Medien schnell Hmielowski, & Hutchens, 2015; Hmielowski u. a.,
hitzig oder aggressiv werden können, lässt sich 2014), schlechte Stimmung (Cheng, Bernstein,
bereits aus generellen Motiven des Kommentier- Danescu-Niculescu-Mizil, & Leskovec, 2017),
ens ableiten: Viele Nutzer*innen verfassen Kom- die Suche nach Aufmerksamkeit (Shachaf &
mentare, wenn sie Kritik oder Widerspruch üben Hara, 2010) sowie Psychopathie (im Sinne eines
oder sich von aufgestauten Emotionen befreien mangelnden Empathievermögens) und Sadismus
wollen – Wut, Ärger und Empörung spielen dabei (Buckels u. a., 2014; Craker & March, 2016) mit
eine bedeutsame Rolle und spiegeln sich häufig Trolling-Verhalten und Inzivilität in Verbindung
auch im Kommunikationsverhalten wider (Moor stehen. Einige Nutzer*innen scheinen darüber
u. a., 2010; Springer, 2014; Upadhyay, 2010; hinaus durch Unterhaltungsmotive angetrieben
Ziegele, 2016). Besonders wahrscheinlich ist ein zu sein: So werden in der Literatur auch Spaß
solches aggressives Kommunikationsverhalten und Nervenkitzel sowie die Freude am Schädigen
dann, wenn in Diskussionen ein Angriff auf die anderer als Auslöser für Trolling und Online-
eigenen (politischen) Ansichten wahrgenommen Hassrede diskutiert (Schmitt, 2017; Shachaf &
wird (Hutchens, Cicchirillo, & Hmielowski, 2015) Hara, 2010). Erjavec und Kovačič (2012) beschreiben
15Wandel der Sprach- und Debattenkultur in sozialen Online-Medien
diese Nutzer*innen auch als „die Spieler” (engl.
The Players), die nicht auf Basis innerer Überzeu-
gungen handeln, sondern lediglich Unterhaltung
aus der Demütigung anderer ziehen.
Zusammenfassend lässt sich mithin festhalten,
dass eine Kombination aus individuellen Motiv
lagen, den für soziale Online-Medien spezifischen
Kommunikationsbedingungen sowie der gestei-
gerten Sichtbarkeit und den einfachen Möglich-
keiten zur Weiterverbreitung von Debatten und
Diskursen dazu beigetragen hat, dass wir in
Kommunikationsräumen im Internet verstärkt
Negativität und Inzivilität wahrnehmen können.
Doch was bedeutet das für diejenigen, die diesen
Diskussionen ausgesetzt sind? Welche Wirkun-
gen hat die Beobachtung von Hass und Respekt-
losigkeit – sowohl auf (unbeteiligte) Nutzer*innen
als auch die von Inzivilität Betroffenen? Diesen
Fragen wird nun im nächsten Teil des Beitrags
nachgegangen.
164. Wirkungen von Inzivilität
in sozialen Online-Medien
Beschäftigt man sich in der Kommunikations gibt es jedoch bestimmte Reize, die „kollektive
wissenschaft mit der Wirkung von „klassischen“ Relevanz” besitzen und bei einer Vielzahl von
Medieninhalten (z.B. journalistische Texte, Nutzer*innen Aufmerksamkeit generieren können
Videobeiträge) oder anderen, zum Teil unmit- (Eilders, 1997, S. 92 ff.). Zurückführen lässt sich dies
telbar damit in Verbindung stehenden Kommu- unter anderem auf evolutionäre Aspekte (z.B. indi-
nikaten (z.B. Nutzerkommentare auf Facebook, ziert das Merkmal „Schaden“ in Kommunikaten ein
Twitter-Tweets), lassen sich grundsätzlich drei Gefahrenpotenzial, welches es zu untersuchen gilt),
Wirkungsbereiche unterscheiden (siehe Schenk, geteilte Werte und Normen sowie stärker automa-
2007, S. 767): Wirkungen auf (1) Einstellungen, tisierte Verarbeitungsprozesse (ebd.). Inzivilität im
Meinungen und Verhalten, (2) Stimmungen und von uns definierten Sinne verfügt potenziell gleich
Emotionen sowie (3) Vorstellungen und Wissen. über mehrere Merkmale, die intersubjektiv die
Auch Inzivilität in Diskussionen und Debatten auf Beurteilung von Relevanz prägen können. So sind
sozialen Online-Medien kann derartige Wirkungen etwa Online-Hassrede oder Shitstorms häufig mit
bei Teilnehmer*innen und Beobachter*innen her- etwaigem oder tatsächlichem Schaden verbunden
vorrufen und beispielsweise die Wahrnehmung von und zeichnen sich nicht zuletzt auf diskursiver
Themen, die emotionale Erregung oder Vorstellun- Ebene durch Kontroverse bzw. Konflikthaftigkeit
gen von gesellschaftlichen Gruppen beeinflussen aus. Befunde zur Wahrnehmung von Nachrichten-
(ausführlich siehe unten). Die obige Dreiteilung beiträgen zeigen, dass diese Faktoren (bei Vorkom-
soll jedoch nicht suggerieren, dass sich Effekte men in journalistischen Texten) Relevanzurteile
immer nur in einem Teilbereich zeigen – Medien- der Rezipient*innen positiv beeinflussen: Texte,
wirkungen sind in aller Regel komplex, bedingen die kontrovers sind und Schäden bzw. negative
und beeinflussen sich gegenseitig. Zudem trifft Konsequenzen thematisieren, werden als wich-
jedes Kommunikat stets auf Individuen mit je tiger und bedeutsamer wahrgenommen (Weber &
unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen Wirth, 2013). Demnach ist anzunehmen, dass auch
und Voreinstellungen, die sich in je unterschiedli- in sozialen Online-Medien beobachtete inzivile
chen Situationen und Stimmungen befinden. Diskussionen eine gewisse kollektive Relevanz
besitzen, entsprechend aufmerksam(er) wahrge-
Damit Medieninhalte und andere Kommunikate nommen werden und so weiterführende Wirkun-
auf Nutzer*innen wirken können, müssen gewisse gen auf die Beobachter*innen haben können.
Voraussetzungen erfüllt sein. Die schiere Menge Das genaue Ausmaß ist dabei jedoch von Person
an uns umgebenden (medialen) Reizen erfordert zu Person verschieden.
es, eine Auswahl zu treffen: Nur Inhalte, die
willkürlich oder unwillkürlich die Aufmerksamkeit Subjektivität kennzeichnet nicht nur die Aufmerk-
einer Nutzer*in erregen, sind überhaupt in der samkeit gegenüber Inzivilität, sondern auch die
Lage, Wirkungen zu entfalten (Schweiger, 2007, inhaltliche Wahrnehmung des Kommunikats. Wie
S. 137–138). Aufmerksamkeitsprozesse sind das oben bereits beschrieben, ist (In-)Zivilität in der
Resultat eines individuell verschiedenen Wechsel- Literatur ganz unterschiedlich definiert worden,
spiels aus Reiz/Inhalt und Reaktion/Person und was auch daran liegt, dass es „very much in the
somit nicht für alle Nutzer*innen gleich. Kurzum: eye of the beholder” (Herbst, 2010, S. 3) liegt,
Was einigen sofort ins Auge springt, nehmen ob eine Debatte oder Diskussion als inzivil oder
andere vielleicht erst auf den zweiten oder dritten aggressiv wahrgenommen wird (siehe auch Coe
Blick wahr. Trotz aller subjektiven Unterschiede u. a., 2014, S. 660). Ähnlich wie die beschrie-
19Wandel der Sprach- und Debattenkultur in sozialen Online-Medien
benen kollektiven Relevanzzuweisungen gibt es leg*innen (2016) haben die Forscher*innen den
aber auch bei der Wahrnehmung von Inzivilität Befragten verschiedene Statements vorgelegt,
übergreifende Tendenzen, die sich bei einer die als echte Kommentare auf einer Nachricht-
Mehrheit von Beobachter*innen zeigen. Mit en-Webseite ausgegeben wurden. Diese State-
einem spezifischen Fokus auf politische Inzivil- ments sollten dann in Hinblick auf ihre Inzivilität
ität (d.h., Inzivilität in politischen Diskussionen bewertet werden. Beleidigungen wurden auch in
zwischen Politiker*innen, den Medien und dieser Studie als inzivilste Form der Kommunika-
Bürger*innen) haben Stryker und Kolleg*innen tion wahrgenommen, dicht gefolgt von vulgären
(2016) untersucht, inwieweit Konsens darüber Äußerungen. Die Befunde offenbaren darüber
besteht, welche Kommunikationsformen als inzivil hinaus jedoch auch, welche Eigenschaften einer
wahrgenommen werden. Dafür haben sie die Person mit dem Empfinden von Inzivilität in
Teilnehmer*innen ihrer Studie mit 23 potenziell Zusammenhang stehen. Diesbezüglich zeigte
inzivilen Handlungen konfrontiert (u.a. Nutzung sich, dass Frauen die vorgelegten Statements
vulgärer Sprache, Beschimpfungen, Androhung grundsätzlich als inziviler beurteilen als Männer.
von Gewalt, persönliche Angriffe) und sie gebeten, Gleichermaßen scheinen Personen, bei denen das
die Inzivilität dieser Handlungen zu bewerten. Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit stärker
Dabei zeigte sich zunächst, dass die von den ausgeprägt ist (d.h., die sich als kooperativ und
Forscher*innen vorgelegten Handlungen von über mitfühlend begreifen), mehr Inzivilität in den
75 Prozent der Teilnehmer*innen als zumindest Kommentaren wahrzunehmen. Es lässt sich also
etwas inzivil wahrgenommen wurden. Die größte schlussfolgern, dass – obwohl bestimmte inzivile
Einigkeit zeigte sich bei der Androhung von Gewalt Kommunikationsformen von fast allen Nutzer*in-
sowie der Nutzung von rassistischen, religiösen, nen als solche wahrgenommen werden – Merk-
ethnischen oder sexistischen Beleidigungen – male wie Geschlecht und spezifische Persönlich-
diese Handlungen wurden von 82 bis 87 Prozent keitseigenschaften die Beurteilung von Inzivilität
der Befragten als sehr inzivil empfunden.1 Im beeinflussen können. Dies wiederum kann in
Gegensatz dazu wurden Attacken auf die inhaltli- einem nächsten Schritt auch weiterführende
chen Standpunkte eines politischen Gegners von Wirkungen der (inzivilen) Aussagen verändern.
der Mehrheit nicht als inzivil wahrgenommen, was
auf die Unterschiede zwischen themen- und per- Die Wirkung von Inzivilität wurde bislang vor allem
sonenbezogenen Angriffen verweist. Obschon die im Kontext von Nutzerkommentaren auf Nach-
Studie erste Hinweise auf die (geteilte) Wahrneh- richten-Webseiten untersucht. Ausgangspunkt
mung von Inzivilität zulässt, ist sie durch den auss- vieler Studien war häufig die Frage, ob und inwief-
chließlichen Fokus auf politische Inzivilität sowie ern inzivile Äußerungen in Kommentaren für die
den fehlenden expliziten Bezügen zu Merkmalen journalistische Arbeit relevante Wahrnehmungen
internetbasierter Kommunikation nicht vollstän- und Verhaltensintentionen der Rezipient*innen
dig auf die Situation in sozialen Online-Medien beeinflussen. Empirische Untersuchungen haben
übertragbar. wiederholt gezeigt, dass Nutzerkommentare –
zunächst ganz unabhängig vom Grad ihrer (In-)
Diese Lücke schließen Kenski und Kolleg*innen Zivilität – individuelle Vorstellungen, Meinungen
(2017), die einerseits die Frage aufwerfen, ob und und Verhaltensweisen beeinflussen können (für
inwiefern fünf in Online-Nutzerkommentaren vor- einen Überblick siehe Ksiazek & Springer, 2018;
kommende Formen von Inzivilität (Beschimpfun- Springer & Kümpel, 2018). In sozialen Online-
gen, Vulgarität, Lügenvorwürfe, Verunglimpfung Medien beobachtbare Meinungsäußerungen
von Sprache, Verleumdung) als unterschiedlich scheinen also in der Tat wichtige Anhaltspunkte
(in-)zivil wahrgenommen werden, andererseits dafür zu liefern, wie (kontroverse) Themen oder
aber auch untersuchen, ob soziodemographische die Berichterstattung selbst beurteilt werden kön-
Charakteristika und Persönlichkeitsmerkmale nen. Inzivilität in Kommentaren wurde vor allem
diese Wahrnehmungen beeinflussen. Im Ansatz deshalb häufig untersucht, da – wie eingangs
ähnlich zu dem Vorgehen von Stryker und Kol- beschrieben – von einem hohen Anteil inziviler
204. Wirkungen von Inzivilität in sozialen Online-Medien
Kommunikationsformen ausgegangen werden negative Auswirkungen auf die Wahrnehmung
muss und negative Wirkungen hier als besonders der Glaubwürdigkeit des kommentierten Artikels
wahrscheinlich erscheinen. sowie auf die Beurteilung der Wichtigkeit bzw.
Relevanz des im Artikel behandelten Themas.
Die verfügbaren Studien zu den Effekten inziviler Des Weiteren gibt es Hinweise darauf, dass inzi-
Nutzerkommentare sozialer Online-Medien lassen vile Kommentare zur Polarisierung von Wahrneh-
sich primär drei Bereichen zuordnen. So wurden mungen und Meinungen beitragen können
hauptsächlich Einflüsse auf (1) medien- bzw. jour- (Anderson, Brossard, Scheufele, Xenos, & Ladwig,
nalismusbezogene Perzeptionen (z.B. Wahrneh- 2014; Suhay, Bello-Pardo, & Maurer, 2018). Am
mung journalistischer Qualität, Wahrnehmung von Beispiel der Berichterstattung zu Nanotechnologie
in der Berichterstattung verhandelten Themen, zeigen etwa Anderson und Kolleg*innen (2014),
Wahrnehmung von Einseitigkeit und Verzerrun- dass bei Individuen, die Nanotechnologie kritisch
gen), (2) Emotionen und (aggressive) Verhaltensin- gegenüberstehen, die Konfrontation mit inzivilen
tentionen sowie (3) das Kommunikationsverhalten Kommentaren dazu führt, dass die Technologie
der Nutzer*innen adressiert. Daneben gibt es als (noch) risikoreicher wahrgenommen wird. Die
weitere Untersuchungen, die sich mit der Wirkung Befunde lassen somit insgesamt keine positiven
auf die von Inzivilität Betroffenen beschäftigen Schlussfolgerungen für Journalist*innen und
und in den Blick nehmen, was die Konfrontation Medienanbieter zu. Die experimentelle Forschung
mit inziviler Kommunikation bei den eigentlichen zu Inzivilität und Negativität in Nutzerkommen-
Opfern bewirkt. taren zeigt einhellig, dass die Wahrnehmung
redaktioneller Angebote selbst dann durch
Mit Blick auf den ersten Teilbereich, (1) medien- Meinungsäußerungen in sozialen Online-Medien
bzw. journalismusbezogene Perzeptionen, zeigt beeinflusst wird, wenn die Inhalte keine begrün-
sich zunächst, dass inzivile Kommentare beein- dete Beanstandung zulassen. Dies wiederum kön-
flussen können, wie Nutzer*innen die allgemeine nte langfristig in einen Vertrauensverlust2 sowie
Qualität, Objektivität oder Glaubwürdigkeit von einen Anstieg von Medienverdrossenheit mün-
Nachrichtenbeiträgen wahrnehmen. Eine Studie den und so den demokratischen Diskurs (noch)
von Prochazka, Weber und Schweiger (2018) weiter gefährden: „A lack of trust in government,
offenbart diesbezüglich, dass ein und derselbe unwillingness to associate with people who do not
Nachrichtenartikel als qualitativ minderwertiger share one’s views, and increased skepticism of
wahrgenommen wird, wenn er von inzivilen Kom- the media have the potential to do damage to the
mentaren begleitet wird (ähnlich für Kommentare way our democracy functions” (Han, Brazeal, &
mit negativer Valenz auch Dohle, 2018; Kümpel Pennington, 2018, S. 3).
& Springer, 2016; Kümpel & Unkel, im Druck).
Interessanterweise führt aber die Präsenz ziviler Neben den Auswirkungen auf medien- bzw.
Kommentare umgekehrt nicht zu einer Verbesse- journalismusbezogene Perzeptionen wurden in
rung von Qualitätswahrnehmungen: Tatsächlich weiteren Forschungsarbeiten mögliche Effekte
scheint bereits die schiere Präsenz von Kommen- von Inzivilität auf (2) Emotionen und (aggressive)
taren zu bewirken, dass Nutzer*innen die Qualität Verhaltensintentionen untersucht. Die zentrale
journalistischer Beiträge negativer evaluieren Frage in diesem zweiten Teilbereich ist also, ob
(Prochazka u. a., 2018). Zu ähnlich ernüchternden die Konfrontation mit inziviler Kommunikation
Befunden kommen auch Houston, Hansen und zu Ärger, negativen Emotionen oder eigenem
Nisbett (2011) sowie Anderson und Kolleg*innen aggressiven Verhalten beitragen kann. Tatsächlich
(2018), die im Kontext von Nutzerkommentaren zeigen sich auch hier die schon im ersten Teilbe-
auf Nachrichten-Webseiten bzw. Blogs dokumen- reich festgestellten Ausstrahlungseffekte. Wer in
tieren, dass Inzivilität in Kommentaren die Berich- sozialen Online-Medien inzivilen Kommentaren
terstattung über politische Akteure sowie objektiv ausgesetzt ist, berichtet über ein Mehr an nega-
neutrale Blogbeiträge als verzerrter erscheinen tiven Emotionen und Wutgefühlen (Chen & Lu,
lässt. Waddell (2018) identifiziert darüber hinaus 2017; Gervais, 2015; Wang & Silva, 2018). Gervais
21Wandel der Sprach- und Debattenkultur in sozialen Online-Medien
(2015) findet zudem heraus, dass dies insbeson- der Kommunikation in sozialen Online-Medien
dere dann der Fall ist, wenn Nutzer*innen mit kann also auf eine Art des Beobachtungslernen
inzivilen Beiträgen konfrontiert werden, die sich zurückgeführt werden (ebd.): Je nach prävalenter
gegen ihr eigenes politisches Lager richten: Wer Diskussionsatmosphäre kann demnach mit nega-
das Gefühl hat, dass die eigene Seite angegriffen tiven oder positiven Effekten gerechnet werden.
wird, ist nach der Rezeption inziviler Kommen- Dies wiederum verdeutlicht die Wichtigkeit eines
tare gekränkt und verärgert. Eine Studie von aktiven Community Managements und Moderati-
Rösner, Winter und Krämer (2016) deutet des onsstrategien, denen wir uns bei der Diskussion
Weiteren darauf hin, dass die Rezeption aggres- von Gegenmaßnahmen an späterer Stelle noch
siver Nutzerkommentare auch bei unbeteiligten ausführlicher widmen werden.
Beobachter*innen zu aggressiven Gedanken
führen kann, während Chen und Lu (2017) gar Während die genannten Bereiche allesamt auf
einen Zusammenhang mit aggressiven Verhal- die Auswirkungen auf ordinary citizens fokussie-
tensintentionen feststellen. Online-Inzivilität ren, widmen sich einige Studien auch der Frage,
scheint somit nicht nur Gemütslage und Gedan- wie sich die Konfrontation mit Inzivilität auf
ken zu beeinflussen , sondern potenziell auch spezifische Personengruppen auswirkt. Beson-
behaviorale Konsequenzen nach sich zu ziehen. deres Interesse galt dabei den Einflüssen auf
Journalist*innen, da diese im Kontext von Kom-
Eine spezifische Form von behavioralen Konse- mentarsektionen auf Nachrichten-Webseiten
quenzen nimmt der dritte der oben identifizierten oder SNS-Profilen häufig das primäre Ziel von
Teilbereiche in den Blick: die Auswirkungen von inzivilen Kommunikationsformen sind (Binns,
inziviler Kommunikation auf (3) das Kommunika- 2017; Chen u. a., 2018; Nilsson & Örnebring, 2016;
tionsverhalten der Nutzer*innen. Dieser Aspekt Obermaier, Hofbauer, & Reinemann, 2018; Post
wurde in diesem Bericht bereits bei den Ursachen & Kepplinger, 2019; Preuß, Tetzlaff, & Zick, 2017).
des Wandels der Sprach- und Debattenkultur Eine Studie unter schwedischen Journalist*innen
angesprochen, kann aber auch als Wirkung von zeigte bereits im Jahr 2013, dass drei Viertel der
inziviler Kommunikation konzeptualisiert und Befragten bereits beleidigende oder missbräuch-
untersucht werden. Die im vorhergehenden liche Kommentare erhalten haben (Nilsson &
Absatz beschriebene Studie von Chen und Lu Örnebring, 2016). Ganz ähnliche Verhältnisse
(2017) etwa hat nicht nur gezeigt, dass inzivile wurden für Deutschland beobachtet: 74 Prozent
Kommentare zu mehr negativen Emotionen und der von Post und Kepplinger (2019) befragten
aggressiven Intentionen führen, sondern auch, Journalist*innen mussten bereits eigene Erfahrun-
dass Inzivilität in Kommentaren es wahrschein- gen mit inzivilen Kommentaren sammeln. Auch
licher macht, dass die Nutzer*innen in eigenen schwerwiegende Varianten in Form von Hassrede
kommunikativen Beiträgen ebenfalls auf Inzi- scheinen mittlerweile zum journalistischen Alltag
vilität zurückgreifen. Ähnlich finden Hsueh und zu gehören und werden von Journalist*innen als
Kolleg*innen (2015), dass in Diskussionsumge- wachsendes Problem wahrgenommen (Ober-
bungen mit vorurteilsbehafteten Kommentaren maier u. a., 2018). Auf individueller Ebene kann
(im konkreten Fall ging es um Ressentiments die Konfrontation mit Inzivilität dazu führen, dass
gegenüber Asiat*innen) auch neu hinzukom- sich Journalist*innen eingeschüchtert fühlen und
mende Teilnehmer*innen Kommentare verfas- versuchen, die Berichterstattung über bestimmte
sen, die solche Vorurteile beinhalten. Allerdings konfliktbeladene Themen zu vermeiden oder
scheint im Bereich Kommunikationsverhalten zumindest weniger konfliktreich darzustellen
auch ein umgekehrter (positiver) Effekt zu beste- (Binns, 2017; siehe auch European Federation of
hen: Beobachten Nutzer*innen zivile Diskussio- Journalists, 2017; Post & Kepplinger, 2019). Auch
nen, so gleichen sie ihre eigenen Äußerungen fühlen sie sich häufiger angegriffen, zweifeln
an diese produktiven Gesprächsnormen an und eher an ihrem Zielpublikum und erleben mehr
verhalten sich gleichermaßen zivil (siehe z.B. Han Ärger und negative Emotionen (Obermaier u. a.,
& Brazeal, 2015; Sukumaran u. a., 2011). Die Art 2018; Post & Kepplinger, 2019). Um mit Inzivilität
224. Wirkungen von Inzivilität in sozialen Online-Medien
umzugehen, setzen betroffene Journalist*innen Doch auch langfristige Auswirkungen auf Einstel-
vor allem emotionale Bewältigungsstrategien lungen und das eigene Verhalten wurden von
ein und suchen das Gespräch mit Kolleg*innen, den Teilnehmer*innen für wahrscheinlich gehal-
Freund*innen oder der eigenen Familie (Ober- ten. Die Autorin schlussfolgert daher, „that the
maier u. a., 2018; Preuß u. a., 2017). Interessanter- consequences of hate speech might be similar [...]
weise scheinen einige Journalist*innen inzivile und to the effects experienced by recipients of other
hasserfüllte Reaktionen auf ihre Beiträge aber kinds of traumatic experiences” (S. 354). Inzivile
auch als „professional success” (Post & Kepplin- Kommunikation mag somit „lediglich“ mit Wirkun-
ger, 2019) zu interpretieren und positive Gefühle gen auf der Mikroebene beginnen, ist gerade in
daraus zu ziehen: Der Angriff von außen scheint der Summe aber auch auf der Makroebene ein
innerlich zu bestätigen, dass die journalistische gravierendes Problem. Dies wirft die Frage auf,
Arbeit richtig und wichtig ist (ebd.; Obermaier wie sich Inzivilität verhindern oder zumindest
u. a., 2018). eindämmen lässt.
Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass vor allem
weibliche Medienschaffende zu den Opfern von
inziviler Online -Kommunikation zählen (Adams,
2018; Chen u. a., 2018). Dies wiederum reflektiert
generelle Tendenzen in sozialen Online-Medien.
Wie Sobieraj (2018) feststellt, werden nicht nur
Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen oder Poli-
tikerinnen online zu Zielen von Hass, Beleidigun-
gen und verbalen Misshandlungen. Auch „ganz
normale” Nutzerinnen von SNS, Online-Games
oder Internet-Communities „find themselves
on the receiving end of vitriolic, gender-based
backlash” (S. 1701; siehe auch Fox & Tang, 2014;
KhosraviNik & Esposito, 2018). Die Auswirkungen
dieser Online-Misogynie reichen von individuellen
Effekten der Selbstzensur, Einschüchterung und
Unsicherheit hin zum vollständigen Rückzug aus
öffentlichen Online-Diskursen, der schließlich
auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zum
Problem werden kann (Sobieraj, 2018). Ähnliche
Konsequenzen lassen sich auch für andere Per-
sonengruppen erwarten, die etwa aufgrund ihrer
sexuellen Orientierung, Religionszugehörigkeit
oder Ethnie zu Opfern von Inzivilität und Hass 1 Studien im Kontext von Online-Hassrede sprechen dafür,
werden. dass solche offenen, „in your face“ Formen von Inzivilität
schlichtweg auch leichter erkannt werden können als eher
implizite Varianten (Ben-David & Matamoros-Fernández,
Um herauszufinden, wie es sich für Betroffene 2016; Borgeson & Valeri, 2004).
anfühlt, das Ziel von Hassrede zu sein, konfron- 2 Vertrauensverluste durch Inzivilität sind mutmaßlich
tierte Leets (2002) in einer Studie jüdische und jedoch nicht nur für den Journalismus zu beklagen. In einer
finnischen Studie mit jugendlichen Facebook-Nutzer*in-
homosexuelle Studierende mit Hasskommenta-
nen (Näsi, Räsänen, Hawdon, Holkeri, & Oksanen, 2015)
ren, die ihre jeweilige soziale Identität ansprachen konnte ein Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung
(antisemitisch bzw. homophob). Direkt nach der von Online-Inzivilität (hier: Hassrede) und dem Vertrauen in
soziale Gruppen festgestellt werden: Nutzer*innen, die sich
Konfrontation mit den Hasskommentaren zeigten
daran erinnerten, online mit Hass konfrontiert worden zu
die Studierenden vor allem emotionale Reaktio- sein, gaben an, weniger Vertrauen in andere Menschen zu
nen, fühlten sich alleine, gekränkt oder schockiert. haben.
235. Gegenmaßnahmen:
Wie lässt sich Inzivilität in
sozialen Online-Medien verhindern?
Inzivilität in sozialen Online-Medien kann sehr (Ziegele & Jost, 2016, S. 4; siehe auch Frischlich,
explizit sein – etwa, wenn sie Gewaltandrohungen Boberg, & Quandt, 2019). Idealtypisch lassen sich
enthält oder von der Verwendung verfassungs- dabei drei Formen von Moderation unterschei-
feindlicher Symbole begleitet wird. Das NetzDG den, die sich im Grad der Beteiligung von Medi-
macht es an dieser Stelle möglich, dass repressive enanbietern und Nutzer*innen unterscheiden
Strategien wie Löschungen einzelner Kommentare (siehe nachfolgend Ziegele & Jost, 2016, S. 4–6):
oder das Blockieren von konkreten Nutzer*innen Kollaborative Moderation setzt auf eine starke
eingesetzt werden können. Allerdings zeigt die Beteiligung der Diskussionsteilnehmer*innen
empirische Realität, dass Inzivilität vielfältige und ermöglicht diesen beispielsweise, inzivile
Ausdrucksformen annehmen kann, die sich häufig Kommentare zu flaggen, d.h., als unangemessen
unter der Schwelle strafrechtlicher Relevanz bewe- zu kennzeichnen und den Anbietern zu melden
gen. Konkrete Gegenmaßnahmen sind daher vor (ausführlich wird Flagging bei Naab, Kalch, &
allem in präventiven Strategien zu sehen und nicht Meitz, 2018 diskutiert). Ein Beitrag, der von vielen
ausschließlich in der Repression von Inzivilität. Nutzer*innen Flags erhalten hat, kann dann je
nach Einstellungen der jeweiligen Diskussions-
Es lassen sich verschiedene präventive Maßnah- plattform automatisch entfernt oder zur manu-
men voneinander abgrenzen, wobei wir in diesem ellen Prüfung weitergeleitet werden. Daneben
Beitrag eine bewusste Auswahl treffen und vor- gibt es die inhaltliche Moderation, bei der profes-
rangig auf die Aspekte (1) Community Management sionelle Moderator*innen ohne explizite Angabe
und Moderation von inzivilen Kommentaren und von Gründen Kommentare entfernen, die sie als
weiteren Kommunikaten, (2) das Ausüben von unangemessen empfinden (bzw. von der Organi-
Gegenrede, (3) den Einsatz von Gegenbotschaften sation als unangemessen definiert wurden, z.B.
sowie (4) die Förderung von Medienkompetenz in sogenannten „Netiquetten“). Zu unterscheiden
eingehen werden.1 sind dabei Formen der Pre- und Post-Modera-
tion. Bei der Pre-Moderation werden Kommen-
Insbesondere im Kontext von Nachrichten- tare gesichtet, bevor sie veröffentlicht werden,
Webseiten und den SNS-Profilen von Medien- während bei der Post-Moderation erst nach der
und Nachrichtenanbietern wurde die Rolle von Veröffentlichung festgelegte Prüfmechanismen
(1) Community Management und Moderation zum Einsatz kommen (Ksiazek, 2015, S. 560).
intensiv diskutiert. Community Management Zuletzt finden sich in der Praxis auch Formen der
meint zunächst ganz allgemein das Übersehen interaktiven Moderation, die sich dadurch aus-
bzw. Überwachen von Diskussionskanälen und zeichnen, dass die Moderator*innen aktiv und
-plattformen, „but also actively asking for con- sichtbar an den Diskussionen teilnehmen und
tributions, encouraging users to contribute, and mit den Nutzer*innen interagieren, wobei hier
managing and moderating online discussions” grob zwischen einer Helfer- (z.B. Bereitstellung
(Bakker, 2014, S. 598). Moderation kann somit von zusätzlichen Informationen; Komplimente
als spezifische Teilform eines übergeordneten für hilfreiche Beiträge) und Regulator-Rolle (z.B.
Community Managements verstanden werden, Vermittlung bei Konflikten; Rückführung der Dis-
bei der die Prozesse oder Inhalte von Online- kussionen zum eigentlichen Thema) differenziert
Diskussionen organisiert und reguliert werden werden kann.
25Sie können auch lesen