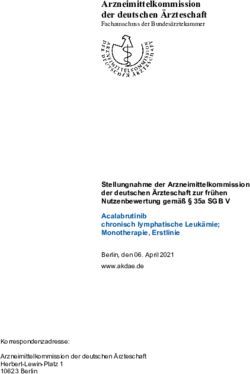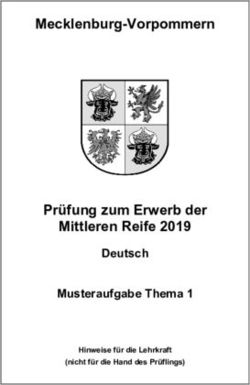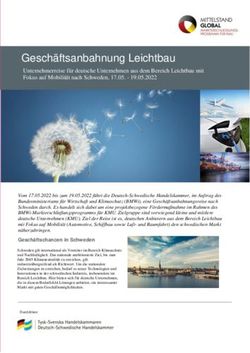Wie blickt die Welt auf Deutschland? Folge 5: Frankreich - NDR
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Wie blickt die Welt auf Deutschland? Folge 5: Frankreich von Sabine Wachs Die deutsch-französische Freundschaft gilt als Herzstück Europas: Aus Erbfeinden sind nach dem Zweiten Weltkrieg Freunde und Partner geworden. Politisch spielt das Tandem innerhalb der EU und bei internationalen Krisen eine wichtige Rolle. Aber die deutsch-französische Freundschaft ist viel mehr, sie wird von Millionen Menschen im Alltag gelebt. Dass daran noch einmal etwas zu rütteln sein könnte, hat jahrzehntelang niemand für möglich gehalten. Das Pandemiejahr 2020 mit seinen Grenzschließungen hat die Freundschaft dann aber doch auf eine harte Probe gestellt. Unsere Frankreichkorrespondentin Sabine Wachs ist an der Grenze zu Frankreich groß geworden, sie weiß, dass Corona vor allem in den Grenzregionen den freundschaftlichen Blick auf die deutschen Nachbarn ziemlich empfindlich getrübt hat: „Mehrere Personen haben von Problemen an der deutsch-französischen Grenze in Petite-Rosselle berichtet.“ Lese ich auf Facebook und traue meinen Augen nicht. Der Post, verfasst Anfang August 2021, ist der Zeugenaufruf eines französischen Abgeordneten der Region Moselle, die direkt ans Saarland grenzt. „Die deutsche Polizei“, steht dort weiter, „habe Grenzgänger, die zur Arbeit oder zum Einkaufen nach Deutschland wollten, blockiert, einige müssten sogar Strafe zahlen. Wir benötigen so schnell wie möglich schriftliche Zeugenaussagen oder Fotos von den Bußgeldern, um die Probleme zu melden.“ Was ist da schon wieder los, frage ich mich. Die Grenzen sind doch wieder offen. Wir sind doch schon wieder weiter als im März 2020, als Deutschland ohne Absprache mit seinen Nachbarn Schlagbäume runtergelassen hat. Seit Monaten gibt es bei der Einreise nach Deutschland Ausnahmeregeln für Grenzgänger. 24 Stunden dürfen sich Französinnen und Franzosen ohne Test- oder Impfnachweis im Saarland aufhalten. Nur wissen das die Bundespolizisten, die aus Hessen an die deutsch-französische Grenze beordert wurden, leider nicht. Und die Emotionen auf französischer Seite kochen wieder hoch.
Ich scrolle mich durch mehr als 300 Kommentare auf Facebook. Fast ausschließlich wütende und geschockte Reaktionen, hauptsächlich von Menschen, die auf der französischen Seite der Grenze leben. „Die können kommen und die Wasserregale in unseren Supermärkten plündern. Solange die für Plastikflaschen kein Pfand zahlen müssen, haben die auch keine Angst, sich anzustecken, aber wehe wir kommen rüber…Das ist was ganz anderes.“ Das ist noch einer der harmloseren Wutausbrüche und trotzdem fasst er die Stimmungslage vieler Französinnen und Franzosen im Grenzgebiet gut zusammen: Die hyper-korrekten Deutschen, die Besserwisser, diejenigen, die die Pandemie eigentlich im Griff hätten, gäbe es da nicht das coronaverseuchte Nachbarland. Das klingt extrem hart. Und das ist es auch. Der Blick vieler Menschen in der französischen Grenzregion auf die deutschen Nachbarn hat sich durch die Pandemie völlig verändert. Besonders traurig macht mich das „die“ und „wir“, diese Abgrenzung, die es auf einmal wieder gibt – und zwar von beiden Seiten. Lange Zeit war da nämlich nur ein „wir“ – „wir“ in der Grenzregion, einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, vor allem aber einem gemeinsamen Lebensraum. Ich bin genau dort aufgewachsen. In Saarbrücken, einer Stadt, die direkt an Frankreich grenzt, in einer Stadt, in der man fast genauso viel Französisch hört wie Deutsch. In einer Region, in der Französinnen und Franzosen keine Ausländer, sondern Mitbürger sind. Und der Blick der Grenzfranzosen auf die Grenzdeutschen war, zumindest seit ich denken kann, meist wohlwollend: eine gelebte Nachbarschaft, respektvoll und anerkennend. Mit Corona hat sie einen Knacks bekommen. Pendler fürchteten um ihre Arbeitsplätze, lange
Staus sorgten für Unmut an den Grenzübergängen, Französinnen und Franzosen, die zum Beispiel nach der Arbeit im Saarbrücker Krankenhaus noch eben schnell einkaufen gingen – sie hatten ja einen gültigen Passierschein –, wurden auf dem Supermarktparkplatz beschimpft: „dreckiger Franzose“, „Virenschleuder“. Das überwunden geglaubte Misstrauen gegenüber den Deutschen kam mit Wucht zurück. Während der Hochphase der Pandemie von März bis Mitte Juni 2020 waren die Grenzen geschlossen. Erst nach Wochen und großem Engagement regionaler Politiker von beiden Seiten der Grenze konnte eine Ausnahmeregelung für Grenzgänger durchgesetzt werden. Besser hat es das aber kaum gemacht. Straßensperren wurden an den Grenzen aufgebaut. Ohne triftigen Grund – und der Familienbesuch fiel nicht darunter – galt: überqueren verboten. Nur wenige Grenzübergänge waren offen, kontrolliert zuerst einmal nur von der deutschen Polizei. Auf einmal standen die wieder da, an der Grenze, erzählte mir eine Französin. Deutsche Polizisten. Ein Auge zudrücken und die Leute pragmatisch über die Grenze lassen? Fehlanzeige: Man habe Vorschriften und an die werde sich strikt gehalten. Deutsch korrekt, Gründlichkeit par excellence. Während meiner gesamten Schulzeit an einer deutsch-französischen Schule, mit französischen Lehrerinnen und Schülern, galt die „deutsche Gründlichkeit“ immer eher als Plus denn als negative Eigenschaft. Zum Beispiel, als die Polizei direkt vor unserer Schule eine Halteverbotszone einrichtete. Eltern, aus Frankreich und aus Deutschland, blockierten nämlich nach Schulschluss regelmäßig die Straße, damit ihre Kinder bloß keinen Meter zu viel laufen mussten, um ins Auto zu steigen. Gefährliches Chaos, für uns Schüler und für andere Autofahrer. Also griff die Polizei durch, verteilte Strafzettel. Deutsche Gründlichkeit, die gut ankam. Nun ist sie für viele Menschen im
französischen Grenzgebiet wieder der Inbegriff der deutschen Machtdemonstration und ein klares „Ihr seid bei uns nicht willkommen“. Im Rest von Frankreich allerdings war und ist noch immer kaum etwas von den Ressentiments gegen Deutsche zu spüren. Während der Hochphase der Pandemie verfolgte ich die angespannte Situation in meiner Heimat, im deutsch-französischen Grenzgebiet, von Paris aus, wo ich nun lebe und arbeite. Dort schauten viele Menschen eher anerkennend nach Deutschland und auf die Deutschen. Im Gegensatz zu Frankreich lief das Coronamanagement anfangs ja gut. Durchdachter, sagten einige meiner französischen Freunde. Die Deutschen können eben organisieren. Keine Krankenhäuser an der Belastungsgrenze, niedrige Fallzahlen, kein allzu harter Lockdown. Vor allem die Kanzlerin und ihre ruhige, pragmatische Art, ihre natürliche Autorität wurden immer wieder hervorgehoben. Ganz anders agiere sie als Frankreichs Präsident Macron und die französische Regierung, die ihren Bürgerinnen und Bürgern kein Vertrauen entgegenzubringen schienen und alles mit harter staatlich- zentralistischer Hand regeln wollten. Bewunderung für die Deutschen und ihr Krisenmanagement, dort wo kaum einer persönlich von den Auswirkungen betroffen war. Anders als im Grenzgebiet, wo das deutsche Krisenmanagement tausenden Menschen den Alltag zusätzlich schwerer machte. 19 saarländische Bürgermeister und Bürgermeisterinnen versuchten gegenzusteuern. Mit einer gemeinsamen Videobotschaft an ihre französischen Partnerstädte. Auf Französisch schickten sie Grüße und mentale Unterstützung an ihre Kolleginnen und Kollegen jenseits der Grenze. Es gibt sie doch noch, die Solidarität seitens der Deutschen,
schrieb mir eine Bekannte, als sie das Video sah. Sie sei erleichtert, dass zumindest auf lokaler und regionaler Ebene etwas passiere, um das negative Bild der Deutschen wieder etwas aufzuhellen. Anders als Menschen in ihrem direkten Umfeld war sie nie wirklich wütend auf die Nachbarn. Sie war, wie ich auch, eher geschockt, erschüttert und tief traurig darüber, wie schnell eine langsam gewachsene Freundschaft und Zuneigung in die Brüche gehen kann. Und dann kam der Tag, an dem das Saarland den ersten französischen Corona-Patienten aus dem benachbarten Lothringen aufnahm. Dort waren die Krankenhäuser an ihrer Belastungsgrenze, Intensivpatienten wurden nach Deutschland, insgesamt 28 ins Saarland ausgeflogen, im Herbst 2020 nahm das Land noch einmal Menschen aus Frankreich auf. Von Paris aus hatte ich damals per Telefon eine französische Kollegin interviewt. Sie arbeitet bei einem Fernsehsender in Lothringen. Zum ersten Mal seit der Grenzschließung, sagte sie mir, habe sie das Gefühl, dass doch noch etwas da sei, von der deutsch-französischen Freundschaft. Eine starke Geste der Solidarität, die viele Menschen auf der französischen Seite der Grenze schon nicht mehr für möglich gehalten hatten. Die Aufnahme der schwer kranken französischen Covid-Patienten, die wohl ohne saarländische Hilfe nicht überlebt hätten, habe geholfen, die Wogen ein bisschen zu glätten. Das Misstrauen, die Wut und der Ärger über das deutsche Verhalten war, wenn auch nicht vergessen, zumindest abgemildert. Vielleicht hat sich auch deshalb in Paris und Berlin kaum einer ernsthaft Gedanken darüber gemacht, ob das deutsch-französische Verhältnis durch die deutsche Pandemie-Politik massiv geschädigt wurde. Nach dem katastrophalen Beginn der Krise sind Frankreich und Deutschland
auf politischer Ebene enger zusammengerückt. Ausnahmeregelungen für Menschen in den Grenzregionen wurden beschlossen, gemeinsame Testzentren wurden eingerichtet. Nicht nur grenzüberschreitend, sondern auch auf nationaler Ebene wurde der Dialog, wurde die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern verstärkt. Zwar stuft das deutsche Robert-Koch-Institut immer wieder französische Regionen, auch Grenzregionen als Hochrisiko- oder Virusvariantengebiete ein, obwohl die Inzidenzwerte in beiden Ländern auf unterschiedlichen Grundlagen berechnet werden und somit nicht vergleichbar sind. Immerhin aber wird nun die französische Seite mit ausreichend Vorlauf informiert und die Regionen wissen heute mit solchen Situationen pragmatisch umzugehen. Neue Grenzschließungen gab es nicht mehr. Trotzdem: Die Wunden, die die Pandemie geschlagen hat, sind noch nicht vernarbt. Die Wut, der Ärger, das Misstrauen gegen die deutschen Nachbarn und auch die Traurigkeit, die viele Menschen im französischen Grenzland empfunden haben, sind gerade einmal mit dünnem Schorf überzogen. Diese tiefen Wunden müssen gut versorgt und gepflegt werden, damit sie nicht ständig wieder aufreißen. Und Bundespolizisten, die ohne Kenntnis der Ausnahmeregelungen Französinnen und Franzosen an der saarländischen Grenze kontrollieren, sind alles andere als Wund- und Heilsalbe.
Sie können auch lesen