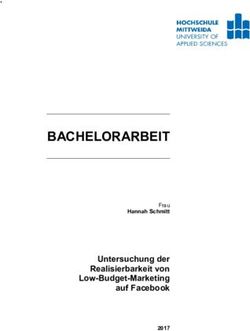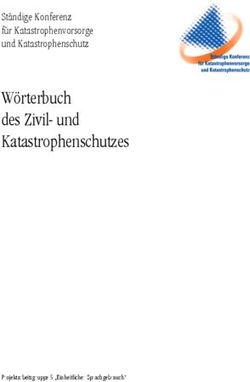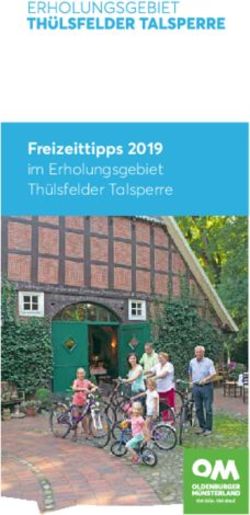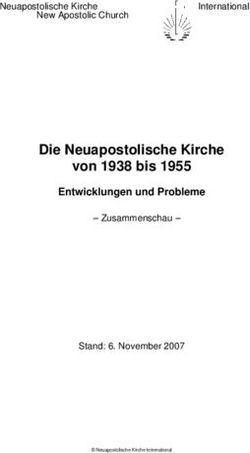Argumentation gegen Vorurteile und Stammtischparolen Reader zum Webinar
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Hamann & Kirchner GbR
IKG
Institut für Kommunikation www.i-k-g.net
und Gesellschaft kontakt@i-k-g.net
Argumentation gegen
Vorurteile und
Stammtischparolen
Reader zum Webinar
Bundesverband der Personalmanager
15.04.2020
Dr. rer. Pol. Moritz Kirchner, Dipl. Psych.
Institut für Kommunikation und Gesellschaft
Deutsche Vizemeister Debattieren 2015Reader Argumentation gegen Seite 2
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
Gliederung dieses Readers
1. Vorwort zum Reader
2. Was sind Stammtischparolen
3. Die derzeitige politische Gesamtsituation
4. AfD, Pegida und Co.
5. Grundlagen der Argumentation
6. Klassische Stammtischparolen und deren Erwiderung
7. Grundlagen der Kommunikationspsychologie
8. Die Sozialpsychologie des Rechtspopulismus
9. Argumentieren mit Grundwerten
10. Fakten gegen Parolen
11. Die zehn Dimensionen der politischen Rhetorik
12. Verwendete Literatur dieses Readers
Empfohlene Literatur
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 3
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
1. Vorwort zum Reader
Dieser Reader soll das in unserem Training Gelernte vertiefen und verfestigen. Zudem soll er als
Nachschlagewerk dienen, um die eigene Argumentation zu schärfen, Fakten wieder in Erinnerung zu
rufen oder sich psychologische Zusammenhänge des Stammtisches sowie abwertenden Äußerungen
noch einmal verdeutlichen. Der Reader zeigt Quellen zum Weiterlesen auf und vermittelt den
derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu Stammtischparolen (vgl. Heitmeyer: 2018) und
dem angemessenen Umgang mit Rechtspopulismus, Vorurteilen, Stammtischparolen und
abwertenden Äußerungen sowie gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, im Betrieb, auf der
Straße und im Alltag.
Das Seminar dient der Wissensvermittlung und der argumentativen Sicherheit in brenzligen
Situationen. Es vermittelt Kenntnisse, Techniken und Hintergründe. Eines jedoch kann es, wenn
überhaupt, nur indirekt vermitteln, nämlich eine entsprechende Haltung zu diesem zutiefst
politischen Thema. Diese Haltung geht vom Respekt gegenüber jedem Menschen, der
grundlegenden Gleichwertigkeit aller Menschen (Singer: 2013) sowie der unbedingten Geltung der
Menschenwürde (Habermas 2011: 11) aus, was jedwede Ideologie der Ungleichwertigkeit
(Decker/Kiess/Brähler: 2016) ausschließt. Genau das ist ein wesentliches Ziel von Organisations- und
Zivilcourage im Betrieb.
Leider ist diese Haltung bei einigen Menschen nicht vorhanden, und es wird auch bewusst Wut und
Hass von bestimmten Akteuren im politischen Feld geschürt (Fuchs/Middelhoff: 2019; Heitmeyer:
2018; Hillje: 2018) Die Auseinandersetzung mit Stammtischparolen ist müßig, anstrengend, und
häufig ist ihre Artikulation auch für einen selbst verletzend und empörend. Vor allem ist sie das
Gegenteil von Kollegialität, ebenso das Gegenteil der gewerkschaftlichen Grundidee der Solidarität.
Es liegt bei solchen Parolen natürlich nahe, sich herauszuhalten und zu schweigen. Das
Grundproblem hierbei ist, dass dies von interessierter Seite als Zustimmung ausgelegt wird. Auch
selbst zu Brüllen und zu Beleidigen ist nicht unbedingt produktiv und sorgt eher für eine weitere
Polarisierung und aufgeheizte Stimmung. Zudem wirkt es auf Dritte schlicht unsouverän und nicht
überzeugend. Ebenso stellt es keine gute interne Kommunikation dar.
Was das Schweigen zu Stammtischparolen innerhalb des Betriebes angeht, gilt jedoch der
kategorische Imperativ Kants (Kant 1990: 60): Wenn jeder so handeln würde, gäbe es gar keinen
Widerspruch, und der Stammtisch und die Ressentiments hätten freie Bahn. Dann aber würden wir
in einer Gesellschaft leben, in der nicht nur wir nicht leben wollen. Und wir würden in einer Firma
arbeiten, in der sich viele, im Wortsinn, fremd fühlen.
Wer gegenüber Rechtspopulismus und Stammtischparolen sicher argumentiert, kann andere zur
Zivilcourage ermutigen, kann Schweigen durchbrechen und Menschlichkeit im Alltag zeigen. Zudem:
Der gelebte Widerspruch gehört zur Demokratie, ja er ist gelebte, vitale Demokratie (Brunkhorst:
2016; Habermas: 2016). Diese brauchen wir, im Betrieb, im Alltag, im Beruf und in der Politik ganz
allgemein. Genau deshalb ist es auch so wichtig sowohl zu wissen, wie der Widerspruch gehen kann,
als auch wie man ihn praktisch einüben kann. Es gilt: Menschen können denjenigen, die
Stammtischparolen äußern, entschieden entgegentreten.
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 4
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
Zu diesem Reader gibt es eine umfangreiche Literaturliste, damit stets klar ist, welche Aussage sich
worauf bezieht. Zudem werden bestimmte Begrifflichkeiten verwendet, die für das Verständnis des
Themas wichtig sind, aber nicht unbedingt der Alltagssprache entsprechen. Diese werden in einem
Glossar am Ende noch einmal erläutert und sind in diesem Text kursiv markiert.
Ein Wort noch zur Sprache dieses Readers. Es gibt einen mittlerweile seit Langem belegten
Zusammenhang zwischen der Sprache und dem Denken (Lakoff/Johnson: 2018; Wittgenstein: 2014;
Foucault: 2012). Jedes Wort weckt immer bestimmte Assoziationen, es erzeugt bestimmte Gefühle
(Haidt 2012: 67). Dieser Vorgang wird als affektives priming, also als die Bahnung von Gefühlen durch
Worte, bezeichnet. Daher wird in diesem Reader viel Wert auf sprachliche Sensibilität gelegt, und es
wird auch ein Versuch unternommen, die klassische Terminologie des Stammtisches zu unterlaufen.
Zwei Beispiele: Schon das Wort „Flüchtlinge“ hat für manche Menschen bereits eine negative
Assoziation, „Geflüchtete“ hingegen zeigt, dass sie schon etwas getan haben, etwas auf sich nehmen
mussten. Auch der Begriff der „Flüchtlingskrise“ ist problematisch, denn er wird häufig verstanden
als eine Krise, welche die Flüchtlinge verursacht haben (Wehling: 2016). Demgegenüber ist jedoch
aufzuzeigen, dass es strukturelle Probleme sowie politische Versäumnisse sind, die bereits vorhanden
waren (Heitmeyer: 2018), welche erst durch die hierher Geflüchteten richtig sichtbar werden. „Der
lange Sommer der Migration“ ist deutlich schöner.
Hier kann von „den Ereignissen 2015“ oder „der großen Zuwanderung“ gesprochen werden. Ebenso
bedient das sprachliche Bild der „Flüchtlingswelle“ dieses Gefühl, überschwemmt, ergo übervölkert
zu werden (Wehling: 2016). Hier ist „Zuwanderung“ oder „Zuzug“ bzw. „Bevölkerungszuwachs“ ein
deutlich besserer Begriff. Eine weitere Möglichkeit ist „Der lange Sommer der Migration“. Schon das
bewusste Benutzen und Setzen bestimmter Begrifflichkeiten ist ein zutiefst politischer Akt (Wehling:
2016; Lakoff: 2015; Lakoff/Johnson: 2018). Die politische Rechte ist sich dessen absolut bewusst, wie
wichtig Sprache für das politische Denken ist.
Trotz des an sich unangenehmen Themas Stammtischparolen und Umgang mit abwertenden
Äußerungen wünsche ich viel Freude und viele Erkenntnisse bei der Lektüre des Readers. Denn er soll
dazu beitragen, effektive Zivilcourage zeigen zu können.
Dr. Moritz Kirchner
Geschäftsführender Gesellschafter Institut für Kommunikation und Gesellschaft
2. Was sind Stammtischparolen
Stammtischparolen sind bestimmte Sätze, Bewertungen und Zuschreibungen, welche andere
Menschen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe abwerten (Hufer: 2006).
Stammtischparolen sind also immer auch ein Ausdruck einer „gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit“ (Heitmeyer: 2018). Diese Stammtischparolen gehen mit einer Ideologie der
Ungleichwertigkeit einher, denn durch diese Parolen werden bestimmte Menschen bzw.
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 5
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
Menschengruppen pauschal abgewertet (Decker/Kiess/Brähler: 2016). Im Extremfall wird ihnen sogar
die Würde abgesprochen, obwohl die Unbedingtheit der Würde des Menschen in Deutschland
höchsten moralischen Wert und sogar primären Verfassungsrang hat (vgl. Forst 2013: 164; Habermas
2011: 18) und ein Diskriminierungsverbot auch ganz konkret gesetzlich besteht.
Sehr häufig (aber nicht nur) werden Stammtischparolen im Kontext von Rechtspopulismus geäußert-
Der Rechtspopulismus als Form des Politischen ist eine bestimmte Spielart des Populismus, die auf
einer starken, oft ethnisch grundierten Unterscheidung zwischen dem „Wir“ und den
„Anderen“ basiert (vgl. Decker: 2018; Hillje: 2018; Müller: 2016). Eng mit dem Rechtspopulismus
assoziiert ist die Demagogie, bei der ein Politiker bzw. eine Politikerin sich als Führungsperson des
Volkes sieht und nicht nur für dieses spricht, sondern sogar als dieses Volk, welches er, und nur er,
repräsentiere (Ötsch/Horaczek: 2017; Müller: 2016).
Der Rechtspopulismus hat also immer ein Innen und mehrere Außen, nämlich die Eliten, die Anderen
(Ausländer) und diejenigen, die in er Gesellschaft unten stehen. Folgendes Schaubild kann die
mehrfache Exklusivität des Rechtspopulismus, aber auch der Mehrzahl der Stammtischparolen sehr
gut veranschaulichen:
Grundsätzlich gibt es im Populismus und den Stammtischparolen eine Unterscheidung zwischen dem
Volk und der Elite. Dieses Volk wird als homogen, moralisch hochwertig und unschuldig
angenommen, die Elite hingegen als korrupt und betrügerisch (Levitsky/Ziblatt: 2018; Appadurai:
2017; Müller: 2016). Daraus resultiert, dass es eine moralische Hierarchie zwischen dem Volk und der
Elite gibt (Decker: 2018; Hillje: 2018; Heitmeyer: 2018). Das Volk wird anhand von ethnischen Kriterien,
Herkunft und Nationalität bestimmt. Deutscher ist man, oder eben nicht.
Es wird mittels der Sprache und Rhetorik eine Einheit zwischen dem Rechtspopulisten und dem Volk
geschaffen. Gerade Stammtischparolen und Demagogie konstruieren grundsätzlich eine
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 6
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
(aufgewertete) Innengruppe und eine (abgewertete) Außengruppe (Bauman: 2017; Ötsch/Horaczek:
2017; Hufer: 2006). Dann wird verächtlich auf die korrupte Elite geschaut und gegen diejenigen
gehetzt, die von außen kommen. Hier kommt die Unterscheidung „wir“ gegen „die“ ins Spiel, welche
jetzt anhand von Ethnizität, das heißt der ethnischen Herkunft, aufgeworfen wird (Eribon: 2017;
Stenner: 2005)
Dies war auch das Modell, auf dem der Wahlsieg des Rechtspopulisten Donald Trump basierte,
ebenso die Wahlerfolge der rechten Fidesz in Ungarn, der FPÖ in Österreich, letztlich auch der AfD
in Deutschland. (vgl. Levitsky/Ziblatt: 2018). Sie haben bewusst Stammtischparolen eingesetzt, welche
die Gesellschaft polarisieren und einfache Lösungen für komplexe Probleme anbieten (Müller: 2016).
Dadurch haben sie natürlich einen Vorteil, weil sie so schön niedrigschwellig sind, aber eben auch
anschlussfähig an bestehende Ressentiments (Heitmeyer: 2018).
Am Stammtisch und bei populistischen Parolen wird häufig auf diejenigen, die in der Gesellschaft
weiter unten stehen, wird herabgeschaut, da es häufig eine politische Liaison zwischen
Rechtspopulismus und dem so genannten Neoliberalismus gibt (Appadurai 2017: 25; Bauman 2017:
48). Das heißt unternehmerische Vorstellungen und ein stark ökonomisches Denken in
Nützlichkeitskategorien sind unter Rechtspopulisten weit verbreitet (Ruffato: 2019; Heitmeyer: 2018;
Guilford/Sonnad: 2017). So kommen dann auch entsprechende Parolen gegen „Minderleister“,
„Asoziale“ oder „Sozialschmarotzer“ zustande. Genau das ist ein wichtiger Grund, weshalb
Gewerkschaften sich gegen Rechtspopulismus wenden, denn der Neoliberalismus hat der
Gewerkschaftsbewegung immer schon den Kampf angesagt (Bauman: 2017; Mason: 2016).
Gerade die real oder gefühlt abstiegsbedrohte Mittelschicht ist es, die im besonderen Maße das
ökonomische Leistungsdenken verinnerlicht bzw. sich dem gedanklich angepasst hat, und deshalb
verächtlich auf diejenigen schaut, die in der Gesellschaft unten stehen (Heitmeyer: 2018; Reckwitz:
2018; Koppetsch: 2015). Gerade deshalb sind verächtliche Äußerungen, Vorurteile und Populismus
auch im Berufsleben nicht unwahrscheinlich.
Was die praktische Politik des Rechtspopulismus sowie derjenigen, die Stammtischparolen äußern
angeht, so zeigt sich, dass er ein gebrochenes Verhältnis zu Wahrheit und Fakten hat. Begriffe wie
„Fake News“ (vgl. Browning: 2018) oder „alternative Fakten“ wurden und werden insbesondere von
rechtspopulistischen Akteuren verwendet (Schaeffer: 2018). Es geht ihnen zumeist auch nicht um
Fakten, sondern um eine Emotionalisierung des politischen Diskurses (Snyder 2018; Hillje: 2018;
Heitmeyer: 2018), eine Emotionalisierung von Sprache und Politik. Denn den Umgang mit Emotionen,
insbesondere mit vorhandenen Ängsten und Wut, den beherrschen die Stammtischakteure oft besser
als andere
Stammtischparolen sind zudem oft postfaktisch, und scheuen sich nicht selten vor bewussten Lügen.
Dadurch aber verschwimmen die Grenzen zwischen Wahrheit und Nichtwahrheit, was eines ihrer
zentralen kommunikativen Ziele darstellt (Schaeffer: 2018; Habermas: 2014). Jedoch ist es für die
Demokratie wichtig, dass nach wie vor folgender Grundsatz gilt (vgl. Ash: 2016): Jeder hat das Recht
auf seine eigene Meinung, aber niemand hat das Recht auf seine eigenen Fakten.
Die Besonderheit des Rechtspopulismus ist die, dass diejenigen, die zum vom Rechtspopulismus
angenommenen Volk gehören, automatisch dabei sind. Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen außer
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 7
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
der richtigen Ethnizität (Hillje: 2018; Lewandowsky/Giebler/Wagner: 2016). Durch die Abwertung
anderer kann man sich selbst als Teil des Volkes aufwerten und hat verspürt somit Selbstwertgewinne
auf Kosten anderer (Heitmeyer: 2018; Köpping 2018: 46). Auch können mögliche bestehende
Ressentiments herausgelassen werden. Genau darin liegt die Anziehungskraft, die der
Rechtspopulismus versprüht.
In diesem Reader zum Thema Stammtischparolen geht es nicht um die Sprüche und Scherze, welche
immer mal wieder in einer bierseligen Runde aufs Korn nehmen. Es geht auch nicht um die
Spielauswertung des letzten Fußballspiels. Sondern es geht um rechtspopulistische, rassistische und
menschenverachtende Aussagen, welche in der Absicht hervorgebracht werden, andere Menschen
systematisch zu diskriminieren und herabzusetzen (Heitmeyer: 2018; Kipping: 2016; Bednarz/Giesa:
2015). Diese fallen leider immer häufiger auch in Kontexten, in denen man sie nicht vermutet, wie in
Weiterbildungen, bei Familienfeiern, im Büro oder in privaten Whatsapp-Gruppen. Ebenso sind sie
leider auch immer häufiger im betrieblichen Alltag zu konstatieren. Dadurch, dass die AfD jetzt auch
noch flächendeckend in die Parlamente eingezogen ist, haben solche Parolen immer auch noch einen
institutionalisierten Resonanzverstärker.
Ein theoretisches Konzept, welches sich zur Abgrenzung zwischen harmlosen Sätzen am Stammtisch
und wirklich gefährlichen Stammtischparolen sehr gut eignet, ist jenes der gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit, welches von der Bielefelder Forschungsgruppe um Wilhelm Heitmeyer
verwendet wird (Heitmeyer: 2018; Decker/Brähler: 2018). Dieses besagt, dass bestimmte Personen
aufgrund bestimmter Eigenschaften, wie Hautfarbe, Geschlecht, Religion, sexueller Ausrichtung etc.
degradiert und diese Gruppe von Menschen pauschal herabgewürdigt werden.
Es geht also um negative Pauschalisierungen, um Vorurteile, um rassistische Zuschreibungen
bestimmter Eigenschaften. Leider nehmen diese im Kontext der gestiegenen Geflüchtetenzahlen in
letzter Zeit signifikant zu (von Lucke: 2016; Bednarz/Giesa: 2015). Diese Äußerungen können sehr
vielfältige Formen annehmen, und tun dies auch in der Praxis immer wieder
Hierbei ist immer auch noch zu differenzieren, in welcher Art und Weise, mit welchem Gestus sie
vorgetragen werden. Und ob ihnen ein Gefühl der Benachteiligung oder Ungerechtigkeit zugrunde
liegt (denn das kann man durch geschicktes Argumentieren meist noch beheben; Köpping: 2018),
oder ob es schlicht um Pöbeleien, Ressentiments oder Menschenverachtung geht. Hier ist eine
Grundregel im Umgang: Wer völlig resistent gegen Argumente und völlig frei von Empathie ist, mit
dem bzw. der lohnt sich eine Diskussion nicht.
Enorm wichtig zur Einschätzung von Stammtischparolen ist die Frage, ob dritte Personen anwesend
sind oder ob ich in einem Zwiegespräch bin. Denn in einer Auseinandersetzung mit nur einer Person
ist es leichter möglich, das Gespräch abzubrechen oder selbst auch konfrontativ zu sein. Sofern Dritte
im Spiel sind, geht es aber nicht mehr nur um Argumente, sondern es geht eben auch darum, wer
nun sympathischer und überzeugender ist (Cicero: 1997). Sofern eine einzige dritte Person in der
Situation mit dabei ist, ist es wichtig die Auseinandersetzung zu führen, denn es geht tatsächlich
politisch genau darum: Die im Betrieb Unentschiedenen für sich zu gewinnen.
Es geht darum, die bisher oder in der konkreten Situation politisch Unentschiedenen zu erreichen
und sie für humanistische und demokratische Positionen zu gewinnen. Das heißt, sobald
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 8
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
Unentschiedene Dritte in einer Situation involviert sind, sollte ich mit denjenigen diskutieren, die
Stammtischparolen hervorbringen.
Grundlegend haben wir Menschen für gewöhnlich ein gutes Gespür dafür, welche Äußerungen
schlicht nicht in Ordnung sind, weil sie andere Menschen systematisch diskriminieren und
herabwürdigen. Genau wenn dies passiert, eine individuelle Herabsetzung oder eine geäußerte
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, dann sollten wir verbal einschreiten. Als Faustregel der
Einschätzung ist die goldene Regel der Rhetorik sinnvoll: Behandle andere so, wie du selbst behandelt
werden möchtest.
Juristisch wird hier auch eine klare Grenzziehung vollzogen. Denn trotz der grundgesetzlich aus guten
Gründen geschützten Meinungsfreiheit ist „Volksverhetzung“ eben nicht erlaubt. Genau das ist es,
was häufig im Kontext von Stammtischparolen passiert. Es ist oft nicht nur unmoralisch, sondern
sogar justiziabel, was an Äußerungen getätigt wird (Hufer: 2006). Genau diese Grenzen setzt der
Gesetzgeber nicht ohne Grund. Denn es gilt: Meinungsfreiheit ist keine Freiheit zur Beleidigung.
Die besondere Schwierigkeit im Umgang mit Stammtischparolen und Rechtspopulismus ist, dass
diejenigen, die sie nutzen, sehr gern vereinfachen und scheinbar einfache und klare Lösungen
formulieren für Probleme, die oft sehr komplex sind (Heitmeyer: 2018; Ötsch/Horaczek: 2017; Müller:
2016; Boeser-Schnebel et. al.: 2016). Dieses Problem wird umso gravierender, da die Gesellschaft
voraussichtlich immer noch komplexer werden wird (vgl. Luhmann: 2002). Stammtischkämpferinnen
und –kämpfer müssen also auch dies können: radikal vereinfachen und Komplexität reduzieren
(Lakoff/Johnson: 2018), ohne Dinge falsch darzustellen. Das will aber gelernt werden. Hierzu soll das
Training und dieser Reader einen konkreten Beitrag leisten.
Was wir hierfür aber vor allem brauchen, ist eine klare und entschiedene politische Haltung. Diese
kann politisch sehr unterschiedlich sein, aber sie sollte stets Artikel 1 des Grundgesetzes inhaltlich
mit beinhalten: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
3. Die derzeitige politische Gesamtsituation
Die politische Gesamtsituation insgesamt sehr schwierig. Im Sommer 2015 gab es den Höhepunkt
der Willkommenskultur, der jedoch durch die Silvesterereignisse von Köln jäh beendet wurde. In der
Politik begann der Paradigmenwechsel hin zur Abschottungspolitik, was insbesondere im Asylpaket
I und II seinen Ausdruck fand. Kurz danach wurde jedoch die Balkan-Route geschlossen, erst durch
Mazedonien, später dann durch den EU-Türkei-Deal, welcher letztlich nichts weiter ist als ein
politischer Ablasshandel, bei dem Europa der Türkei Geld gibt, um Flüchtlinge abzuhalten
(Gottschlich: 2016). Bestehende gesellschaftliche Spannungen wurden verstärkt und politische
Versäumnisse wie der fehlende soziale Wohnungsbau wurden durch den Zuzug vieler Geflüchteter
offenkundig. Jedoch haben gerade rechtspopulistische Parteien den Geflüchteten die Schuld dafür
gegeben (Guerot: 2016), und haben damit leider auch politische Resonanz bei der Bevölkerung
erzeugt, welche die etablierten Parteien, auch durch mangelnde politische Kommunikation und
Einbettung ihres Handelns nicht erzeugen konnten (Hillje: 2018; Merkel: 2015).
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 9
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
Dies kann sich langfristig zu einer Gefahr für das demokratische System insgesamt auswachsen (vgl.
Rosa: 2016). Es zeigt sich nicht nur eine weitere Erosion der vormaligen Volksparteien (Merkel 2015:
17), sondern insgesamt sogar eine große gesamtgesellschaftliche Regression, bei der als
selbstverständlich angenommene Handlungs- und Diskursstandards offensiv hinterfragt werden
(Geiselberger: 2017; Bauman: 2017). Ebenso zeigt sich leider auch zunehmend eine, zunehmend
gefährliche Demokratiemüdigkeit (Appadurai: 2017).
Es zeigt sich in ganz Europa, dass der Neonationalismus auf dem Vormarsch ist (Brumlik: 2017; von
Lucke: 2015). Die Sehnsucht nach einfachen Antworten, aber teils auch nach den (verklärten) guten
alten Zeiten treibt immer mehr Menschen in die Arme von Rechtspopulisten (Ötsch/Horaczek:
2017; Müller: 2016). Bei den jüngsten Europawahlen wurde die AfD in Brandenburg und Sachsen
stärkste Kraft. Insgesamt ist ein partieller Rechtsruck der Gesellschaft zu konstatieren. Bei den
jüngsten Landtagswahlen hat die AfD massiv zugelegt.
Die derzeitige politische und gesellschaftliche Situation wird weniger als eine
gesamtgesellschaftliche Krise insgesamt gesehen (vgl. Mason: 2016), sondern sie wird stark auf die
Flüchtlinge an sich projiziert. Insbesondere die Abstiegsängste der Mittelschicht (Koppetsch: 2015)
werden mit der Ankunft der Flüchtlinge teils erheblich verstärkt.
Ein ganz wesentliches Problem sind die ostmitteleuropäischen Staaten wie Polen und Ungarn, die
sich in der Visegrad-Gruppe (Müller 2016: 9; Fehr: 2016) zusammengeschlossen haben.
Denn diese nehmen nicht nur keine Flüchtlinge auf und bauen Zäune, sondern haben auch eine
gesamteuropäische Quotenlösung, wie die Regierung Merkel sie anstrebte, torpediert. Viktor
Orbans selbsternannte illiberale Demokratie kann mittlerweile sogar als Gegenmodell zu offenen
Demokratien angesehen werden (vgl. Levitsky/Ziblatt: 2018; Heller: 2017). Diese Staaten haben sich
auch jüngst erneut einer gesamteuropäischen Verteilung von Geflüchteten widersetzt.
Die europäische Abschottung, welche in Form einer „Festung Europa“ am nicht nur am Stammtisch
immer wieder gefordert wird (vgl. Vogel: 2019), hat es schon vor der Schließung der Balkanroute
gegeben, denn das Budget der europäischen Grenzschutzagentur Frontex hat sich in den letzten 10
Jahren verfünfzehnfacht (Kipping: 2016). Auch hat es mit dem Asylpaket I und II sowie dem EU-
Türkei-Deal insgesamt einen politischen Paradigmenwechsel weg von der Willkommenskultur und
hin zur Abschottungspolitik gegeben.
In Österreich allerdings wurde die Wahl eines Rechtspopulisten als Bundespräsident sehr knapp
verhindert. Zweitens gab es einmal eine vergleichbare Situation in Frankreich vor zehn Jahren, bei
der Jacques Chirac in die Stichwahl gegen den Gründer des Front National, Jean-Marie Le Pen
musste, und klar mit 82% gewann. Macron konnte demgegenüber, bei historisch geringer
Wahlbeteiligung, nur 65% der Stimmen verbuchen. Heute saß jedoch auch in Österreich die
rechtspopulistische, in Teilen rechtsextreme FPÖ in der Regierung, und tut es möglicherweise trotz
Ibiza-Gate demnächst wieder.
Wir erleben also eine gesellschaftliche Polarisierung, wie sie jüngst in Chemnitz und Köthen in
besonderem Maße zu beobachten war. Diese kann langfristig existenzielle politische Folgen haben
(Levitsky/Ziblatt: 2018). Auf der anderen Seite gibt es Millionen Menschen, die nun politisiert
wurden, hilfsbereit und empathisch sind (Habeck: 2018; Kipping: 2016). Auf der anderen Seite
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 10
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
verfallen immer mehr Menschen Stammtischparolen und Ressentiments sowie einfachen Antworten
auf eigentlich komplexe Fragen (Müller. 2016).
Psychologische Faktoren spielen für die politische Gesamtsituation eine besondere Rolle (vgl. Haidt:
2012). Denn erstens bedeuten die Geflüchteten erst einmal Veränderungen, welche Menschen
grundlegend eher nicht mögen. Zweitens ist es nachgewiesenermaßen leichter, sich mit denen zu
solidarisieren, die einem besonders ähnlich sind (oder mit denen wir gar verwandt sind), während
eine universelle Solidarität mit allen Menschen für viele abstrakt oder schwer umsetzbar ist. Drittens
sind viele Menschen durch das Internet in ihrer Informationsblase, in der sie sich einfach immer
wieder selbst bestätigen, weshalb Sie für rationale Argumente kaum zugänglich sind (Schaeffer:
2018; Hillje: 2018).
Die Bundestagswahl 2017 hat an der Wahlurne gezeigt, dass Deutschland politisch insgesamt nach
rechts gerückt ist. Die zweistellige AfD zeigt, dass ein relevanter Teil der Bevölkerung
rechtspopulistisch bis autoritär-nationalistisch wählt (Heitmeyer: 2018). Zwar war die AfD hier
bereits klar als rechtspopulistisch zu klassifizieren, aber auch andere Parteien waren von solchen
Tendenzen nicht frei, insbesondere die CSU nicht (Hoffmann 2018: 513; Hebel 2017: 82). Aber auch
das Wahlergebnis der Nationalratswahlen in Österreich 2017 war nicht erfreulich. Denn sowohl die
Österreiche Volkspartei (ÖVP) als auch die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) haben
rechtspopulistische Ansätze und Inhalte zusammen fast zwei Drittel der Stimmen erhalten. Dies
zeigt, dass der Vormarsch des Rechtspopulismus nicht gestoppt ist, nur weil Marine le Pen nicht in
Frankreich gewann.
Dennoch lautet die Gesamteinschätzung der politischen Situation: Es ist schwierig, aber es besteht
Hoffnung. Die Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr werden allerdings mit hoher
Wahrscheinlichkeit drastische Gewinne für die Alternative für Deutschland hervorbringen.
4.AfD, Pegida und Co.
Vor dem Aufstieg der Alternative für Deutschland war es wesentlich Pegida, waren es die
selbsternannten „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“, welche das
politische Klima nach rechts veränderten (Fuchs/Middelhoff: 2019; Brähler/Kiess/Decker: 2016;
Bednarz/Giesa: 2015). Pegida war ein Sammelbecken für Antiislamismus, Medienkritik, allgemeine
Unzufriedenheit und Rechtspopulismus, welches sich im Laufe der Zeit immer weiter radikalisiert
hat (Bednarz/Giesa: 2015). Es hat gleichzeitig unglaublich viele Stammtischparolen artikuliert und
damit zehntausende Menschen erreicht. Leider hat Pegida mit seinen Thesen eine umfassende
Resonanz (Rosa: 2017) bis hin zur Tagesschau erreicht. Sie haben aber auch Dinge formuliert, die
latent schon vorhanden waren (Heitmeyer: 2018).
Der Fokus dieser Bewegung liegt in Dresden. Von dieser Stadt gingen und gehen die
Demonstrationen aus, und hier gab und gibt es jeweils auch die meisten Teilnehmenden.
Anderswo haben deren Ableger sich nicht ernsthaft etablieren können. Gerade im Kontext der so
genannten Flüchtlingskrise hat Pegida wieder viel politischen Aufwind bekommen. Studien des
Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung, welches Teilnehmende an Pegida direkt
befragt hat, zeitigte folgende Ergebnisse zur Teilnahmemotivation an Demonstrationen wie Pegida.
Diese sind für die politische Analyse sehr aufschlussreich.
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 11
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
Abbildung: Gründe für die Teilnahme an Pegida-Demonstrationen ZVD
Pegida war und ist also zuallererst ein Katalysator der allgemeinen Unzufriedenheit. Dieses Muster
zeigt sich auch im Wahlverhalten von AfD-Wählern, welche diese Partei überwiegend aus Protest
wählen. Hier die Detailanalyse, die aufzeigt, woraus sich Stammtischparolen ganz konkret speisen
können. Es kann auch wie folgt gesagt werden: Pegida ist insgesamt ein ganz großer Stammtisch,
der diese Parolen mitten in die Gesellschaft treibt (vgl. Bednarz/Giesa: 2015).
Es wurde ebenfalls erfragt, was die Gründe sind, weshalb Menschen an den Pegida-
Demonstrationen teilgenommen haben. Sofern sie grundlegende Vorurteile gegenüber
Asylbewerbern haben. Auch hier zeigt sich ein interessantes Bild.
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 12
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
Es geht Pegida also um eine grundlegende Ablehnung des Islam (vgl. Geiselberger 2017: 8), aber es
spielen eben auch Ängste vor Kriminalität und sozioökonomische Abstiegsängste mit hinein (vgl.
Heitmeyer: 2018).
Die Alternative für Deutschland (AfD) entstand zunächst aus der Kritik an der Euro-Rettungspolitik
seitens der Bundesregierung. Diese wurde zum einen als ökonomisch falsch, zum anderen als
deutschen Interessen zuwiderlaufend kritisiert. Viele Stammtischparolen entspringen heute direkt
aus der Alternative für Deutschland, bzw. werden von ihren Protagonisten geäußert..
Nachdem der Parteigründer Bernd Lucke entmachtet wurde, hat sich die Partei immer weiter nach
rechts orientiert (Lewandowski/Giebler/Wagner: 2016). Allerdings wirken auch in ihr sehr
unterschiedliche Flügel wie der liberalkonservative, der nationalkonservative oder der klerikale
(kirchennahe) Flügel zusammen (Giesa/Bednarz: 2015). Die Partei wirkt heute wie ein politisches
Sammelbecken, aber auch ein Verstärker und Transmissionsriemen für Stammtischparolen.
Ein anderer, ganz wichtiger Transmissionsriemen waren aber auch die, millionenfach verkauften,
Bücher von Thilo Sarrazin (Fuchs/Middelhoff 2019: 13). Mit diesen wurden Ressentiments artikuliert
und popularisiert sowie erstmals ganz bewusst Grenzen des Sagbaren zu verschieben.
Die AfD schafft es folgerichtig regelmäßig, Ressentiments zu artikulieren und aufzugreifen
(Olschanski: 2016). Vor allem aber sorgt sie dafür, dass sich die Grenzen des Sagbaren immer weiter
verschieben (vgl. Bednarz/Giesa: 2015). Ein immer wiederkehrendes Muster sind radikale
Äußerungen, die dann einkassiert werden, aber die Grenzen dann schon wieder weiter nach rechts
verschoben haben.
Alexander Gaulands: „Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng
nicht als Nachbarn haben“, aber auch der Schießbefehl an der Grenze, wie ihn in unterschiedlicher
Art Beatrix von Storch und Frauke Petry forderten, haben zwar jeweils einen Aufschrei der
Entrüstung erzeugt. Sie haben vor allem aber dazu geführt, dass über Thesen diskutiert wird,
welche vorher im politischen Diskurs, im absoluten Wortsinne, unsäglich waren.
Die Programmatik der AfD speist sich aus einem umfassenden Neoliberalismus (also der
Ökonomisierung des Denkens mit einer gleichzeitigen Forderung nach einem schlanken Staat),
völkischem Denken und politischem Konservatismus, insbesondere in der Familienpolitik, wo die
verheiratete deutsche Drei-Kind-Familie propagiert wird (vgl. Lewandowski/Giebler/Wagner: 2016).
Die Partei inszeniert sich als Interessenvertretung des kleinen Mannes, auch wenn ihre Politik den
materiellen Interessen Einkommensschwächerer zuwiderläuft. In Ostdeutschland ist die AfD
inzwischen für alle Parteien (außer vielleicht den Grünen) eine Konkurrenz (Lederer/Miemiec: 2016).
Das Denken der AfD speist sich aus der Vorstellung möglichst ethnisch homogener Völker, die ihren
jeweils eigenen Platz haben. Dies wird als Ethnopluralismus bezeichnet (Hillje 2018: 30). Trotz der
Globalisierung, von der gerade Deutschland als ehemaliger Exportweltmeister so sehr profitierte,
will die AfD nicht nur die nationale Souveränität um fast jeden Preis verteidigen, sondern auch die
Bevölkerung vor Überfremdung schützen.
Dieses völkische Denken der AfD wird zum Beispiel in folgender Programmpassage mehr als
deutlich:
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 13
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
„Die überkommene Politik der großzügigen Asylgewährung im Wissen um massenhaften Miss-
brauch führt nicht nur zu einer rasanten, unaufhaltsamen Besiedelung Europas, insbesondere
Deutschlands, durch Menschen aus anderen Kulturen und Weltteilen. Sie ist auch für den Tod vieler
Menschen auf dem Mittelmeer verantwortlich. Die AfD will diese zynisch hingenommene Folge ei-
nes irregeleiteten Humanitarismus vermeiden und die daraus entstehende Gefahr sozialer und reli-
giöser Unruhen sowie eines schleichenden Erlöschens der europäischen Kulturen abwenden.“ (Alter-
native für Deutschland 2016: 59).
Genau das ist völkisches Denken in seinem inneren Kern. Dieses völkische Denken wird durch die
AfD verbreitet und immer weiter popularisiert. Dadurch kommen häufig auch bisher latent geblie-
bene Ressentiments und Rassismen an die diskursive Oberfläche, wie es im Seminar geschehen ist.
Innerhalb der eigenen Organisation, innerhalb des Betriebes und insbesondere innerhalb der Ge-
werkschaft kann dann auf die eigenen Grundsätze wie Solidarität, Gerechtigkeit und Respekt ver-
wiesen werden, welche dem Rechtspopulismus diametral gegenüberstehen. Dies ist am Stammtisch
so leider nicht möglich.
5. Grundlagen der Argumentation
Es gibt unterschiedlichste Argumentationsmuster für politische Diskussionen (vgl. Kopperschmidt:
2000). Sie zu kennen und dann praktisch zu üben, hilft bei der Anwendung in der konkreten Situation.
Rechtspopulistische Argumentationen weisen nicht unbedingt die höchste Komplexität auf
(Schaeffer: 2018). Daher sind sie oft auch mit den hier aufgeführten Argumentationsarten gut
widerlegbar.
Interessanterweise aber lassen sich alle auf zwei Klassen von Argumenten analytisch reduzieren,
nämlich das Induktionsargument (vom Beispiel zum Prinzip) und das Deduktionsargument (vom
Prinzip zum Beispiel). Nach dieser ersten Unterscheidung gibt es sehr vielfältige und unterschiedliche
Argumentationsmuster, welche alle ihren Platz innerhalb des Diskurses haben und strategisch
eingesetzt werden können. Die folgende Aufzählung zeigt nur die wichtigsten Argumentationsmuster.
Wichtig jedoch: Grundlegend sind Argumente wie folgt aufgebaut:
Prämisse
Prämisse Schlussfol-
Behauptung Erklärung
gerung
Prämisse
Daraus ergibt sich, dass am Anfang die Behauptung steht, wie z.B. „Die Geflüchteten sind nicht der
Grund für den Terrorismus“. Daraufhin folgt dann eine Erklärung, zum Beispiel dass diese ja selbst
vor Terror geflohen sind und ihn daher ablehnen. Oder dass es schon deutlich vor der jetzigen
Situation Terrorismus gab (RAF, NSU). Die Schlussfolgerung wäre dann zum Beispiel, dass man
Flüchtlinge nicht verurteilen oder unter Pauschalverdacht stellen sollte. Die Prämissen stehen logisch
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 14
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
vor der Behauptung. In dem Satz: „Die Geflüchteten sind nicht der Grund für den Terrorismus“ stecken
zum Beispiel folgende Prämissen:
➔ Es gibt Gründe für den Terrorismus
➔ Diese Gründe sind klar identifizierbar
➔ Die Gründe können klar voneinander getrennt werden
➔ Die Geflüchteten sind eine homogene Gruppe
➔ Es ist grundsätzlich erkennbar, dass es keinen Zusammenhang zwischen beidem gibt.
Diese Prämissen sind teilweise durchaus angreifbar, daher ist es umso wichtiger, eine gute Erklärung
zu liefern. Aus diesem grundlegenden Argumentationsschema ergibt sich nun eine besondere
Argumentationstechnik
Argumentieren mit dem BEIL
BEIL ist eine grundlegende Argumentationstechnik, die uns hilft, unseren Argumenten eine richtige
Form zu geben. BEIL ist die Grundtechnik des Debattierens als Redesport. Viele bekannte
Rednerinnen und Redner verwenden diese Technik. BEIL ist letztlich die modernisierte Version dessen,
was wir aus dem Deutschunterricht kennen: Behauptung, Begründung,
Wofür steht BEIL? Beispiel, plus Relevanz.
B ehauptung BEIL setzt durch die Hinzunahme die Erkenntnis um, dass Bilder und
E rklärung Emotionen sehr wichtig sind, um unsere Intuitionen anzusprechen (Haidt:
I llustration 2012)
L eitprinzip
Warum ist BEIL sinnvoll?
BEIl dient vor allem dazu, ein Argument wirklich rund zu machen. Es wird beschrieben, erklärt und
veranschaulicht. Damit wird der eigenen Argumentation besonderes Gewicht und somit auch
Überzeugungskraft verliehen. Durch die Erklärung wird das Argument erst einmal plausibel und
nachvollziehbar, und es wird Überzeugungsarbeit auf rationaler Ebene geleistet (vgl. Forst: 2015).
Besonders effektiv wird eine Erklärung dann, wenn ein plausibler Mechanismus aufgezeigt wird, der
aufzeigt, warum die eigene Behauptung stimmig ist. Hierzu sind Faktenkenntnisse und logische
Argumentationsmuster essentiell.
Aber gerade durch die Illustration werden Dinge anschaulich und oft auch auf emotionaler Ebene
überzeugend. Dinge werden zugespitzt und verbildlicht. Die Kunst der Illustration liegt darin,
komplexe Sachverhalte in eine einfache, anschauliche Form zu bringen. Gelungen ist sie, wenn
überzeugende Bilder in den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer entstehen. Wenn also im
Wortsinne das Kopfkino angeregt wird. Das Leitprinzip dient zum einen noch einmal der normativen
Stärkung des Gesagten. Denn Normativität ist wichtig, um Legitimation zu erzeugen (Forst: 2015).
Zum anderen dient das Leitprinzip aber auch noch einmal als eine Gesamtzusammenfassung und
damit als eine rhetorische Klammer. Das Schema soll nun an ein paar Beispielen veranschaulicht
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 15
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
werden. Es wird jeweils beispielhaft die Pro- und Contra-Position dargestellt.
Beispiele für das BEIL:
Thema: Resozialisierung von Strafgefangen
Pro: Die Aufgabe des Gefängnisses ist Stellen wir uns einen Menschen vor, In einer demokra-tischen
Resozialisierung ist es, Menschen auf ihr Leben in der einfach nur seine Strafe Gesellschaft, welche die
das erste Ziel des Freiheit vorzubereiten, da dies ja abgesessen und sich überhaupt nicht Menschen-würde
Strafvoll-zuges auch das grundlegende Ziel des mit seiner Tat auseinandergesetzt hat. hochhält, muss die
Menschen ist. Die Strafe selbst Diesen sollten wir wegen der Resozialisierung an
ist ja bereits der Freiheitsentzug. enormen Rückfallwahrscheinlichkeit erster Stelle stehen.
nicht auf die Menschheit loslassen.
Contra: Die Straftheorie kennt mehrere Ein Knast, welcher primär auf Diejenigen, die sich an
Resozialisierung ist Faktoren, nämlich die Resozialisierung setzt, entspricht ein der Gesellschaft
nur ein Ziel von Abschreckung, die Stück weit der Kuschel-pädagogik. vergangen haben,
vielen innerhalb Wiederherstellung von Zudem ist harten Jungs mit sollten nicht übermäßig
des Strafvollzugs Gerechtigkeit, die Sühne und die sozialpädagogischen Spielchen kaum viel Aufmerksamkeit von
Resozialisierung, also ist beizukommen. ihr bekommen
Resozialisierung nur ein Ziel von
vielen.
Thema: Bedingungsloses Grundeinkommen
Pro: Wenn die Leute nicht mehr Heute sind immer noch viel zu viele Es geht darum,
Das Bedin- gezwungen sind zu arbeiten, gezwungen, einen langweiligen selbstbestimmt zu leben
gungslose Grund- dann haben sie genau dadurch Bürojob zu machen, bei dem sie jeden und zu arbeiten. Und
einkommen führt mehr Freizeit und können sich schlechten Witz der Kollegen schon nicht darum zu leben
zu mehr Selbst- den Dingen widmen, auf die sie auswendig kennen und morgens vor und zu arbeiten
verwirklichung wirklich Lust haben. Frustration gar nicht aus dem Bett
kommen. Genau dem wirkt das
Grundeinkommen entgegen.
Contra: Wenn es für`s Nichtstun mehr Warum sollte die Putzfrau sich für 700 Nur wenn jeder sich
Das BGE macht die Geld gibt als für viele Jobs, die Euro noch einen abschuften, wenn sie durch Arbeit in die
Leute faul wir derzeit haben, so sinkt der weiß, dass sie für 800 Euro auch den Gesellschaft einbringen,
Anreiz zum Arbeiten. ganzen Tag abgammeln kann? kann diese
funktionieren.
Thema: Sichere Herkunftsländer definieren
Pro: Durch die Definition be-stimmter Ein armes und sicher entbeh- Politik braucht klare
Zuwanderung Länder, insbeson-dere der rungsreiches Leben im Kosovo ist Regeln, und die staat-
muss begrenzt und Balkanstaaten, haben die sicher nicht schön, aber nicht liche Souveränität muss
geregelt werden Flüchtlinge zumindest Klarheit. vergleichbar mit dem in Syrien, wo aufrechterhalten werden.
Und es werden somit mehr einen der eigene Staat, die Russen
Asylverfahren negativ und Amerikaner bombardieren und
beschieden. die Islamisten vor der Tür stehen.
Contra: Gerade im Westbalkan gibt es In Afghanistan steigen Bundesmi- Wir brauchen das Prinzip
Die Definition ein umfassendes organisiertes nister gern mit kugelsicheren Westen der Einzelfall-prüfung,
eines Landes als Verbrechen, teilweise archaische dort aus, wo ernsthaft darüber um ganz konkret
sicheres Her- Clanregeln und autoritäre diskutiert wird, diese Länder als entscheiden zu können,
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 16
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
kunftsland macht Geheimdienste. Daher können sichere Herkunftsländer auszuweisen. wer asyl-bedürftig ist
ein Land noch wir sicher nicht sagen, dass die und wer nicht.
lange nicht sicher Leute dort sicher sind.
Deduktionsargument
Das Deduktionsargument (von lat. deducere: wegführen) funktioniert ganz grundlegend so, dass von
einem Prinzip, welches benannt (und ggf. begründet) wird, um dann von diesem Prinzip auf ein
konkretes Beispiel zu schließen. Dieser Schluss ist logisch sehr stark. Zudem hilft die Benennung des
Prinzips der Klarstellung des eigenen moralisch-normativen Rahmens (Edmüller/Wilhelm 2014: 48).
Dieser gibt dann auch dem jeweiligen Beispiel mehr argumentatives Gewicht.
Ein Beispiel: Weil schon die Verfassung sagt, dass die Menschenwürde unantastbar ist, muss wirklich
jeder Einzelfall geprüft werden und es darf keine Obergrenze geben.
Weiteres Beispiel: Wenn es stimmt, dass Menschen in Not geholfen werden muss, dann bedarf es
notwendigerweise auch der Willkommenskultur.
Sofern die andere Seite ein Deduktionsargument hervorbringt, ist die erste Idee der Erwiderung der
Angriff auf die Verbindung des Prinzips zum Beispiel. Häufiger ist es jedoch sinnvoll, weitere
Prinzipien anzuführen und anhand dessen eine Abwägung zu machen. Dies hilft zum einen, um zu
anderen Schlussfolgerungen zu kommen, und zum anderen das argumentative Gewicht des Prinzips
der anderen Seite zu reduzieren.
Induktionsargument
Das Induktionsargument (lat. inducere: einführen) ist das genaue Gegenteil des
Deduktionsargumentes. Hier wird ein Beispiel angeführt und von diesem Beispiel dann auf ein
grundlegendes Prinzip geschlossen. Diese Art und Weise hat den großen Vorteil der Anschaulichkeit
und den großen Nachteil der geringen logischen Bindungswirkung (Aristoteles: 2016). Natürlich muss
das Beispiel dann möglichst repräsentativ sein.
Ein Beispiel: Wir haben ja bereits jetzt 4 Millionen türkische Muslime. Und auch hier hat die
Integration relativ gut geklappt. Daher wird dies jetzt auch bei den neuen Flüchtlingen klappen.
Ein weiteres: Mittlerweile haben hunderttausende Geflüchtete ihren Berufabschluss gemacht oder
lernen bereits in den Firmen. Dies sind gute Beispiele für das, was eine gelungene Integration möglich
macht.
Ein weiteres: Gegen den Dönerverkäufer um die Ecke hast du nichts, warum dann gegen andere
Ausländer?
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 17
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
Wenn wir mit Induktionsargumenten konfrontiert werden, so ist es sinnvoll, zunächst die
Repräsentativität des Beispiels zu bezweifeln, und dann mehr als ein Gegenbeispiel zu bringen.
Ebenso können hier auch wieder konkurrierende Prinzipien angeführt werden. Zudem lässt sich bei
Induktionsargumenten stets sagen: Dies ist doch nur ein Beispiel. Oder: Die Zusammenhänge sind
komplexer, als dieses Beispiel es vermuten lässt.
Das Induktionsargument und das Deduktionsargument sind absolute Grundlagen der Rhetorik, und
dies seit der Antike (Aristoteles: 2016). Sie erweisen sich aber auch am postmodernen Stammtisch
als hilfreich. Im Betrieb ist es sinnvoll, als Induktionsargument auf positive Beispiele gelungener
Integration zu verweisen.
Kettenargument
Das Kettenargument bzw. Folgenargument (Edmüller/Wilhelm 2014: 39) funktioniert grundlegend so,
dass jeweils ein Schritt in der Kette die Ursache für die Wirkung des jeweils Nächsten ist, was dann
seinerseits wieder die Ursache des nächsten Argumentationsschrittes ist. Illustrativ lässt sich dies so
veranschaulichen
A→B→C→D
Eine Kette kann natürlich noch deutlich länger werden, aber je länger eine Kette ist, umso
angreifbarer ist die Argumentation. Das Kettenargument funktioniert deshalb so gut, weil unser
Denken sehr stark in Ursache-Wirkungs-Schemata funktioniert (sog. Kausal-mechanisches Denken).
Ebenso sind auch grundlegend viele Argumentationsschemata nach dem Schema
„Wenn…dann“ aufgebaut. Nach dem Schema der Logik ist ein Kettenargument ein multiples
Deduktionsargument.
Ein Beispiel: Wenn wir Flüchtlinge mit einer wirklichen Willkommenskultur empfangen, dann werden
sie sehen, dass wir ihnen vertrauen. Und da Menschen gern Vertrauen zurückgeben wollen, werden
sie sich in besonderem Maße integrieren.
Ein weiteres: Wenn wir die Grenzen komplett schließen, wird dies zu mehr Leid und damit auch Hass
auf den Westen führen. Dies wiederum kann sich dann gerade in Gewalt und Terrorismus entladen.
Natürlich stellt jedwede Kettenargumentation notwendig eine Komplexitätsreduktion (vgl. Luhmann:
1984) dar. Denn jede Kette impliziert einen linearen Zusammenhang, obgleich die Welt sicher nicht
linear ist. Dadurch aber werden Argumente auch schneller verständlich und handhabbar.
Um einer Kettenargumentation begegnen zu können, gibt es drei Wege. Erstens und bestens: direkter
Angriff auf die Prämissen des ersten Schrittes der Kette. Zweitens: Eine alternative
Kettenargumentation aufmachen, welche dann immerhin ein argumentatives Patt generiert.
Drittens die Umarmungsstrategie: Die ersten Schritte der Kette mitgehen, aber dann zu einer anderen
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 18
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
Schlussfolgerung kommen.
Moralisch-ethische Argumentation
Dies ist eine Unterkategorie des Deduktionsargumentes. Hier werden besonders moralisch relevante
Prinzipien angeführt, um die eigene Argumentation zu untermauern (Wehling: 2016; Haidt: 2012).
Insbesondere die Artikel 1-20 des Grundgesetzes bringen hier das entsprechende Material. Ebenso
alle gemeinsam geteilten moralische Grundsätze bestimmter Gesellschaften und Gruppen. Respekt,
Solidarität und Kollegialität sind dann wichtige Prinzipien im Betrieb.
Moralische Grundprinzipien, auf die sich wohl die große Mehrzahl der Gesellschaft einigen kann, sind
Freiheit, Gerechtigkeit, Umweltschutz, Chancengleichheit, Nachhaltigkeit, Menschenwürde,
Gemeinwohl, Gesellschaftlicher Nutzen und weitere. Natürlich müssen diese Prinzipien dann auch
entsprechend definiert sowie ihre jeweilige Relevanz für die Debatte herausgestellt werden
(Bartsch/Hoppmann/Rex/Vergeest: 2013). Der große Vorteil der moralisch-ethischen Argumentation
liegt darin, dass sie eine starke emotionale Wirkung hat. Gerade bei einem größeren Auditorium ist
sie sehr wirkungsvoll. Am Anfang innerhalb eines Streitgespräches empfiehlt es sich, ein moralisch-
ethisches Argument einzuführen, um den legitimen Diskursrahmen zu begrenzen. Im späteren
Verlauf sind diese Argumente zur Zuspitzung und zur Stärkung der eigenen Legitimation sinnvoll.
Jedoch sollte damit nicht übertrieben werden. Und: Natürlich lassen sich moralisch-ethische
Argumente auch manipulativ einsetzen (Edmüller/Wilhelm: 2014).
Ein Beispiel: Menschen zu schützen, wenn sie in Gefahr sind, ist ein ganz wichtiges Grundprinzip des
Zusammenlebens. Dies gilt natürlich auch im globalen Maßstab. Deswegen ist es schlicht
Menschlichkeit, wenn Bürgerkriegsflüchtlinge hier bei uns Zuflucht finden.
Ein weiteres Beispiel: Jeder, der hier bei uns arbeitet, ist erst einmal Kollege. Erst dann ist er Deutscher,
Türke, oder was auch immer.
Definitionsargument
Das Definitionsargument funktioniert so, dass zentrale Begriffe in einer Debatte im eigenen Interesse
definiert werden. Es ist eine Unterkategorie des Deduktionsargumentes. Das Ziel dabei ist, dass die
eigene Definition bestimmte Schlussfolgerungen plausibler macht und andere Definitionen weniger
plausibel.
Wenn zum Beispiel aus progressiver Sicht Gerechtigkeit zu definieren ist, so könnte sie zum Beispiel
so definiert werden, dass niemand benachteiligt werden darf. Oder jene von John Rawls
(amerikanischer Moralphilosoph), welcher besagt, dass diejenigen, die am schlechtesten gestellt sind,
am meisten bekommen sollen. Aus konservativer Perspektive bedeutet Gerechtigkeit, dass diejenigen,
die mehr leisten und sich mehr anstrengen, dann auch entsprechend mehr bekommen.
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 19
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
Das Definitionsargument, welches gern durch Formulierungen wie „Unter…verstehe ich“, „…heißt für
mich“ engeführt wird, sollte am Anfang genutzt werden, um den Diskurs zu rahmen, aber auch, um
eine sachliche Übereinkunft mit dem Publikum zu erzielen.
So kann zum Beispiel eine gelungene Flüchtlingspolitik als eine definiert werden, die von Anfang an
integriert, alle Menschen mitnimmt und Flüchtlinge schnell in Arbeit bringt.
„Willkommenskultur bedeutet, dass diejenigen Menschen, die hierherkommen und schutzbedürftig
sind, mit offenen Armen empfangen werden“.
Eigenwertbruchargument
Das Eigenwertbruchargument ist der Generalangriff auf die Glaubwürdigkeit des Gegenübers. Es
funktioniert so, dass zunächst die Grundwerte oder Prinzipien der anderen Seite thematisiert und
explizit benannt werden. Dann wird anhand eines konkreten Beispiels erklärt, warum die andere Seite
gegen eines ihrer Prinzipien verstoßen hat. Danach wird dann die generelle Glaubwürdigkeit in Frage
gestellt.
Dieses Argument wirkt, gerade vor Dritten, sehr stark. Allerdings sorgt es dann häufig dafür, dass
auch die andere Seite nach Verletzungen der eigenen Prinzipien schauen wird. Daher kann es
strategisch nur gesetzt werden, wenn die Leichen im eigenen Keller überschaubar sind. Das
Eigenwertbruchargument dient dazu, das jeweilige Gegenüber zu verunsichern. Denn gerade weil
andere, die Medien oder die Politik gern abgewertet, ist die Referenz das, was die Person selbst sagt.
Dies lässt sich dann deutlich schwerer abwerten.
Beispiel: Die AfD gibt vor, deutsche Interessen zu vertreten. Deutschland ist in besonderem Maße
Exportland (Definitionsargument), weshalb die Offenheit der Märkte im besonderem deutschen
Interesse ist. Jedoch ist sowohl die Abschaffung des Euro als auch der Austritt aus der EU
kontraproduktiv, da somit Absatz erschwert wird. Folglich schaden die Forderungen der AfD
deutschen Interessen.
Gerade im Kontext der Flüchtlingsdiskussion kann dieses Muster wie folgt aussehen:
Frage: Würdest du für dich in Anspruch nehmen, ein möglichst gutes Leben führen zu wollen:
Antwort: Ja
Frage: Würdest du auch anderen Menschen zugestehen, dass sie ein möglichst gutes Leben führen
wollen.
Antwort (meistens): ja
Frage: Warum genau bist du dann dagegen, dass Menschen hierherkommen, die genau dasselbe
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Reader Argumentation gegen Seite 20
Institut für Kommunikation Rechtspopulismus und für Zivilcourage
IKG und Gesellschaft
wollen wie du?
Analogieargument
Das Analogieargument ist eine Form der zweifachen Induktion. Ein eigenes Beispiel wird mit etwas
zweitem, möglichst anschaulichen verglichen, um dann anhand der positiven oder negativen
Bewertung des Analogons den eigenen Redegegenstand aufzuwerten oder abzuwerten. Durch die
Analogieargumentation können Sachverhalte sehr anschaulich gemacht werden. Jedoch ist es
wichtig, dass die Vergleiche gut funktionieren. Die sprichwörtlichen Äpfel mit Birnen darf es nicht
geben.
Ein Beispiel: Deutschland war ja, aus seiner Geschichte heraus, das historische Schmuddelkind
schlechthin. Dann war und ist es zwar wirtschaftlich erfolgreich, aber auch ein wenig grau und
langweilig. Jetzt hingegen kommt wirklich Farbe hinein, und das ist auch gut so.
Analogieargumente helfen, um Sachverhalte zu veranschaulichen und damit etwas lebendig zu
machen. Der deutsche Philosoph Ludwig Wittgenstein hat dies wie folgt formuliert: „Die
Möglichkeit aller Gleichnisse, der ganzen Bildhaftigkeit unserer Ausdrucksweise, ruht in der Logik
der Abbildung.“ (Wittgenstein 2014 (1922), S. 32).
Rationalistisches Argumentationsmuster: 3-TSB
Das 3-TSB Schema ist ein gutes Argumentationsmuster, um rational und faktenbasiert argumentieren
zu können (vgl. Habermas: 2014). Es setzt ein entsprechendes Maß an Fachkenntnis und Wissen
voraus, und es ist wie folgt aufgebaut:
Tatsache
Tatsache
Tatsache
Schlussfolgerung
Behauptung
Durch die Tatsachen wird zunächst eine Zustimmungstendenz geschaffen. Dies wiederum erleichtert
die spätere Zustimmung zur Schlussfolgerung. Zudem wird die Sachkompetenz durch die Tatsachen
unterstrichen. Es können natürlich auch mehr oder weniger als drei Tatsachen sein, aber drei haben
für gewöhnlich genügend argumentatives Gewicht, sind aber nicht zu lang.
Aus den Tatsachen wird dann eine bestimmte Schlussfolgerung gezogen. Diese basiert auf den
Tatsachen und ist entsprechend parteiisch. Und wenn dann ein bestimmtes Deutungsmuster (denn
das ist eine Schlussfolgerung) geteilt wird, so wird es deutlich leichter, dann auch der eigentlichen
AArg [Hier eingeben] [Hier eingeben]Sie können auch lesen