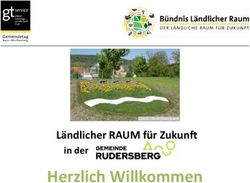Aufgaben: Klima und Klimawandel - eduACADEMY
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Sabine Baumgartner, Magdalena Weilhartner, Christian Brunner, Melanie Höglinger
Aufgaben: Klima und Klimawandel
1. Suchen Sie auf den Seiten der Zentralanstalt für Meteorologie (www.zamg.ac.at) die
Klimadaten der Ihrem Schulstandort am nächsten gelegenen Klimastation. Beschreiben
Sie die Klimafaktoren wie z.B. Niederschlag und Temperatur.
Schulstandort: Steyr
Nächstgelegene Klimastation: Kremsmünster (Seehöhe: 382m)
Klimafaktoren: Im Jahr 2020 steht der Jahresmittelwert der Temperatur derzeit mit 12°C.
Im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 1981-2010 ist die Temperatur in diesem Jahr um
1,5°C gestiegen, allerdings kann dies durch den Monat Dezember noch beeinflusst
werden. Es ist in Bezug auf die Temperatur auch abzulesen, dass im Februar neue
Temperaturmaxima für diese Jahreszeit erreicht wurden. Außerdem ist zu sehen, dass es
oftmals zu kalt oder zu warm für die jeweiligen Monate war, insbesondere von Februar bis
April.
Beim Niederschlag wurde im Jahr 2020 bisher 1027mm festgestellt, damit gab es in den
Vergleichsjahre 1981-2010 um 87mm weniger Niederschlag. Auffallend ist, dass, auf den
Mittelwert der vergangenen Jahre bezogen, in den Monaten Juli bis November
durchgehend einer Niederschlagsüberschuss gemessen wurde, in den Monaten Jänner,
April und Mai gab es jedoch ein Niederschlagsdefizit. Nur im Juni orientiert sich der
Niederschlag am Mittelwert.
Zuletzt wird noch auf die Sonnenscheindauer eingegangen. Diese ist in diesem Jahr
wiederum etwas höher als in den Vergleichsjahren: Im Jahr 2020 liegt sie bei 1847
Stunden, in den Jahren 1981-2010 bei 1725 Stunden.
2. Methode - Arbeiten mit Klimakarten und Diagrammen:
1. Wählen Sie ein Klimadiagramm von Österreich aus und beschreiben Sie das Klima.
Lienz liegt auf 659 Metern und wird als Dfb
eingestuft, ist also kalt und immerfeucht. Die
Temperatur liegt in Lienz im Jahresdurchschnitt bei
7,5°C und es gibt während des Jahres insgesamt
897 mm Niederschlag.
Der wärmste Monat ist Juli mit ca. 20°C. In den
Monaten Dezember und Jänner ist es am kältesten
mit jeweils -5°C.
Am meisten Niederschlag gibt es im Sommer, vor
allem in den Monaten Juli und August mit jeweils
100 mm Niederschlag. Am wenigsten Niederschlag
gibt es im Monat Februar mit 40 mm.Sabine Baumgartner, Magdalena Weilhartner, Christian Brunner, Melanie Höglinger
2. Zeichnen Sie ein Klimadiagramm eines Tourismusortes in Österreich
(https://www.rechner.club/wetter/klimadiagramm-erstellen)
3. Wählen Sie eine Klimakarte und beschreiben Sie den Einsatz im Unterricht. (aus
Zamg, Statistik Austria, ... )
https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news/aussergewoehnlich-heisser-juni/image/image_view_fullscreenSabine Baumgartner, Magdalena Weilhartner, Christian Brunner, Melanie Höglinger Die Karte bezieht sich auf den Juni 2019. Dieser war der wärmste Juni in der Messgeschichte. Auf der Karte sind nun die Temperaturunterschiede zu einem durchschnittlichen Juni abgezeichnet. Im unteren Bereich der Karte sind Temperaturveränderungen in 0,5er-Schritten mit ihren dazugehörigen Farben abgebildet, sodass die Karte gut zu lesen ist. Zusätzlich werden auch noch das Minimum, das Maximum sowie der Mittelwert angegeben. Die Karte kann als Anstoß für die Themen Klimawandel/ Klimaerwärmung sowie Wetterextreme verwendet werden. Zuerst sollte sie jedoch gemeinsam gelesen und interpretiert werden. Hierbei kann man auch die Schülerinnen und Schüler zuerst raten lassen, was sie auf der Karte sehen. Nachdem sich die Karte auf das Jahr 2019 bezieht, kann man nachfragen, wer sich an diesen heißen Monat erinnert und anschließend über die Berichterstattung zu dieser Zeit recherchieren. Ebenso könnte man Familienmitglieder befragen, ob sie eine Veränderung in den Temperaturen der letzten Jahre bemerkt haben. Zudem kann man eine Karte aus Juni eines anderen Jahres heranziehen und die beiden vergleichen. Wenn keine Karte vorhanden ist, kann man auch mit den Werten aus 2019 und anderen Jahren arbeiten. Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Schülerinnen und Schüler überlegen zu lassen, welche Auswirkungen solche Temperaturen in Österreich haben (Wirtschaft, Vegetation, …). Hierbei kann man wieder auf Berichterstattungen zurückgreifen. 3. Nehmen Sie Einsicht in den Gefahrenzonenplan eines Tourismusortes im alpinen Hochgebirge. Gefahrenzonenplan des Ortes GALTÜR Seehöhe: 1.584m Lage: Bezirk Landeck in Tirol
Sabine Baumgartner, Magdalena Weilhartner, Christian Brunner, Melanie Höglinger
Welche Gefahren werden angesprochen? Welchen Einfluss haben diese auf die
Flächenwidmung?
Der Siedlungsraum der Gemeinde Galtür ist von sechs Wildbächen und 32 Lawinen
beeinträchtigt. Davon haben vor allem die „Großtal-Lawine“, die „Innere und Äußere
WasserleiterLawine“ und die „Portrinner-Lawine“ wiederholt Sach- und Personenschaden
verursacht (Fliri 1998; vgl. Tab. 2). Die durch Lawinen und Wildbäche gefährdeten Zonen
umfassen eine Gesamtfläche von ca. 216 ha, wovon etwa drei Viertel (165 ha) als Rote und
ein Viertel (51 ha) als Gelbe Gefahrenzone ausgeschieden sind (Gefahrenzonenplan
Gemeinde Galtür, ÖSTAT 1993). Diese Gefahrenzonen blieben auch nach der Errichtung
der Schutzbauten als Konsequenz aus dem Schadenwinter 1999 in ihrer bisherigen
Ausdehnung erhalten.
Die rote Gefahrenzone umfasst jene Flächen, die durch Wildbäche oder Lawinen derart
gefährdet sind, dass ihre ständige Benützung für Siedlungs- oder Verkehrszwecke wegen
der voraussichtlichen Schadenswirkung des Bemessungsereignisses oder der Häufigkeit
der Gefährdung nicht oder nur, durch unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.
Die gelbe Gefahrenzone umfasst alle übrigen durch Wildbäche oder Lawinen gefährdeten
Flächen, deren ständige Benützung für Siedlungs- oder Verkehrszwecke infolge dieser
Gefährdung beeinträchtigt sind.
Welche Eingriffe werden durch die menschlichen Aktivitäten vorgenommen?
• Bau von Lawinenschutzmauern, Dämmen im Talbereich, Errichtung einer
Stützverbauung im Anbruchgebiet der Lawinen.
• Es wurden Stahlschneebrücken errichtet.
• Eine automatische Wetterstation für eine verbesserte Lawinenprognose.
• Schutzwälder werden angelegt.Sabine Baumgartner, Magdalena Weilhartner, Christian Brunner, Melanie Höglinger
5. Beurteilen Sie die Kurzfilme zum Thema Klimawandel nach: Einsetzbarkeit im
Unterricht, Informationsgehalt, Aufbau und Gestaltung, Quelle.
Name Einsetzbarkeit im Informationsgehalt Aufbau und Gestaltung Quelle
Unterricht
Klimabündnis Gut einsetzbar, ist einfach und Ansprechende Gestaltung, https://www.klim
nicht zu lange und informativ gehalten, passend für SuS, nicht abuendnis.at/kli
interessant aufgebaut nicht nur überladen mawandelanpas
Klimawandel sondern sung-in
3. Klasse SEK 1 auch Anpassung
Thema
Klimawandelanp Zu lange, könnte Kooperationen Sehr schnell, wechselnde https://www.yout
assung Aufmekrsamkeitsprobl zwischen Szenen, verschiedene ube.com/watch?
eme mit sich bringen, Organisationen, um Personen, etwas langweilig v=6R_CVVp5Rv
zu viele Personen, nur Klimaanpassung gestaltet Y&t=
zum Teil einsetzbar umzusetzen. Eher
Werbung, als
SEK 2 Lernvideo.Sabine Baumgartner, Magdalena Weilhartner, Christian Brunner, Melanie Höglinger
Ökobilanz Gute Länge, Sehr informativ, regt SuS können sich https://www.yout
Lebensmittel lebensnah, gute zum Umdenken an, wahrscheinlich gut in die ube.com/watch?
Bezüge für SuS einige Fachbegriffe gewählte Szene v=54aBcQTwPZ
sollten geklärt hineinversetzen, schöne 0
3. Klasse SEK 1 werden Gestaltung, angenehme
Stimme
Klimawandel Länge passend für Zu Beginn sehr viele extrem kindliche Gestaltung https://www.yout
Unterricht Infos, könnte jüngere Anfang sehr schnell, Ende ube.com/watch?
SuS überfordern, gut gestaltet v=48hYcexCnH
1. Klasse SEK 1 Ende ist gut, da Tipps A
gegeben werden und
Bezug hergestellt
wird
6. Analyse der Ziele der Agenda 2030
Ziel 2. Den Hunger beenden
Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige
Landwirtschaft fördern
Umsetzung:
Bei der Umsetzung stehen Selbstversorgung und Regionalität im Fokus. So wird zum
Beispiel die Berglandwirtschaft, genetische Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen und
Nutztieren gefördert.
Es gibt ein Anbauverbot für gentechnisch veränderte Pflanzen. Ein weiterer Fokus wird auf
biologische Landwirtschaft und gesunde Ernährung in der Schule gesetzt.
Ziel 5: Geschlechtergleichstellung
Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung
befähigen
Umsetzung:
Es werden Beratungseinrichtungen, Projekte und Notwohnungen vom Bundesministerium
für Gesundheit und Frauen gefördert. Dies soll gegen Zwangsheirat, „Femal Genital
Mutilation“ und Frauen- und Mädchenhandel kämpfen. Auch wird mit Initiativen zur
Diversifizierung dafür gekämpft, dass Frauen dieselben Chancen im Arbeitsmarkt
bekommen, wie Männer. Es gibt dazu eine Online-Plattform „Meine Technik“, die FrauenSabine Baumgartner, Magdalena Weilhartner, Christian Brunner, Melanie Höglinger und Mädchen hilft, einen Zugang zu naturwissenschaftlich-technischen Ausbildungen zu bekommen. Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern Umsetzung: Um die Zielwerte der Anteile an erneuerbarer Energie am Bruttoendenergieverbrauch zu erreichen gibt es vom Bundeministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft das Programm „Unternehmen Energiewende“ und forderte die österreichische Wirtschaft dazu auf, sich daran zu beteiligen, erneuerbare Energieträger zu verwenden. Unterstützung gibt es hier in Form einer Klimaschutzinitiative, einer Umweltförderung, dem Klima- und Energiefonds der Österreichischen Bundesregierung und „Climate Austria“, dies ist eine Plattform, mit der man CO2- Emissionen kompensieren kann. Ziel 10: weniger Ungleichheiten Ungleichheiten in und zwischen Ländern verringern Umsetzung: Das Gleichstellungsziel soll durch das Abgabensystem unterstütz werden. Dies zielt auch auf das Ziel 5 ab. In der Steuerreform 2015/16 gab es Maßnahmen, die zur Förderung des Ziels beitragen. Zum Thema Integration wurden 2017 Maßnahmen eingeführt. Diese beinhalten Integrationsförderung und Integrationspflicht. So wird das Deutschkursangebot und der Werte- und Orientierungskurs für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte ab dem vollendeten 15. Lebensjahr sowie AsylwerberInnen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit ausgebaut. Des weiteren bekommen sie Unterstützung beim Spracherwerb, Kompetenzclearing, Berufsorientierung und mehr. Quelle: Bundeskanzleramt Österreich (2016). Beiträge der Bundesministerien zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung durch Österreich. Zugriff am 29.11.2020 unter https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda- 2030/publikationen-und-medien-agenda2030.html
Sie können auch lesen