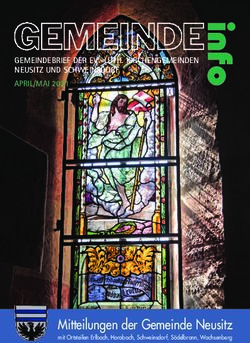Aus einem südamerikanischen Tagebuch: Audienz beim brasilianischen Aussenministerium
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
1
Aus einem südamerikanischen Tagebuch: Audienz beim brasilianischen
Aussenministerium
Heinrich Eduard Jacob
[...]
Nicht mit dem Gesicht auf Inseln und Schiffe, nicht in der Bai von Botafogo wohnt der
brasilianische Außenminister. Nein, ganz im Hintergrunde der Stadt, wo das Meer gar nicht
vorstellbar ist, am Ende einer Geschäftstraße: dort wohnt Afranio do Mello-Franco.
Palacio Itamaraty. Portugiesisch die Hausbezeichung, indianisch aber der Eigenname.
Was sich vor Jahrhunderten fand, die weiße Sprache, die braunen Menschen, das ist heute
längst eins geworden und bildet das Brasilianische. Ita heißt Stein. Itamaraty heißt Stein plus
einem Eigenschaftswort … Doch wie man den Palast betritt, vergißt man alles Indianische. Er
hat etwas wahrhaft Kaiserliches, mit seiner marmornen Innen-Einrichtung. Hier könnte
Canova umherwandeln, der Bildhauer Napoléons – und wirklich: ein großer Kupferstich, der
den Wiener Kongreß darstellt, hängt als Schmuck im Empfangskabinett, das jetzt der
jungendliche Sohn des Ministers Mello-Franco betritt.
Er trägt einen weißen Tropenanzug. Trotz seiner siebenundzwanzig Jahre nennt man
ihn schon Staatssekretär und Ersten Gehilfen seines Vaters. In der Innenpolitik seiner engeren
Heimat Minas-Gerais soll der junge Mello-Franco bereits eine große Rolle spielen. (Eine
verwickelte Politik, advokatorisch-rednerisch und uns sicher nicht sehr verständlich.) Er sagt
mir, daß mich sein Vater erwartet; und nun beginnt die Wanderung durch die Kabinette und
Galerien, in denen spiegelglattes Gestein mit schwarzem Jacaranda-Holz wechselt. Ueberall
[sic] schwere grüne Gardinen. Wenn nicht in dieser winterlosen Welt die Kamine überall
fehlten, dachte man sich in Fontainebleau.
Bei diesem Gange fällt mir ein, daß der junge Mensch, der mich führt, den klassischen
Vornamen „Vergil“ trägt: bezaubernder Beweis dafür, daß das Gesicht Südamerikas immer
noch nach dem Mittelmeer ausblickt und nach der lateinischen Kultur. „Eigentlich“ berühre
ich das „müßte jeder Gast Dante heißen, der von Ihnen geführt wird, Senhor!“ Hierüber
beginnt Virgilio zu lachen – und dieses Lachen der Höflichkeit, des literarischen
Einverständnisses verläßt ihn, solange ihn da bin, nicht mehr. Es geleitet mich hinüber in die
Audienz, die sein Vater gibt.2
Afranio do Mello-Franco, der einst Brasilien in Genf vertrat – der Außenminister eines
Staates, der das viertgrößte Territorium hinter Rußland, British-Empire und dem chinesischen
Reich besitzt – ist ein kleiner sehniger Herr, in dessen Antlitz sich mehrere Völker von alter
und hoher Kultur begegnen. Vorherrschend die Schmalheit der Portugiesen; die leichte
Tabakfarbe der Haut spricht von Aristokratie. Vater und Sohn verharren stehend. Bevor der
Besuch sich nicht gesetzt hat, können die Beiden nicht Platz nehmen, anders als bei uns im
Norden, wo – weil Stellung und Rang entscheiden – oft das schwere Gesäß des Hausherrn mit
dem Sitzen den Anfang macht. Da ich das Zeremoniell nicht kenne, stehe ich zunächst
ebenfalls, bis ein paar farbige Diener mir einen Empire-Sessel von hinten in die Kniekehlen
schieben. Nun setzen sich auch Vater und Sohn.
Drehen und Neigen von Ventilatoren, die, leicht schwatzend wie lebende Wesen von
verschiedener Tonstärke, sich an der Decke des Saals unterhalten. Der Saal ist groß, aber
grottenhaft. – „Es ist bei mir nicht ganz so schön, mein Herr, wie in der Wilhelmstraße“
beginnt der Minister leicht das Gespräch. Ich sage, daß ich es schöner fände – wegen des
völligen Mangels an Palmen, den man Berlin nicht abstreiten könne. Ein „sorriso“, ein
leichtes Lächeln, breitet sich über Afranios Gesicht.
„Es fiel mir schwer, mich hinzusetzen, Herr Minister!“ gestehe ich. „Denn ich sehe auf
Ihren Möbeln überall das silberne N und die kaiserlichen Bienen. Es ist ein aufregender
Gedanke, daß dies die Möbel Napoléons sind! Wie kommen Ihre Exzellenz hier auf der
südlichen Halbkugel zu den Möbeln Napoléons?“ „Das also haben Sie bemerkt“, stellt Mello-
Franco freundlich fest. Und schon ist das Einverständnis da. In den lateinischen Ländern des
Südens sind Literatur und Bildung alles; aber sie sind es wahrscheinlich darum, weil sie –
anders als im Norden – kein wirkliches Allgemeingut sind. Mit leichtem, angenehmem Stolz
– nicht anders als ein vornehmer Grieche erzählt, sein Name oder sein Garten würde bereits
bei Homer erwähnt – erzählt Afranio do Mello-Franco die lange Geschichte der grünen
Möbel. Die größte Rolle spielt darin das Lissabonner Königshaus und seine Flucht nach
Brasilien vor den Truppen des Generals Junot. Aber das ist nur die erste Hälfte. Die zweite
Hälfte dieser Novelle wird von mir nicht mehr voll erlebt; denn im Hintergrunde des Saals,
vor dem glühenden Blau des Fensters begibt sich etwas Ablenkendes. Es ist der „Abraço
brasileiro“, ein Akt von starkem, fremdartigem Reiz, den da zwei Freunde einander erteilen.
Ein weißgekleideter hoher Beamter ist durch die linke Tür gekommen und durch die rechte
ein großer Mulatte, mit Kraushaar und kupferblankem Gesicht. Mit einem lautlos entzückten
Lächeln fallen beiden sich in die Arme – das heißt: sie bleiben, Brust an Brust, in einer Fast-
Berührung stehn [sic]. Ihre Körper sind so arrangiert, dass beide sich über die Schulter sehn3
[sic] und mit der rechten Hand rhythmische Schläge auf den Rücken des Freundes ausführen,
während sie die linke Hand leicht um seine Hüfte ranken. Dann treten sie rasch von einander
weg und sehn [sic] sich begeistert ins Gesicht.
Im Vordergrund geht die Erzählung zu Ende. Napoléons Stiefsohn, der Vizekönig
Eugen, ist es also gewesen, der die Möbel Brasilien schenkte! (Oder eigentlich sein Sohn, der
junge Herzog von Leuchtenberg.) „Aber das wollten Sie doch nicht wissen?“ schließt mit
einer entzückenden Volte der Außenminister seine Erzählung.
„Nein, – aber ich hätte gerne gewußt, wie Brasilien der Einwanderung gegenübersteht.
Ist sie erwünscht?“
„Wir brauchen Menschen!“ beginnt Mello-Franco. „Es ist kaum eine Uebertreibung
[sic], wenn ich sage: unser Land könnte die doppelte Anzahl ernähren!“ („Oder auch töten“
muß ich denken. Denn die Gefahren des Kolonisierens sind für Fremde riesengroß. Erst muß
ja der Wald weggeschlagen werden und das Fieber ausgetreten, das in der nassen Niederung
züngelt …) „Natürlich“ nimmt er, obwohl ich schweige, meinen Gedanken gleich beim Kopf,
„bedeutet Einwanderung bei uns Urbarmachung neuer Gebiete. Denn in den überfüllten
Städten könnten die Fremden sich nicht behaupten.“
Haben sich die Deutschen bewährt?“
Auf diese Frage hat er gewartet, um ein Elogium zu beginnen. „Die deutsche Arbeit in
Brasilien ist eine unvergleichliche! Was haben in diesem letzten Jahrhundert die Deutschen
für Brasilien geleistet! Ich bin ein Minenser, ein Mann aus Minas; ich kann bezeugen, daß
meine Provinz den Bergbau von den Deutschen lernte. Andere Bundesstaaten lernten wieder
die Landwirtschaft von ihnen, das Bierbrauen, die Textilindustrie. Und die Wissenschaft?“ Er
nennt eine lange Reihe von Namen, deutschen Klanges, die ich nicht kenne. Nennt sie in
warmer Bewunderung. Seltsam: sie wirken wie komische Trümmer, hier in einem fremden
System, hier in einer andern Kultur. „Varnhagen …“ sagt er. Ich merke auf. „Den kenne ich“
möchte ich ausrufen. Aber es ist ein anderer Varnhagen, der größte Historiker Brasiliens, der
nur portugiesisch schrieb, den deutschen Namen dann ablegte, und „Visconde de Porto
Seguro“ hieß. – Nur ein Name wird nicht genannt. Das ist der Name Lauro Müller. Denn
unter Lauro Müllers Mitschuld, – wenn auch nicht unter seiner Führung – trat Brasilien in den
Weltkrieg. An der Seite des Feindbundes, im Jahre 1917.
Ein stolzes und wehmütiges Gefühl überkommt mich, als Mello-Franco erklärt: vom
brasilianischen Standpunkt sei es aufs Heißeste zu beklagen, daß der millionenstarke
Volksstrom, der nach 1848 von Deutschland abgeflossen sei, sich gegen Nordamerika
gewandt habe und nicht nach Brasilien. „Daran waren Ihre Gesetze schuld“, sagte der4
Minister, und ich höre, daß lange ein „von der Heydt’sches Reskript die Auswanderung nach
Brasilien verbot.“
„Aber wer war denn von der Heydt?“
„Ein preußischer Finanzminister!“
Und wieder Namen über Namen berühmter Eingewanderter. Felipe Schmidt, Adolphe
Horn, Marcos Konder, Viktor Konder. „Dies alles sind, wenn auch deutsche Namen, Namen
sehr guter Brasilianer“, sagt Afranio do Mello-Franco. „Ueberzeugen [sic] Sie sich selbst!
Fahren Sie in die Südstaaten und fragen Sie Ihre Landsleute, ob sie mit uns zufrieden sind!“
Er stockt. Dann fährt er bedeutsam fort: „Ja, ich will hoffen, daß sie es sind! Denn bei uns ist
jeder Bürger gleich, welcher Abstammung er auch sei. Wir sind eine Nation – aber keine
Rasse. Vielleicht“, vollendet er träumerisch, „werden wir eine sein, wenn wir die Besten, die
Allerbesten in uns aufgesogen haben.“
Ich schweige. Was kann ein Europäer, ein Mensch aus dem unglücklichsten Erdteil,
hier eigentlich Klügeres tun als schweigen? Ich denke daran, daß man mir gestern die
japanische Einwanderung rühmte … Einwandern heißt aber auch: heiraten. Heißt: weiße oder
braune Farben mit japanischen Männern mischen … Und nirgends Hetze! Nirgends Geschrei!
Ueberall [sic] Wohlwollen: denn Brasilien braucht zähe, tapfere Pioniere, braucht also auch
die genügsamen Gelben! – Während mich der Minister zur Tür bringt (ich selber habe mich
erhoben; denn es wäre undelikat und ist verboten, einem Besuch zu zeigen, daß man
beschäftigt ist), sagt er mehrmals tupfend und leicht: Auch ein Professor der Sorbonne hat
neulich darauf hingewiesen, daß Brasilien gerade dem Deutschtum die allergrößten Impulse
verdankt … Auch ein Professor der Sorbonne!“
Wie ritterlich, mir das zu sagen! Hätte ihn ein Franzose besucht, so hätte dieser
Außenminister gewiß Gelegenheit gefunden, ihm etwas aus deutschem Munde zu sagen, ein
Elogium Frankreich aus deutschem Mund … Welch eine bezaubernde Höflichkeit! Man
müßte ein trauriger Bursche sein, um diesen Aggregatzustand einer gekelterten Sittlichkeit
etwa mit „Lüge“ zu verwechseln.
Nach glattem, angenehmem Gespräch ein glatter, angenehmer Rückweg. Und als
Senhor Vergilio sich unten an der Marmortreppe zart und höflich verabschiedet, da steigt wie
von selbst auf meinen Lippen die portugiesische Floskel auf:
„Obrigado ! … Muit’ obrigado [sic] ! – Ich danke ! ... Ich bin Ihnen sehr verpflichtet
!“ [...]5 FONTE: Die literarische Welt, ano 8 n° 45, 1932, p. 3-4. Trecho selecionado por Marlen Eckl.
Sie können auch lesen