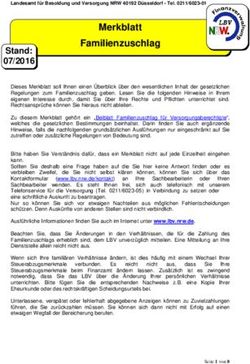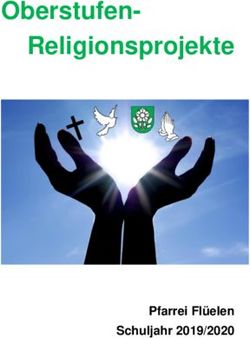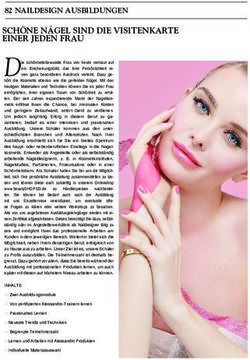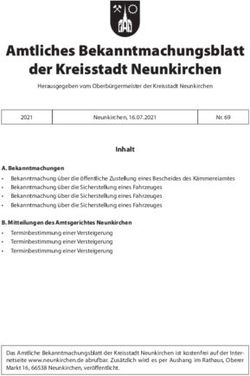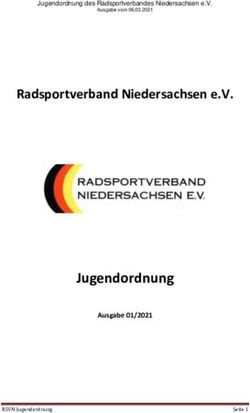D.W. WINNICOTT Objektverwendung, Übergangsraum, Spielen - Dozent: Andreas Klöcker
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
D.W. WINNICOTT
Objektverwendung, Übergangsraum, Spielen
AAI
Mai 2021
Dozent: Andreas Klöcker„Spielen in der Psychotherapie“
– Bedeutung, Einsatz und Technik des Spiels
und Spielens in der Psychotherapie mit
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
(3. Abend)
AAI
März 2021
Dozent: Andreas KlöckerWelcome back
der 3. Abend
Was bisher geschah:
1.Der eigene Zugang zum Thema spielen
2.Ein kulturhistorischer Rückblick
3.Allgemeine psychologische Betrachtungen zum Spiel
4.ANNA FREUD und MELANIE KLEIN
5.WINNICOTT…
die Frage die hier letztlich offen geblieben ist, lautet:
Warum ist Spielen eigentlich Psychotherapie?
oder
Wie begründen wir (mit WINNICOTT) spielen als etwas
psychotherapeutisch Wirksames?D.W. WINNICOTT
Objektverwendung
Übergangsraum
SpielenD.W. WINNICOTT
Objektverwendung
WINNICOTTS Ausgangsfrage:
Wie und warum gelingt Deuten eigentlich?
Und warum braucht Deuten Zeit?
„Wenn (…) Deutungen des Analytikers eine Wirkung haben sollten (…)…
braucht es die Fähigkeit des Patienten, vom Analytiker Gebrauch zu machen.
„(1)
• [1] Kapitel 6 aus D.W. WINNICOTT: Vom Spiel zur Kreativität .Stuttgart: Klett-Cotta1990WINNICOTT : Objektverwendung II
Objektverwendung ein ganz normaler Entwicklungsschritt
Gemeint ist hier ein Entwicklungsschritt, in welchem
die Selbst-Selbstobjekt-Beziehung (Besetzung) aufgeben
werden
und das Kind die Mutter als eigenständiges Objekt,
außerhalb seines omnipotenten Selbst,
anerkennen kann.WINNICOTT : Objektverwendung II
Die Unterscheidung
von Objektbeziehung und Objektverwendung
Am Anfang steht die
OBJEKTBEZIEHUNG
In der Objektbeziehung sind SELBST und OBJEKT noch
wenig getrennt aber auch nicht mehr ganz verschmolzen.
Das Objekt wird mehr wahrgenommen, - „hat an
Bedeutung gewonnen…“ „Projektionsmechanismen und
Identifikationen sind wirksam geworden“; „…und das
Subjekt ist trotz der Weiterung im Gefühlsbereich (noch)
so weit geschwächt, dass es einen Teil seines Selbst im
Objekt wiederfindet. (Selbst-Selbstobjekt-Beziehung)WINNICOTT : Objektverwendung II
Realitätsprinzip
und fördernde Umweltfaktoren
„Das Kleinkind erschafft das Objekt,
aber das Objekt war bereits vorher da, um geschaffen
und besetzt zu werden“
„Die Entwicklung der Fähigkeit zur Objektverwendung ist
ein weiteres Beispiel dafür, dass der Reifungsprozess
von fördernden Umweltfaktoren abhängig ist.“
Der Reifungsprozess hin zur Fähigkeit der
Objektverwendung … „ ist Teil
des Übergangs zum Realitätsprinzip“.WINNICOTT : Objektverwendung
Das Subjekt muss das Objekt „zerstören“, um zur Objektverwendung zu gelangen
1.Das Subjekt steht in Beziehung zum Objekt
2.Das Subjekt zerstört das Objekt (das dadurch etwas
Äußeres wird)
3.Das Objekt überlebt die Zerstörung durch das Subjekt
4.Das Subjekt kann jetzt das Objekt verwenden.WINNICOTT : Objektverwendung
Liebe, Zerstörung und Überleben gehören zusammen – bei der Entstehung der Realität
„Das Subjekt sagt gewissermaßen zum Objekt: „Ich habe
dich zerstört“, und das Objekt
nimmt die Aussage an. Von nun an sagt das
Subjekt: „Hallo, Objekt!
Ich habe dich zerstört! Ich liebe dich! Du bist für
mich wertvoll, weil du überlebt hast, obwohl ich dich
zerstört habe! Obwohl ich dich liebe,
zerstöre ich dich in meiner (unbewußten)
Phantasie.“
Das Subjekt kann jetzt das Objekt, dass überlebt hat, verwenden.WINNICOTT : Objektverwendung
… weil das Objekt überlebt
Dies ist die unabdingbare Voraussetzung für den Entwicklungsweg
zur Objektverwendung. Destruktion und
Ärger wird so gewissermaßen zu einem Bestandteil des
Realitätsprinzips, und dies wederholt sich von nun an
immer wieder und überall,
Und auch in der Psychotherapie
Auch der Analytiker wird angegriffen und muss gleichwohl die
Erfahrung des Patienten sichern, dass Angriffe nicht unabdingbar
zur Vergeltung führen
Überleben
bedeutet in diesem Zusammenhang
„SICH-NICHT-RÄCHEN“WINNICOTT
Übergangsraum
Objektverwendung – Übergangsraum - Spielen
„Spiel (ist) in Wahrheit weder eine Sache der inneren psychischen
Realität, noch eine Sache der äußeren Realität (..)“
Wenn Spiel weder zur Inneren- noch zur Außenwelt gehört, wohin
gehört es dann?
Im Prozeß der Entstehung der Objektverwendung
entsteht der Raum, wo das Spiel beginnt.
„Spielen ereignet sich nicht im Innen (…) jedoch auch
nicht außenWINNICOTT
The Capicaty to be Alone
Am Anfang ist das Kind nur in Anwesenheit eines anderen
Menschen allein.
Die Fähigkeit des Allein-Seins in Anwesenheit definiert bereits
einen Übergangsraum, in dem Mutter und Kind auf eine bestimmte
Weise miteinander verbunden bleiben.WINNICOTT
Spielen
„Spielen ereignet sich nicht im Innen (…) jedoch auch
nicht außen“
„Um einen bestimmten Ort für das Spielen anzugeben,
habe ich einen potentiellen Raum zwischen Kleinkind und
Mutter postuliert“
Um zu kontrollieren, was außen ist, hat man zu handeln,
da es nicht ausreicht, zu denken oder zu wünschen.
Handeln braucht Zeit.
Spielen ist Handeln!D.W. WINNICOTT
Spielen II
• „In psychoanalytischen Schriften und Diskussionen ist
das Thema Spielen allzu eng mit Masturbation und
sinnlichem Erleben in Verbindung gesetzt worden.“
• „Ich habe herauszuarbeiten versucht, dass der
masturbatorische Anteil gerade dann fehlt, wenn das
Kind spielt.“D.W. WINNICOTT
Spielen III
• „Ich halte es übrigens für wichtig, einen Unterschied
zwischen der Bedeutung „Spiel“ und „Spielen“ zu
machen.“
• „Was sich über das Spielen bei Kindern sagen lässt,
trifft eigentlich genauso für Erwachsene zu…“D.W. WINNICOTT
Spielen IV
Wo findet Spielen statt?
„Für mich ist die Bedeutung des Spielens in ein neues
Licht gerückt, seit ich mich mit dem Thema der
Übergangsphänomene beschäftigt habe …“
•„Spielen ereignet sich an einer bestimmten Stelle in Raum und
Zeit. Es ereignet sich nicht im Innern (…) jedoch auch nicht
außen…“D.W. WINNICOTT - Theorie des Spiels „Es ist möglich, für den Entwicklungsprozess eine Folge von Objektbeziehungen anzunehmen und zu versuchen, diese mit dem Spiel in Beziehung zu setzen“: 1. „Das Kleinkind und das Objekt sind miteinander verschmolzen. Das Kind nimmt das Objekt subjektiv wahr. Die Mutter ist darauf ausgerichtet, anzubieten, was das Kind zu finden bereit ist“.
D.W. WINNICOTT - Theorie des Spiels II 2. „Das Objekt wird verworfen, wieder angenommen und objektiv wahrgenommen.“ • „Die Mutter befindet sich also in einem steten „Hin und Her“: einmal ist sie das, was das Kind anzunehmen in der Lage ist, ein andermal wartet sie, angenommen zu werden“.
D.W. WINNICOTT - Theorie des Spiels III • „Wenn die Mutter diese Rolle über eine längere Zeit übernehmen kann, ohne das Kind einzuengen, kann das Kind die Erfahrung machen, was magische Kontrolle ist (Omnipotenz)“.
D.W. WINNICOTT IV - Theorie des Spiels IV „In der Atmosphäre des Vertrauens, die entsteht, wenn die Mutter diese schwierige Aufgabe bewältigen kann (und die nicht entsteht, wenn sie dazu nicht in der Lage ist), fängt das Kleinkind an, Erfahrungen zu machen, die darauf beruhen, dass die Omnipotenz intrapsychischer Prozesse mit seiner Kontrolle der Wirklichkeit in Einklang steht. Aufgrund des Vertrauens zur Mutter entsteht dann ein „intermediärer Spielplatz“: • „Ich spreche hier von Spielplatz, weil an dieser Stelle das Spiel beginnt. Der Spielplatz ist ein potentieller Raum zwischen Mutter und Kleinkind.“
D.W. WINNICOTT IV - Theorie des Spiels V 3. „Die nächste Phase ist das Alleinsein in Gegenwart eines anderen.“ • „Beim Spielen geht das Kind jetzt davon aus, dass der Mensch, von dem es geliebt wird, und den es deshalb für zuverlässig hält, erreichbar ist und es auch bleibt, wenn es sich an ihn erinnert, selbst, wenn es ihn vergessen hatte. Im Erleben des Kindes spiegelt dieser Mensch, was im Spiel geschieht. „
D.W. WINNICOTT IV - Theorie des Spiels VI 4.“In dieser Phase kommt es zu einer Überschneidung von zwei Spielbereichen. Anfänglich ist die Mutter darum bemüht, sich an das Spielverhalten des Kindes anzupassen. Früher oder später bezieht sie jedoch ihr eigenes Spielverhalten mit ein.“ • „Sie wird dann feststellen, dass Kinder sich in ihren Fähigkeiten unterscheiden, fremde Ideen ertragen zu können, und darauf wohlwollend oder ablehnend reagieren. So wird der Weg für gemeinsames Spiel in einer Beziehung geebnet.“
D.W. WINNICOTT - Psychotherapie „Der Psychotherapeut beschäftigt sich speziell mit dem Reifungsprozess und der Beseitigung von Entwicklungshemmnissen“. • „Man sollte immer wieder daran erinnern, dass Spielen an sich schon Therapie ist; Kinder dazu zu bringen, dass sie spielen können, ist bereits Psychotherapie.“
D.W. WINNICOTT – Psychotherapie II „Die therapeutische Einstellung zum Spielen muss von der Erkenntnis ausgehen, dass Spielen stets beängstigend wirken kann.“ • „Spiele mit Spielregeln müssen als Teil eines Versuchs betrachtet werden, diesem beängstigenden Aspekt des Spielens zuvorzukommen…“
D.W. WINNICOTT IV – Psychotherapie III „Wenn Kinder spielen, müssen verantwortliche Personen dabei sein; dies bedeutet jedoch nicht, dass die verantwortliche Person ins Spiel eingreifen muss.“ • „Wenn derjenige, der das Spiel organisiert, leitend einbezogen werden muss, dann heißt das, dass das Kind oder die Kinder nicht schöpferisch spielen können.“
D.W. WINNICOTT IV – Psychotherapie IV „ Das kindliche Spielen enthält bereits alles (der Therapeut arbeitet jedoch nur mit dem Material, mit dem Inhalt des Spiels). Weil das Spiel bereits alles enthält, ist zu verstehen, dass umfassende Psychotherapie auch ohne Deutung durchgeführt werden kann.“
D.W. WINNICOTT IV – Psychotherapie V
Deutungen
„Nicht der Augenblick, in dem ich eine kluge Deutung
gebe ist der entscheidende.“
• „Vorzeitige Deutungen des Materials stellen eine Belehrung dar
und führen zur Anpassung.“
• „Als Folge von Deutungen, die außerhalb des
Überschneidungsbereiches des gemeinsamen Spiels von
Patient und Therapeut gegeben werden, entsteht Widerstand.“
• „Der entscheidende Augenblick (beim therapeutischen
Spielen) ist der, in dem das Kind in Verwunderung gerät.“D.W. WINNICOTT IV – Psychotherapie VI „Deutungen sind einfach nutzlos oder wirken stark verunsichernd, wenn der Patient die Fähigkeit zu spielen nicht hat.“ • „Kommt es aber zum gemeinsamen Spielen, so können Deutungen, die den üblichen psychoanalytischen Prinzipien entsprechen, die therapeutische Arbeit voranbringen“. • „Dieses Spielen muss spontan sein, nicht angepasst oder gefügig, wenn die Psychotherapie gelingen soll.“
Weitere Pioniere • Zulliger Dolto Spitz • V. Axline Bowlby • Tausch u. Tausch Dornes • Schmidtchen Lichtenberg • Schubenz u. Mitarbeiter Stern Fonagy und Target
Peter FONAGY und Mary TARGET: „Mentalisation und die sich ändernden Ziele der Psychoanalyse des Kindes“ oder: Wenn Kinder nicht spielen können oder: die therapeutische Arbeit mit strukturell gestörten Kindern
Sie können auch lesen