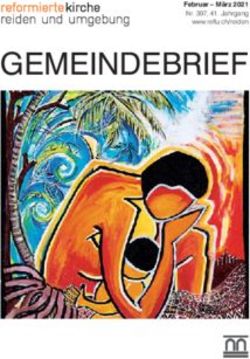Der Pendlerrechner 2.0 aus Arbeitnehmersicht - Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Proksch in SKW 23-24/2014, 1010 Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte Der Pendlerrechner 2.0 aus Arbeitnehmersicht Ermittlung von Entfernung bzw. Zeitdauer sowie Höhe von Pendlerpauschale und Pendlereuro VON MAG. FRANZ PROKSCH* In SWK-Heft 22/2014, 969 ff., wurden die wesentlichen Änderungen durch die Novelle der Pendler-VO vom 24. 6. 2014, BGBl. II Nr 154/2014, behandelt. In diesem Beitrag sollen spezielle Sachverhalte und Lösungsmöglichkeiten bei Ermittlung der Entfernung und/oder Zeitdauer bzw. bei der Eingabe im Pendlerrechner 2.0 aus dem Blickwinkel der Arbeitnehmer dargestellt werden. In Teil 3 soll auf jene Punkte eingegangen werden, die für die Arbeitgeber für die Berücksichtigung des Pendlerpauschales und des Pendlereuros im Rahmen der Lohnverrechnung relevant sind. 1. Überblick Der Pendlerrechner 2.0 wurde gleichzeitig mit der Kundmachung der Novelle der Pendler-VO am 24. 6. 2014, BGBl. II Nr 154/2014, auf der Homepage des BMF freigeschaltet und für Abfragen ab dem 25. 6. 2014 zur Verfügung gestellt. Mit dem Pendlerrechner 2.0 wurde auf die Kritik seitens der Interessenvertretungen an der Erstversion des Pendlerrechners vom Februar 2014 reagiert. Erklärtes Ziel des Pendlerrechners ist es, den Anspruchsberechtigen ein einfaches Instrument zur Ermittlung des Pendlerpauschales (PP) und des Pendlereuros (PE) zur Verfügung zu stellen. Er dient zur Ermittlung der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und zur Beurteilung, ob die Benützung eines Massenbeförderungsmittels (öffentliches Verkehrsmittel) zumutbar ist oder nicht. Der Pendlerrechner ermittelt auf Basis der eingegebenen Informationen die Höhe von PP und PE auf Grundlage des im Zeitpunkt der Eingabe aktuellen Wegenetzes und der aktuellen Fahrplandaten sowie nach den in der Pendler-VO festgelegten, für alle Steuerpflichtigen in gleicher Weise geltenden Kriterien. Gleichzeitig wird mit dem Ausdruck des vom Pendlerrechner ermittelten Ergebnisses ein amtliches Formular (L 34 EDV) erzeugt, das sowohl bei der Lohnverrechnung durch den Arbeitgeber als auch für die Geltendmachung im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung grundsätzlich verbindlich ist. Ein Gegenbeweis ist nur im
Rahmen der Veranlagung und nur insoweit zulässig, als er sich nicht gegen jene
Verhältnisse richtet, die dem Pendlerrechner aufgrund einer abstrakten Betrachtung des
Individualverkehrs hinterlegt sind und auf einer typisierenden Betrachtung beruhen (z.
B. die hinterlegte Durchschnittsgeschwindigkeit).
2. Der Pendlerrechner 2.0 im Detail
Der Pendlerrechner ist eine webbasierte Anwendung, die auf Adressdatenbanken sowie
Datenbanken der verschiedenen Massenverkehrsmittel und Routinganbieter
zurückgreift, um eine objektiv optimale Verbindung zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte zu finden. Hierbei sind verschiedene objektive Parameter, wie z. B.
durchschnittliche Fahr- und Gehgeschwindigkeiten, hinterlegt, die auf
durchschnittlichen Erfahrungswerten beruhen. Das Pendlerpauschale ist – wie der Name
schon ausdrückt – eine pauschale steuerliche Förderung von Menschen, die längere
Wege zum Arbeitsplatz zurücklegen müssen. Dem Charakter eines Pauschales
entsprechend, können bei einer solchen abstrakten Betrachtung konkrete persönliche
(z. B. Umwege über Kindergarten oder Schule) oder zeitliche (z. B. Stau, Straßensperren)
Umstände keine Berücksichtigung finden.
Die folgenden wesentlichen Basisdaten sind im Pendlerrechner einzutragen:
Wohnadresse,
Adresse der Arbeitsstätte,
Datum der Berechnung,
Arbeitsbeginn,
Arbeitsende,
monatliche Anzahl der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte,
Vorliegen der Unzumutbarkeit der Benützung eines öffentlichen
Massenverkehrsmittels wegen eingeschränkter Mobilität und
ob der Arbeitgeber für die Zurücklegung dieser Strecke ein Kfz zur Verfügung
gestellt hat.2.1. Die Erfassung der Basisdaten 2.1.1. Erfassung der Adressen Die Eingabe der Wohn- und der Arbeitsstättenadresse erfolgt grundsätzlich mit der genauen Anschrift (Postleitzahl oder Ort sowie Straßenbezeichnung und Hausnummer). Während der Eingabe wird ein Dropdown-Menü geöffnet, aus dem die genaue Anschrift ausgewählt werden kann.
2.1.1.1. Adresse wird nicht angezeigt Wird die richtige inländische Anschrift (z. B. die korrekte Hausnummer) nicht aufgelistet, ist diese offensichtlich in den offiziellen Adressdatenbanken (noch) nicht erfasst. Hilfsweise kann z. B. die Adresse des Nachbargebäudes ausgewählt werden oder der Ort, an dem sich die Wohnung oder die Arbeitsstätte befindet, mithilfe der „Auswahl aus Karte“ eingetragen werden. Hier kann mit der linken Maustaste eine Fahne an der exakten Position, an der das Straßennetz an das Grundstückstück, auf dem sich das gesuchte Gebäude (Wohnhaus, Arbeitsstätte) befindet, gesetzt werden. Wird „Auswahl aus Karte“ genutzt, ist zwingend eine Begründung erforderlich. Eine Begründung dafür könnte z. B. lauten: „Adresse nicht erfasst“ oder „Baustelle, noch keine Anschrift vergeben“. Bei Verwendung dieser Funktionalität wird empfohlen, eine hohe Zoomstufe zu wählen, damit die Fahne auch an den exakten Punkt der Karte gesetzt werden kann. Für ein korrektes Ergebnis ist die Fahne beim Eingang bzw. bei der Zufahrt direkt an einer Straße zu setzen. Ausländische Adressen sind im Pendlerrechner nicht erfasst. Wird vom Ausland ins Inland oder umgekehrt gependelt, liefert der Pendlerrechner kein brauchbares Ergebnis. Für die Geltendmachung von PP und PE ist das Formular L 33 zu verwenden. Dasselbe gilt, wenn ein Ort nur über das Ausland zu erreichen ist, wie z. B. eine Arbeitsstätte an einem Autobahngrenzübergang, die nur über die Fahrbahn in Richtung Österreich zu erreichen ist und außer dieser Zufahrt keinen Anschluss an das öffentliche österreichische Straßennetz hat (z. B. Hotel und Tankstelle „Servus Österreich“ am Autobahngrenzübergang Walserberg). 2.1.1.2. Mehrere Gebäude und Anschriften am Firmengelände Befindet sich das Unternehmen des Arbeitgebers auf einem größeren Firmengelände, sind mitunter die einzelnen Betriebsgebäude gesondert in den offiziellen Adressdatenbanken erfasst und werden auch bei der Eingabe im Pendlerrechner aufgelistet (z. B. 8041 Liebenau [Graz], Liebenauer Hauptstraße 317). Einen Ansatz für die Lösung der Frage, welche Adresse einzutragen ist, liefern die LStR 2002. Das BMF definiert in den LStR 2002, Rz 293, die Arbeitsstätte als „(…) ein Büro, eine Betriebsstätte, ein Werksgelände, ein Lager und Ähnliches“. Daran kann abgeleitet
werden, dass für die Berechnung des Pendlerpauschales und des Pendlereuros der Haupteingang, an dem die Arbeitnehmer das Firmengelände überwiegend betreten bzw. befahren, maßgeblich ist. 2.1.1.3. Es bestehen mehrere Wohnanschriften Bestehen mehrere Wohnsitze, kann als Wohnanschrift der Familienwohnsitz oder die Adresse der Wohnung angegeben werden, die der Arbeitsstätte am nächsten gelegen ist (§ 16 Abs 1 Z 6 lit. f EStG 1988 i. V. m. § 4 Pendler-VO). Voraussetzung ist, dass die entsprechende Wegstrecke auch tatsächlich zurückgelegt wird (vgl. LStR 2002, Rz 259). Liegt kein Familienwohnsitz i. S. d. § 4 Pendler-VO vor, ist stets der zur Arbeitsstätte nächstgelegene Wohnsitz maßgeblich. Wochenpendler, welche die Voraussetzungen der doppelten Haushaltsführung erfüllen (LStR 2002, Rz 341 ff.), können für den Kalendermonat die tatsächlichen Kosten der Fahrten zum Familienwohnsitz berücksichtigen. Werden Fahrtkosten als Familienheimfahrten (LStR 2002, Rz 354 ff.) berücksichtigt, kann kein Pendlerpauschale für die Wegstrecke vom Familienwohnsitz zur Arbeitsstätte berücksichtigt werden. Gegebenenfalls steht ein Pendlerpauschale für die Entfernung von dem der Arbeitsstätte nächstgelegenen Wohnsitz zur Arbeitsstätte zu. Alternativ kann, bei Zurücklegen der entsprechenden Wegstrecke, anstatt der Familienheimfahrten ein aliquotes Pendlerpauschale für die Wegstrecke vom Familienwohnsitz zur Arbeitsstätte berücksichtigt werden. 2.1.1.4. Die Beschäftigung erfolgt für einen Arbeitgeber an mehreren Arbeitsstätten mit verschiedenen Anschriften Maßgeblich für die Ermittlung von PP und PE ist die Hauptarbeitsstätte. Das ist jene Arbeitsstätte, an welcher der Arbeitnehmer langfristig (in der Regel im Kalenderjahr) im Durchschnitt am häufigsten tätig wird. Ist die Hauptarbeitsstätte nicht eindeutig zu ermitteln, weil der Arbeitnehmer gleich oft an mehreren Arbeitsstätten tätig wird, gilt jene Arbeitsstätte als Hauptarbeitsstätte, die im Dienstvertrag als solche vereinbart ist (LStR 2002, Rz 291). Davon zu unterscheiden ist der Fall der vorübergehenden Dienstzuteilung oder der Versetzung auf Dauer. In diesen Fällen liegen nämlich nicht mehrere Arbeitsstätten vor,
sondern die Arbeitsstätte hat gewechselt; hier sind mit dem Pendlerrechner die Ansprüche auf PP und PE neu zu ermitteln, und dem Arbeitgeber ist ein neuer Ausdruck des Ergebnisses des Pendlerrechners (L 34 EDV) zu übergeben (vgl. LStR 2002, Rz 292). Änderungen der Verhältnisse für die Berücksichtigung dieser Pauschbeträge und Absetzbeträge muss der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber innerhalb eines Monats mittels neuen Ausdrucks des Ergebnisses des Pendlerrechners (L 34 EDV) melden (vgl. § 16 Abs 1 Z 6 lit. g EStG 1988; LStR 2002, Rz 273). 2.1.2. Erfassung des Datums für die Berechnung, von Arbeitsbeginn und -ende 2.1.2.1. Datum für die Berechnung Als Datum für die Berechnung ist ein typischer Arbeitstag einzutragen. Die Eingabe des Datums eines Tages, der in der Regel kein Arbeitstag ist, ist unzulässig, und der Arbeitgeber darf den Ausdruck aus dem Pendlerrechner mit einem solchen Tag auch nicht berücksichtigen. 2.1.2.2. Arbeitsbeginn und -ende Wie beim Datum für die Berechnung gilt auch für Arbeitsbeginn und -ende, dass repräsentative Uhrzeiten anzugeben sind. Das ist bei festen Arbeitszeiten der im Dienstvertrag festgelegte Beginn bzw. das festlegte Arbeitsende. Diese Zeiten sind auch maßgebend, wenn die zeitlichen Umstände der Arbeitserbringung im Kalendermonat im Wesentlichen gleich sind.
Beispiel Im Dienstvertrag wurden als Arbeitszeiten Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr vereinbart. Da die Arbeitsleistung überwiegend zwischen 8:00 Uhr und 16:30 Uhr zu erbringen ist und die zeitlichen Umstände im Kalendermonat im Wesentlichen gleich sind, ist als Arbeitsbeginn bzw. -ende 8:00 Uhr bzw. 16:30 Uhr einzutragen. Sind die zeitlichen Umstände nicht im Wesentlichen gleich, sind jene Umstände maßgebend, die im Kalendermonat überwiegen. Beispiel Als Arbeitszeit wurde vereinbart: Montag bis Mittwoch von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Donnerstag und Freitag von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Da die zeitlichen Umstände von Montag bis Mittwoch überwiegen, ist als Arbeitsbeginn bzw. -ende 8:00 Uhr bzw. 12:00 Uhr einzutragen. Bei flexiblen Arbeitszeitmodellen (z. B. Gleitzeit) ist als Arbeitsbeginn bzw. -ende ein typischer Arbeitstag unter Berücksichtigung der Normalarbeitszeit, aber auch regelmäßiger Mehrarbeit einzutragen (vgl. LStR 2002, Rz 257). Beispiel Die Gleitzeitvereinbarung lautet wie folgt: Gleitzeitrahmen von 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Blockzeit von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr. A beginnt seine Tätigkeit regelmäßig um 6:30 Uhr und beendet seine Arbeitszeit meist um 15:00. B kommt regelmäßig um 8:45 Uhr zur Arbeit und verlässt die Arbeitsstätte an den meisten Tagen um 17:00 Uhr. A trägt in den Pendlerrechner 6:30 Uhr bzw. 15:00 Uhr und B trägt 8:45 Uhr bzw. 17:00 Uhr ein. Bei Schichtdienst ist auf die überwiegend (z. B. im Kalenderjahr, Schichtturnus) vorliegenden Verhältnisse abzustellen und daraus ein repräsentativer Arbeitsbeginn bzw. ein repräsentatives Arbeitsende abzuleiten. Ist in diesem Zeitraum kein Überwiegen feststellbar, bestehen keine Bedenken, analog zu § 2 Abs 4 der Pendler-VO die für den Arbeitnehmer günstigere Variante zu berücksichtigen (vgl. LStR 2002, Rz 262).
2.1.3. Anzahl der Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte im Kalendermonat
Es ist lediglich die entsprechende Anzahl der Fahrten anzugeben. Ist diese Anzahl in
jedem Kalendermonat unterschiedlich, muss für jeden Kalendermonat ein eigenes
Formular L 34 EDV beim Arbeitgeber abgegeben oder PP und PE müssen im Rahmen
der Veranlagung beantragt werden.
2.1.4. Vorliegen von Unzumutbarkeit wegen eingeschränkter Mobilität
Die Benützung eines Massenverkehrsmittels ist jedenfalls unzumutbar, wenn
der Steuerpflichtige über einen gültigen Ausweis gemäß § 29b StVO 1960 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr 39/2013 verfügt oder
die Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauernder
Gesundheitsschädigung oder wegen Blindheit für den Steuerpflichtigen im
Behindertenpass (§ 42 Abs 1 Bundesbehindertengesetz in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr 150/2002) eingetragen ist.
Die Auswahl ist mit „nein“ vorausgefüllt und muss bei Vorliegen der angeführten
Voraussetzungen geändert werden.2.1.5. Hat der Arbeitgeber ein Kfz für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zur Verfügung gestellt? Hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Kfz (auch) für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zur Verfügung gestellt, besteht weder ein Anspruch auf ein PP (§ 16 Abs 1 Z 6 lit. b EStG 1988) noch auf einen PE (§ 33 Abs 5 Z 4 EStG 1988). Auch hier muss der Arbeitnehmer bewusst erklären, ob ein arbeitgebereigenes Kfz zur Verfügung steht oder nicht. 2.2 Abschluss der Eingaben und Ausdruck Mit der Schaltfläche „Berechnen“ wird die Ermittlung des zustehenden PP und PE gest- artet. Das Ergebnis wird am Bildschirm angezeigt und kann ausgedruckt werden. Der Ausdruck (L 34 EDV) gilt als amtlicher Vordruck gemäß § 16 Abs 1 Z 6 lit. g EStG 1988. Der Ausdruck ist dem Arbeitgeber zur Berücksichtigung von PP und PE im Zuge der Lohnverrechnung abzugeben. Werden PP und PE im Rahmen der Veranlagung geltend gemacht, ist der Ausdruck vom Arbeitnehmer aufzubewahren und auf Verlangen dem Finanzamt vorzuweisen. 2.2.1. Der Pendlerrechner liefert kein Ergebnis Ein technischer Ausfall kann viele Gründe haben, die sowohl im Bereich des Bundesrechenzentrums, des jeweiligen Anwenders als auch im Bereich des Providers bzw. der Datenleitungen liegen können. Sind die Eingaben plausibel und liefert der Pendlerrechner kein oder ein offensichtlich falsches Ergebnis (z. B. in einem Ort werden die dort tatsächlich vorhandenen Massenverkehrsmittel nicht berücksichtigt), ist die Eingabe zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. Liefert der der Pendlerrechner dauerhaft (über mehrere Wochen) kein Ergebnis (Timeout, Fehlermeldung wegen Zeitüberschreitung), ist von dieser Fehlermeldung ein Ausdruck zu erstellen und für die Inanspruchnahme des Pendlerpauschales und des Pendlereuro der für derartige Fälle aufgelegte amtliche Vordruck (L 33) zu verwenden.
Das Formular L 33 ist mit beigeschlossenem Ausdruck der Fehlermeldung des Pendlerrechners dem Arbeitgeber zu übergeben. Der Ausdruck dient als Nachweis, dass der Pendlerrechner in diesem Fall kein Ergebnis liefern konnte. 2.2.2. Das Ergebnis des Pendlerrechners ist falsch Der Gegenbeweis ist dann zulässig, wenn der Nachweis erbracht werden kann, dass der Pendlerrechner bei der Berechnung der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder bei der Beurteilung, ob ein öffentliches Verkehrsmittel unzumutbar ist oder nicht, unrichtige Verhältnisse berücksichtigt. Die Nachweismöglichkeit erstreckt sich jedoch nicht auf jene pauschalen Verhältnisse, die dem Pendlerrechner aufgrund einer abstrakten Betrachtung des Individualverkehrs hinterlegt sind und auf einer typisierenden Betrachtung beruhen (z. B. die hinterlegte Durchschnitts- geschwindigkeit). Dieser Gegenbeweis kann aber nur im Rahmen der Veranlagung erfolgen, nicht hingegen bei Berücksichtigung von PP und PE durch den Arbeitgeber. Dies könnte z. B. der Fall sein, wenn irrtümlich ein falscher Fahrplan des öffentlichen Verkehrsmittels, ein nicht zur Verfügung stehendes öffentliches Verkehrsmittel oder eine Fahrtstrecke über eine nicht öffentlich zugängliche Privatstraße bei der Abfrage mit dem Pendlerrechner berücksichtigt wurde. Kein falsches Ergebnis liegt vor, wenn die tatsächliche Fahrtroute nicht jener entspricht, die der Pendlerrechner der Ermittlung von PP und PE zugrunde gelegt hat. Der Pendlerrechner sucht mitunter aus einer Vielzahl von Möglichkeiten eine optimale Kombination zwischen Individualverkehr und öffentlichem Verkehr. Dieses Ergebnis muss nicht den Verhältnissen entsprechen, wie der Arbeitnehmer tatsächlich den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zurücklegt. Auf den Punkt gebracht Der Pendlerrechner 2.0 soll zur einfachen Ermittlung von Pendlerpauschale und Pendlereuro dienen. Auf Basis der vom Arbeitnehmer eingegebenen Informationen ermittelt er die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, beantwortet die Frage nach der Zumutbarkeit der Benützung eines Massenverkehrsmittels und berechnet
schließlich die Höhe von Pendlerpauschale und Pendlereuro. Dieses Ergebnis ist
grundsätzlich verbindlich; ein Gegenbeweis kann nur im Rahmen der Veranlagung
angetreten werden. Ein solcher Gegenbeweis erstreckt sich aber nicht auf pauschale
Verhältnisse, wie z. B. die Durchschnittsgeschwindigkeit, die dem Pendlerrechner
hinterlegt sind.
*
Mag. Franz Proksch ist Mitarbeiter im bundesweiten Fachbereich Lohnsteuer des BMF.
Proksch in SWK 23-24/2014, 1010Sie können auch lesen