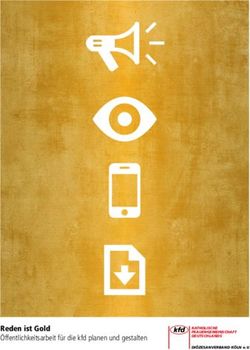Die Bibliotheken, die Welt der Bücher und die heutigen Trends: Haben traditionelle bibliothekarische Angebote überhaupt noch eine Zukunft?
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bibliotheksdienst 2022; 56(3–4): 227–239
Urs Bisig
Die Bibliotheken, die Welt der Bücher und
die heutigen Trends: Haben traditionelle
bibliothekarische Angebote überhaupt noch
eine Zukunft?
Libraries, the World of Books, Current
Trends – What Future is There for Traditional
Library Services?
https://doi.org/10.1515/bd-2022-0035
Zusammenfassung: Mit der fortschreitenden Digitalisierung wächst der Informa-
tionssektor immer schneller, die Orientierung darin wird immer schwieriger und
anspruchsvoller, und der Komfort für die druckaffinen Leser nimmt ständig ab.
Im Beitrag wird gezeigt, wie das Bibliothekswesen mithelfen kann, diese Entwick-
lung besser zu bewältigen. Der Autor ist der Meinung, das Ziel der Bibliotheken
sollte nicht nur sein, möglichst bald Teil der E-Welt zu werden, sondern vor allem
auch, diese intelligent zu ergänzen.
Schlüsselwörter: Bibliothek, Digitalisierung, E-First-Politik, Kritik
Abstract: Ongoing digitization sees the information sector growing faster and
faster, the lack of orientation increases, and users interested in print products
are more and more inconvenienced. The paper explores ways in which the library
system could better cope with these developments. It is the author’s belief that
the purpose of libraries is not just to quickly become part of the ever-expanding
e-world, but to complement this world in intelligent ways.
Keywords: Library, digitization, e-first policy, criticism
Urs Bisig: urs.bi@bluewin.ch
Open Access. © 2022 Urs Bisig, publiziert von De Gruyter. Dieses Werk ist
lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.228 Urs Bisig
1 Fragestellung
Wollten Sie auch schon mal ein Buch ausleihen und dann gab es das gesuchte
Werk in Ihrer Bibliothek „nur“ in E-Form und Sie haben sich darüber geärgert?
Oder war es bei Ihnen gerade umgekehrt: Sie bekamen ein gedrucktes Buch,
hätten aber die E-Form – aus welchen Gründen auch immer – bevorzugt?
Das Erstere kommt immer häufiger vor, denn die Digitalisierung durchdringt
die Bibliothekswelt immer mehr. Seit einiger Zeit herrscht eine eigentliche Digi-
talisierungseuphorie: E-Medien sind in, P-Medien (Printmedien) out. Das Ideal
vieler bibliothekarischer Entscheidungsträger scheint es zu sein, möglichst bald
möglichst viel digital im Netz anbieten zu können, wobei gedruckte Werke höchs-
tens noch als Ergänzung vorgesehen sind.1 Wer die Begeisterung für das Digitale
nicht teilt ist von gestern, nein von vorgestern. Diese Bibliothekare wollen nicht
mehr viel mit Büchern zu tun haben. Selbst das Wort „Buch“ ist schon verdächtig
und wird von einigen Bibliotheksverantwortlichen nur noch ungern verwendet.
So schaffte es beispielsweise die Zentralbibliothek Zürich in ihrem letzten Flyer
„WissensWelt“, in dem sie ihre verschiedenen Dienstleistungen anpries, das Wort
„Buch“ kein einziges Mal zu erwähnen.2
Für die einseitige Bevorzugung des Digitalen bei der an und für sich begrü-
ßenswerten Annäherung der Bibliotheken an die E-Welt gibt es u. a. folgende
Gründe:
– Im Gegensatz zu früher, als die historischen Wissenschaften die Biblio-
thekswelt prägten, sind es heute die empirischen Wissenschaften (STM-Be-
reich und Teile der Sozialwissenschaften), welche das Bibliothekswesen
stark beeinflussen. Für diese Fächer ist Schnelligkeit ein ausschlaggeben-
der Faktor, weshalb in diesem Bereich die E-Medien unverzichtbar sind. Die
empirischen Wissenschaften gelten auch als die Disziplinen, deren Nutzen
für die moderne Gesellschaft und Wirtschaft leicht nachvollzogen werden
kann, weshalb deren Leitbildfunktion auch im Bibliothekswesen vielen Ver-
antwortlichen als gerechtfertigt erscheint.
– Der (fast) totale Medienwandel in vielen Wissenschaften erleichtert auch
die Suche von zahlreichen Entscheidungsträgern nach einem zeitgemäßen
Image für ihre Institution: Mit viel Elektronik und möglichst wenig Papier
hoffen sie, ihre Bibliothek an den Mainstream andocken zu können und
damit das Ansehen ihres Hauses in der Öffentlichkeit zu steigern. Keiner/
1 Z. B. Bibliotheken: Weg damit! Interview von Michael Furger mit Rafael Ball. In: NZZ am Sonn-
tag vom 07.02.2016, S. 25, https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/bibliotheken-und-buecher-weg-
damit-meint-rafael-ball-ld.147683 [Zugriff: 14.02.2022].
2 WissensWelt. Die Zentralbibliothek Zürich entdecken. Zürich.Die Bibliotheken, die Welt der Bücher und die heutigen Trends 229
keine von ihnen möchte die allerneuesten Trends verpassen und als altmo-
disch gelten. Die Kritik von einigen „ewiggestrigen“ Bücherfreunden3 ist für
sie weit weniger gravierend als das Bild in der Öffentlichkeit von Bibliotheken
als antiquierte, angestaubte Bücherlager.
– Schließlich seien noch die global tätigen Großverlage und Tech-Giganten
erwähnt, die mit ihren digitalen Angeboten versuchen, die Informationswelt
immer mehr zu dominieren und die Bibliotheken an sich zu binden. Ihnen ist
es nicht gleichgültig, wie diese den Medienwandel angehen. Je verunsicherter
die Bibliotheken sind, desto eher wird es den internationalen Großkonzernen
gelingen, diese von sich abhängig zu machen.
Leidtragende in diesem Powerplay sind neben den druckaffinen Nutzerinnen und
Nutzern vor allem die kleinen und mittelgroßen Verlage, für die nicht mehr so
viele finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, nachdem viel Geld für all die
E-Book-Pakete und anderen Spezialangebote der Großen ausgegeben worden ist.
Heutzutage werden die Bibliotheken mit solchen Paketen regelrecht „geflutet“
und ihr Literaturangebot wird dadurch – und auch wegen der zunehmenden Aus-
lagerung (von Teilen) der Erwerbung – immer uniformer. „Die Ware gleicht sich
von Kiel bis Konstanz“4 und darüber hinaus, wobei der Anteil des Gedruckten an
den neu zugänglichen Texten (fast) überall merklich zurückgeht.
Eine weitere Folge dieser Entwicklung ist, dass in unserem Bereich heute
auch in den allgemeinen Fachzeitschriften, nicht nur in den spezialisierten, vielen
Fachbüchern und an den Tagungen in der Regel die Digitalisierung im Zentrum
steht. Über klassische Themen wie Kataloge und gedruckte Bücher wird nicht
mehr so häufig geschrieben und gesprochen, und wenn, dann manchmal gar
abwertend. Ein Außenstehender könnte meinen, es gäbe für uns keine anderen
Probleme mehr.
Deshalb stellt sich schon die Frage: Ist diese Entwicklung gerechtfertigt?
Haben die traditionellen bibliothekarischen Angebote ausgespielt und wirklich
keine Zukunft mehr – oder vielleicht doch?
3 Vgl. z. B. Hagner, Michael: Zur Sache des Buches. 2. überarb. Aufl. Göttingen 2015 oder
Yogeshwar, Ranga: Original oder digital. Schriftliches Kulturgut ist ein Schatz und eine Ver-
pflichtung. In: BuB 67 (2015), S. 60–64, oder Knoche, Michael: Die Idee der Bibliothek und ihre
Zukunft. Göttingen 2018.
4 Knoche (Anm. 3) S. 27.230 Urs Bisig
2 A
uch Bücher sind und bleiben wichtig
Bevor wir zu den eigentlichen Aufgaben der Bibliotheken kommen, vergegenwär-
tigen wir uns die heutige Lage im Informationssektor: Das Info-Meer wächst und
wächst und zwar immer schneller; es wird immer unübersichtlicher und komple-
xer. Deshalb wird es für viele Menschen immer schwieriger und anspruchsvoller,
sich darin kompetent – und nicht nur irgendwie – zurechtzufinden.
Um den Überblick zu bewahren, sollten wir uns die klassische Grobeinteilung
der Fachtexte in Erinnerung rufen. Die einfachste Unterteilung ist diejenige nach
der Länge der Texte. Dabei können wir folgende drei Ebenen unterscheiden:
Kürzesttexte Kurzinformationen, gefunden mithilfe einer einfachen Suche im
Internet, bzw. aus Nachschlagewerken und Enzyklopädien, heute
am bekanntesten die Wikipedia; für Schnellinformationen zu
einem Thema.
Kurztexte Aufsätze: Studien und Essays; geeignet für die Mitteilung von
neuen Erkenntnissen und/oder die aktuelle Diskussion.
Langtexte Bücher: Monografien und redigierte Textsammlungen; gerne
benutzt für die Orientierung in einem Gebiet und/oder für die
Erörterung eines Problems.
Eine solche Einteilung hat natürlich immer auch etwas Willkürliches, denn die
Textarten sind nicht starr, sondern fließen ineinander über. Dennoch kann die
Unterteilung mithelfen, das Informationschaos besser in den Griff zu bekommen.
Alle drei Ebenen sind wichtig und haben ihre spezifische Aufgabe. Im Folgenden
soll der Fokus vor allem auf die Langtexte gelegt werden, für deren Zugänglichkeit
und Auffindbarkeit traditionellerweise die Bibliotheken die Hauptverantwortung
tragen.
Die Ebene der Langtexte ist zentral und besonders wichtig für die vertiefte
Auseinandersetzung mit einem Thema. Das Buch bietet in der Regel einen guten
Überblick über einen Gegenstand und/oder beschäftigt sich ausführlich mit einer
Frage, bzw. einem Fragekomplex in einem mehr oder weniger großen Bereich,
wobei das auf ganz unterschiedlichem Anspruchsniveau sein kann. Auch die
Glaubwürdigkeit einer Publikation ist von Bedeutung, die u. a. von der Seriosität
des Verbreiters einer Information abhängt. Diese Kriterien werden immer wichti-
ger in Zeiten der zunehmenden Unübersichtlichkeit und der Fake News.
Bei den Informationsträgern lassen sich zurzeit zwei widersprüchliche Ten-
denzen beobachten: Einerseits eine rasante Entwicklung der E-Welt, anderseits
ein zähes Überleben der gedruckten Werke. Die P-Medien sind nämlich, vor allem
im Bereich der Langtexte, noch lange nicht tot, sondern sie leben – wenn auch in
etwas reduziertem Umfang – munter weiter. Der Medienwandel findet zwar statt,Die Bibliotheken, die Welt der Bücher und die heutigen Trends 231
aber nicht total wie letztes Mal vor über 500 Jahren beim Übergang vom handge-
schriebenen zum gedruckten Buch, sondern er ist eher vergleichbar mit dem Auf-
kommen der Autos, die zwar der Eisenbahn immer größere Konkurrenz machten,
diese jedoch (mindestens bei uns in Mitteleuropa) nie vollständig verdrängt
und ersetzt haben; im Zusammenhang mit dem steigenden Umweltbewusstsein
kommt es heute gar zu einem eigentlichen Revival der Bahnen.
Ein Grund für die Beliebtheit von gedruckten Werken trotz der E-Welt und
deren Möglichkeiten ist der größere Lesekomfort, den sie besonders beim ver-
tieften Lesen bieten und den viele zu schätzen wissen. Ebenso mögen es zahl-
reiche Menschen, einmal nicht ständig auf einen Bildschirm schauen zu müssen,
sondern zur Abwechslung einen Text auch mal physisch zu erleben. Und dann
spricht die größere Vielfalt des Gedruckten die Leute an: Printmedien haben eine
eigene Individualität, während die meisten Veröffentlichungen auf dem Bild-
schirm recht monoton daherkommen. Alles Gründe, weshalb selbst an der EDV
interessierte Leserinnen und Leser ab und zu Gedrucktes vorziehen, was sich u. a.
im breiten Printangebot im IT-Bereich zeigt. Sogar P-Books über E-Books sind
keine Seltenheit.5
Ein weitere Ursache für das hartnäckige Überleben der analogen Texte ist
die Aufwertung des Buches durch die digitalen Medien, „denn wenn in Zukunft
etwas überhaupt gedruckt wird, so bedeutet das doch, dass es besonders wichtig
sein muss.“6 Dies ist auch ein Grund, weshalb viele Autorinnen und Autoren von
Langtexten ihr Werk nach der großen Arbeit nicht auf der gleichen Stufe sehen
möchten wie die Texte im Internet. Das gedruckte Buch gilt nämlich in breiten
Kreisen immer noch als das Premiumprodukt der Informationswelt. Printmedien
werden uns deshalb noch lange begleiten.
Den Durchschnittsleser, die Durchschnittsleserin gibt es jedoch nicht, die
Nutzertypen sind sehr verschieden: Es gibt Menschen, die mehr technikaffin und
andere, die mehr druckaffin sind. Für viele kommt es auch auf die Länge der Texte
an; Langtextleser bevorzugen häufig P-Medien, Kurztextleser E-Medien.7 Am ver-
breitetsten sind wahrscheinlich die „Switcher“, also Menschen, die sich in beiden
Welten mehr oder weniger wohl fühlen. Ihr präferiertes Medium ist abhängig vom
5 Z. B. Ward, Suzanne M.; Freeman, Robert S.; Nixon, Judith M. (eds.): Academic e-books.
Publishers, librarians and users. West Lafayette (IN) 2016, oder Graf, Dorothee; Fadeeva, Yuliya;
Falkenstein-Feldhoff, Katrin (Hrsg.): Bücher im Open Access. Ein Zukunftsmodell für die Geistes-
und Sozialwissenschaften? Opladen 2020.
6 Aussage von Katharina Blarer zitiert in Wirz, Tanja: Ein Buch, ein Thema. In: Journal. Die
Zeitung der Universität Zürich 41 (2011/Februar) 1, S. 2.
7 Vgl. z. B. die Nutzer*innenbefragung 2020 der Deutschen Nationalbibliothek – Ergebnisbe-
richt, https://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/Benutzung/nutzerumfrage2020Ergebns
ibericht.pdf? S. 4, Punkt 4. [Zugriff: 14.02.2022].232 Urs Bisig
Problem, bzw. der Fragestellung. Ein gutes Beispiel dafür ist Hagner, der sich in
seinem Werk „Zur Sache des Buches“ vehement für das gedruckte Buch einsetzt,
dessen Anmerkungsapparat jedoch zahlreiche Hinweise auf Netzpublikationen
enthält.8
Und als letztes sei noch auf die beiden Wissenswelten hingewiesen, auf den
STM-Bereich (und die empirischen Sozialwissenschaften) einerseits und auf die
Geistes- und Kulturwissenschaften anderseits, die sich in ihrem Denken und in
ihrer Methodik grundlegend unterscheiden.9 Auch das Publikationsverhalten
ist in beiden Bereichen verschieden: Während empirisch tätige Wissenschaftler
möglichst viele Kurztexte in angesehenen Zeitschriften zu veröffentlichen suchen,
möchten Geistes- und Kulturwissenschaftler ihre Erkenntnisse traditionellerweise
gerne auch einmal in einem Buch über einen renommierten Verlag verbreiten. Ein
Grund dafür ist, dass für diese Fachleute oft auch der Kontext wichtig ist und nicht
nur die allerneuesten Forschungsergebnisse in einem klar abgrenzbaren, engen
Bereich. Auch ist die Halbwertszeit ihres Wissens, bzw. ihrer Überlegungen in der
Regel deutlich länger als die Erkenntnisse im Bereich ihrer empirisch arbeitenden
Kolleginnen und Kollegen. Außerdem möchten die meisten Buchautorinnen und
-autoren die Lesenden auch sprachlich ansprechen und nicht nur schnell Fakten
mitteilen. Schließlich gibt es hier vermehrt noch die „Konkurrenz“ von Persön-
lichkeiten außerhalb der akademischen Welt, die ihre (zum Teil originellen) Über-
legungen, wenn möglich, (auch) in gedruckter Form publizieren.
Deshalb kann man sich schon fragen: Wie sollen die Bibliotheken auf diese
widersprüchliche Entwicklung reagieren? Sollen sie sich möglichst schnell und
umfassend in die E-Welt integrieren oder im Gegenteil versuchen, diese auch zu
ergänzen?
3 D
ie Bibliotheken, das Buch und andere
Herausforderungen
Auch wenn die Bibliotheken heute nicht mehr die alleinigen Stützen der Informa-
tionswelt sind, so können sie sehr wohl ein Big Player dort bleiben, wenn es ihnen
gelingt, den Nutzerinnen und Nutzern einen Mehrwert zu bieten. Besonders stark
sind die Bibliotheken im Bereich der Orientierungshilfen und des Komforts, wo
8 Hagner (Anm. 3) S. 251–280.
9 Unter vielen anderen vgl. Snow, Charles P.: Die zwei Kulturen. Literarische und naturwissen-
schaftliche Intelligenz. Stuttgart 1967.Die Bibliotheken, die Welt der Bücher und die heutigen Trends 233
sie den Usern verschiedene Erleichterungen anbieten können. Aus der Sicht der
Tradition lassen sich acht Hauptaufgaben unterscheiden:
3.1 A
ufgaben im Bereich der Orientierung
1. Eine wichtige Aufgabe von Bibliotheken ist ihre Rolle als Orientierungshelfer.
Wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben, sind für die Orientierung in der
Wissenswelt, vor allem für die vertiefte Orientierung, Langtexte (Bücher) der
Königsweg – für Schnellinformationen reicht in der Regel eine kurze Suche
im Internet, oft genügt die Wikipedia. Auch sind Bücher in den Geistes- und
Kulturwissenschaften – also in den Orientierungswissenschaften – weiterhin
von großer Bedeutung, wenn auch ihre Stellung dort nicht mehr so zentral ist
wie auch schon.
2. Für die Orientierung in der Welt der Langtexte braucht es gute Suchinstru-
mente. Diese gelten als gut, wenn bei einem Treffer sowohl der Verlust als
auch der Ballast möglichst gering ist – und zwar bei allen Fragestellungen,
nicht nur bei sehr engen (z. B. Mozarts Träume). Google-nahe Suchinstru-
mente haben zwar den Vorteil, dass sie „in“ sind und die Benutzer damit ver-
traut; nachteilig ist hier jedoch u. a., dass nicht immer fein zwischen einer
Person als Urheber und einer Person als Gegenstand unterschieden werden
kann, und bei umfassenderen Themen (z. B. Psychologie/Allgemeines) die
Trefferzahlen riesig werden; aber gerade solche Übersichtsdarstellungen sind
es, die normalerweise in Büchern veröffentlicht, bzw. dort gesucht werden.
Außerdem ist die Resultatgewinnung mithilfe von Suchmaschinen oft schwer
nachvollziehbar. Deshalb sollten die traditionellen Erschließungsinstru-
mente, bei denen Normierung, Strukturierung und sorgfältige Zuordnung zu
einer Katalogstelle eine Rolle spielen, weiterhin gepflegt und nicht so schnell
aufgegeben werden.
3. Auch die Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzer beim Sich-Zurechtfin-
den in der immer komplexer werdenden Informationswelt ist Teil des Orien-
tierungsangebotes. Im Idealfall kann das Bibliothekspersonal den Usern auf
allen Stufen helfen – von den Laien oder Studienanfängern bis zu den Dokto-
rierenden, die ihre Dissertation in OA-(Open Access-)Form zu veröffentlichen
haben. Die Bibliotheken sind ja die Institutionen, von denen erwartet wird,
dass sie Informationskompetenz haben und diese auch professionell weiter-
geben können.
4. Und dann ist da noch das Problem der steigenden Publikationsflut wegen der
tiefer liegenden Veröffentlichungsschwelle im Internet. Walach meint dazu:
„Heute kann scheinbar jeder alles veröffentlichen …, [weshalb die] Auswahl234 Urs Bisig
und [das] Filtern von Information und die Bewertung des Publizierten immer
zentraler werden.“10 Das ist jedoch nicht immer ganz einfach. Denn wer ent-
scheidet, ob eine freie Netzpublikation ein Qualitätsproblem hat und deshalb
von der Bibliothekswelt nicht unbedingt voll berücksichtigt werden muss
oder ob sie aus anderen Gründen nicht genehm ist? Dennoch werden sich die
Bibliotheken – vor allem bei den Langtexten – vermehrt mit dieser Problema-
tik auseinandersetzen müssen.
3.2 Aufgaben im Bereich des Komforts
1. Die Bibliotheken sind auch für den Komfort im Informationswesen zuständig.
Dieser lässt sich nur selten mit einer einzigen Medienform abdecken, denn je
nach Person und Fragestellung sind die Ansprüche an den Komfort verschie-
den: Manchmal sind es E-Medien, manchmal P-Medien, welche den Nutzern
am besten dienen. Beide Medienarten haben in der Bibliothekswelt ihre
Berechtigung, was eine immer weiter verbreitete E-First-Politik jedoch außer
Acht lässt. Deshalb kann man sich schon fragen: Ist es sinnvoll, primär E-Me-
dien anzubieten, selbst wenn sich immer wieder zeigt, dass bei Wahlfreiheit
im Langtextbereich die meisten Nutzerinnen und Nutzer das gedruckte Werk
in der Regel vorziehen?11 Viele Bibliotheksverantwortliche mögen dieses
Benutzerverhalten zwar bedauern, ignorieren sollten sie es jedoch nicht,
auch weil die Bibliotheken hier etwas bieten könnten, was das Internet so
nicht geben kann.
In diesem Zusammenhang haben sich die Entscheidungsträger auch stets
bewusst zu sein, dass an den Diensten der Bibliotheken nicht nur die For-
schungsfront der Naturwissenschaften und der empirischen Sozialwissen-
schaften interessiert ist, sondern dass der Nutzerkreis viel breiter ist. Auf Bib-
liotheken angewiesen sind neben interessierten Laien – diese sind übrigens
auch Wähler und Steuerzahler – Menschen in der Aus- und Weiterbildung,
Generalisten, interdisziplinär Arbeitende, Praktiker, Multiplikatoren (Leh-
rerinnen und Journalisten), Intellektuelle – und natürlich auch die in den
Geisteswissenschaften tätigen Fachleute. Ideal wäre es deshalb, wenn die
Nutzerinnen und Nutzer selber entscheiden könnten, welches Medium sie
konsultieren möchten.
10 Walach, Harald: Psychologie. Wissenschaftstheorie, philosophische Grundlagen und
Geschichte. Ein Lehrbuch. 3. überarb. und erw. Aufl. Stuttgart 2013, S. 66.
11 Vgl. Anm. 7.Die Bibliotheken, die Welt der Bücher und die heutigen Trends 235
2. Zum Komfort gehören auch die Bibliotheken als Orte. Sie sind Orte des
Lernens, der Begegnung und der Anregung, aber auch der Ruhe und des
Denkens. Unsere hypernervöse Zeit braucht Rückzugsorte für die Geistesar-
beitenden und nicht weitere Erlebniszentren für möglichst viele. Auch Sport-
anlagen wurden und werden in erster Linie für die Sporttreibenden gebaut
und nicht für alle. Das Ziel der Bibliotheken muss es deshalb nicht sein,
Orte für alle zu werden, jedoch sollten sie Wohlfühloasen für alle bleiben,
die lesen und mit dem Kopf arbeiten wollen und das unabhängig von ihrem
schulischen Background.
3.3 Aufgaben in anderen Bereichen
1. Traditionellerweise sind die Bibliotheken auch dafür zuständig, dass der
Zugang zum Wissen möglichst günstig, unkompliziert und vollständig ist.
Leider gibt es damit bei vielen kostenpflichtigen elektronischen Publikatio-
nen immer wieder Probleme, denn sie können in vielen Fällen nicht so frei
wie Druckwerke zur Verfügung gestellt werden. Oft sind sie nur für die jewei-
ligen Hochschulangehörigen einsehbar und/oder die Fernleihe ist erschwert
bis unmöglich, was der Aufgabe von Bibliotheken widerspricht, für möglichst
alle da zu sein.
2. Last but not least ist eine weitere wichtige Funktion von Bibliotheken ihre
Aufgabe als Archiv, sowohl von gedruckten wie auch von digitalen Medien.
Als Gedächtnisinstitutionen sind die Bibliotheken in erster Linie für den
immateriellen Teil des kulturellen Erbes zuständig, das heißt, dass einmal
veröffentlichte Erkenntnisse, Ideen und Gedanken nicht verloren gehen.
Dazu gehört indirekt aber auch die „Hardware“, also die konkreten Bücher
und Zeitschriften. Ein Forscher, eine Forscherin, die sich beispielsweise mit
einem Aspekt des 18. Jahrhunderts auseinandersetzt, sollte Texte aus dieser
Zeit auch ab und zu mal sehen, ja spüren können und ihnen nicht nur am
Bildschirm begegnen. Um die Zugänglichkeit und Sicherheit solcher Schätze
zu erhöhen, wäre es wünschenswert, wenn diese möglichst dezentral zur Ver-
fügung stünden.
Wie die erwähnten Punkte in der Bibliothekswelt konkret umgesetzt werden
könnten, wird im nächsten Abschnitt thematisiert.236 Urs Bisig
4 Eine mögliche Entwicklung
Das Ideal ist also nicht die digitale Bibliothek, sondern die Hybridbibliothek, eine
Institution, welche die E-Welt und die P-Welt gleichermassen berücksichtigt. Das
geht leider nicht flächendeckend, da eine solche Umsetzung zu teuer wäre. Eine
Lösung dieses Problems könnte sein, die Bibliotheken als System zu sehen: Nicht
jede Institution ist hybrid, jedoch das Bibliothekswesen als Ganzes. Mit anderen
Worten: Es müsste zu einer weiteren Spezialisierung entlang der (Haupt-)Infor-
mationsträger kommen.
Folgende Bibliothekstypen sind in diesem Zusammenhang denkbar:
– Informationszentren, wo in erster Linie die E-Medien gepflegt werden und
wo auch eine umfassende, professionelle Beratung und Schulung in diesem
Bereich erwartet werden kann. Dort sind die User umgeben von Bildschir-
men, weniger von Büchern. Diese Institutionen sehen sich als Teil der For-
schungsinfrastruktur, vor allem im Bereich der STM-Fächer sowie der empi-
rischen Sozialwissenschaften. Für diese Disziplinen sind Kurztexte in E-Form,
Schnelligkeit und Hyperspezialisierung im Publikationsbereich typisch, was
diese „Bibliotheken“ zu berücksichtigen haben.
– Orientierungszentren, die sich primär den Langtexten (Büchern) widmen,
zunächst einmal unabhängig vom Informationsträger. Ihr Schwerpunkt aber
ist das traditionelle Buch. Sie sehen sich ähnlich wie Museen, Theater und
Konzertsäle vor allem als Teil der kulturellen Infrastruktur, aber auch als
Zentren für die Geistes- und Kulturwissenschaften sowie als Wohlfühloasen
für die Wissensarbeitenden. Mit der E-First-Politik von vielen Institutionen
werden Orte, wo das gedruckte Buch noch gepflegt wird, noch exklusiver.
Das heißt aber noch lange nicht, dass es in der neuen klassischen Bibliothek
aussieht, wie in einer solchen Institution vor fünfzig, sechzig Jahren. Selbst-
verständlich werden dort neben vielen Büchern auch Bildschirme zu sehen
sein, denn diese braucht es unter anderem für die Suchinstrumente. Und zur
Ergänzung des Bestandes sollten den Nutzerinnen und Nutzern „Ausflüge“
in die Welt der E-Medien ermöglicht werden, denn auch bei den Langtexten
wird heute längst nicht mehr alles gedruckt, immer mehr Inhalte von älteren
P-Books sind heute frei im Netz zugänglich und die Forschenden in den Geis-
teswissenschaften brauchen zunehmend auch Digitalisate.
– Einige große Universal- und Spezialbibliotheken schaffen es, dem Ideal (Hyb-
ridbibliothek) nahe zu kommen und können in beiden Welten ein breites
Angebot – und einen entsprechenden Service – zur Verfügung stellen. In
der Regel sind das auch die Institutionen, die für die Langzeitarchivierung
zuständig sind. Dieser Bibliothekstyp wird sich jedoch nicht so stark ausbrei-
ten, weil die Kosten dafür enorm sind.Die Bibliotheken, die Welt der Bücher und die heutigen Trends 237
– Im Bereich der Öffentlichen Bibliotheken scheint sich ein immer größerer Teil
von ihnen an keinem der vorgestellten Modelle zu orientieren, sondern ent-
fernt sich zunehmend von der Bibliotheks-„Familie“. Diese „Bibliotheken“
sehen ihre Zukunft immer weniger als Orte von Büchern, sondern immer mehr
als moderne Freizeit- und Bildungszentren, wo der (wenn möglich digitale)
Informationssektor nur noch ein Teilbereich ist. Dafür gibt es dort Escape
Rooms, Makerspaces, Gaming-Ecken, Workshopräume, Tonstudios, Lounges
usw.
Durch eine solche Arbeitsteilung wird die Bibliothekslandschaft noch vielfältiger
und bunter werden. Als Folge davon sollten sich die Bibliotheken immer weniger
als Einzelkämpfer sehen, sondern müssen sich immer mehr als Teil eines Ganzen
verstehen.12 Wichtig ist nicht ein Kampf um Ressourcen, sondern Kooperation
und Koordination unter den Bibliotheken sowie eine umfassende Information der
User über die verschiedenen Angebote.
5 Schlussbemerkungen
Obwohl die Bibliotheken heute nicht mehr die exklusiven Orte des Wissens sind
wie früher, so gibt es für sie weiterhin eine Menge von Aufgaben. Einige der wich-
tigsten sind:
– Das Bibliothekswesen bietet kostengünstige, niederschwellige Zugänge zur
gesamten Informationswelt für alle – nicht nur für einen Teilbereich und
nicht nur für einen ausgewählten Kreis.
– Die Bibliotheken sind besonders verantwortlich für:
– die Orientierung in der Info-Welt – durch Langtexte, Kataloge und Bera-
tung,
– den Komfort in der Info-Welt – durch Angebote von E- und P-Medien und
– die Qualität in der Info-Welt – durch Auswahl.
– Die Bibliotheken bieten ihre Institutionen auch als Orte an mit dem Ziel, dass
sich bei ihnen möglichst viele Leute des Denkens wohl fühlen.
Da heute in den meisten Fällen nicht mehr eine Institution allein das ganze Infor-
mationsspektrum gut abdecken kann, wird die Spezialisierung immer wichtiger:
Statt dass viele Bibliotheken versuchen, ein möglichst breites Angebot zu präsen-
12 Vgl. z. B. Knoche (Anm. 3) S. 23 und S. 119.238 Urs Bisig
tieren, sehen sich die meisten nur noch für einen Teilbereich zuständig. Dieser
wird dann aber besonders sorgfältig und professionell gepflegt.
Was die Corona-Pandemie anbelangt, so haben wir dadurch zwar verstärkt
einige Vorteile der Digitalisierung13 erfahren können, die Krise hat aber auch
offenbart, wie verletzlich unsere moderne Gesellschaft ist. Möglicherweise ist es
nicht ein biologisches Virus, welches eine nächste größere Beeinträchtigung im
Bibliotheksbetrieb auslösen wird, sondern ein Computervirus, ein Hackerangriff,
eine länger andauernde Störung im Netz oder gar ein Datenverlust wegen was
auch immer. Für Digitalenthusiasten ist das zwar (fast) undenkbar, aber Super-
GAUs in Kernkraftwerken waren auch unmöglich bis es sie gab. Im Falle eines
Worst Case werden wahrscheinlich selbst die technikaffinsten Leute froh sein,
dass viele Informationen dezentral auch noch auf Papier zur Verfügung stehen
und nicht nur im Netz.
Und noch etwas – eher Unerwartetes – hat uns die Coronazeit gezeigt: Die
gedruckten Bücher haben gar nicht ein so schlechtes Image, wie uns viele tech-
nikaffine Vordenker immer wieder weismachen wollen. In Zeiten von Homeoffice
und Videokonferenzen dienen vielen Leuten dekorative Bücherwände als Hinter-
grund für ihr neues „Büro“.14 Umgeben von Büchern fühlen sich diese Menschen
wohl und/oder sie wollen sich so als gebildet und belesen zeigen. Eine solche
Inszenierung wäre jedoch fatal, gälte der Bücherbesitz heute als ein Zeichen von
hoffnungsloser Rückständigkeit. Auch das Treffen der beiden Präsidenten Biden
und Putin in Genf vom 16. Juni 2021 fand in einem gediegenen Bibliotheksraum
statt und eben gerade nicht in einem seelenlosen Saal voller Technik.15
Bücher und andere traditionelle bibliothekarische Angebote sind also noch
lange nicht obsolet, sondern im Gegenteil: Sie sind geradezu ideale Instrumente
zur Ergänzung der modernen Informationswelt. Dennoch wird sich die E-Welt,
vor allem auch der Open-Access-Ansatz, wahrscheinlich immer mehr ausbrei-
ten. Umso wichtiger ist es dann, dass es noch Institutionen gibt, welche auch
gedruckte Medien berücksichtigen und die E- und P-Welt intelligent miteinander
verknüpfen. Wir sollten die beiden Bereiche nicht als unversöhnliche Gegen-
sätze sehen, sondern als Teile einer Welt, der Informationswelt: Gefragt ist mehr
Sowohl-als-auch- und weniger Entweder-oder-Denken. Was Walach zum Wissen-
schaftsbetrieb meinte, kann ohne weiteres auch aufs Bibliothekswesen übertra-
13 Hinweise darauf u. a. in der Beitragssammlung COVID-19 trifft die Bibliothekswelt. In:
b.i.t.online 23 (2020) 3, S. 239–276.
14 Klette, Kathrin: Die Bibliothek als Dekoration. In: Neue Zürcher Zeitung vom 05.02.2021, S. 16,
https://www.nzz.ch/panorama/buecher-im-home-office-die-bibliothek-als-dekoration-nzz-
ld.1599805 [Zugriff: 14.02.2022].
15 https://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Gipfelkonferenz_(2021) [Zugriff: 14.02.2022].Die Bibliotheken, die Welt der Bücher und die heutigen Trends 239
gen werden: „Monokulturen sind nicht nur im normalen Leben, sondern auch in
der Wissenschaft hässlich und schädlich.“16 Die Bibliodiversität, also die Vielfalt
in der Buchkultur, sollte deshalb von der Bibliothekswelt gepflegt und nicht igno-
riert werden. Es lässt sich sogar behaupten: Je wichtiger die Ebene der Langtexte
von den Bibliotheksverantwortlichen genommen wird, desto besser werden viele
traditionelle Bibliotheksangebote sein.
Die Bibliotheken müssen aufpassen, dass sie bei ihrer Annäherung an die
E-Welt nicht zu abhängig von den internationalen Großverlagen, Tech-Giganten
und weiteren gewinnorientierten Unternehmen werden. Eine gute Zusammen-
arbeit mit diesen Firmen ist zwar wichtig und hilfreich, die Bibliotheken müssen
jedoch ebenso schauen, dass sie möglichst unabhängige Player bleiben und
ihr eigenes Profil weiterentwickeln können. Dem Bibliothekswesen wäre mehr
Selbstvertrauen zu wünschen, denn es kann auch einen wertvollen Beitrag zur
Bewältigung von Orientierungsproblemen in der Wissenswelt, für den Komfort im
Informationssektor und zur Bekämpfung von Fake-News leisten.
Urs Bisig
Eierbrechtstr. 11
8053 Zürich
Schweiz
E-Mail: urs.bi@bluewin.ch
16 Walach (Anm. 10) S. 313.Sie können auch lesen