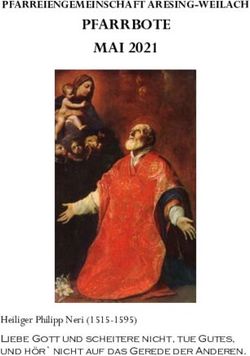Die Sorgen der Eltern - Insieme
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Die Sorgen der Eltern Vortrag anlässlich der Delegiertenversammlung von insieme Schweiz, 4. November 2006 Erika Tuller, Präsidentin insieme Neuchâtel Als Heidi Lauper mich bat, die Sicht der Eltern zum Thema Alter zu präsentieren, habe ich mir zuerst ü- berlegt, ich könnte mich auf Gedanken und Probleme beziehen, wie sie von den älteren Mitglieder unsers Vereins eingebracht werden. Dann aber bin ich mir bewusst geworden: „Aber hör mal, du selbst befindest dich ja kurz vor der Pensionierung! Welche Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche hast du selbst im Hinblick auf diese neue und letzte Lebensphase, die dich erwartet?“ Können wir vorhersehen und schon vorwegnehmen, was wir dann brauchen werden? Solange wir im aktiven Leben stehen, haben wir nicht das Gefühl, alt zu werden und schon zu dieser Kategorie Men- schen zu gehören. Wer aber ist denn von der Alterproblematik betroffen, ab welchem Alter? Wenn wir so fragen, wird sofort klar, dass wir es mit einer komplexen Thematik zu tun haben. Die Palette der sogenannt älteren oder be- tagten Menschen ist enorm, und folglich sind die Bedürfnisse zahlreich und vielfältig. Es wird gleichzeitig klar, dass dabei Faktoren eine Rolle spielen, die oft nicht mit dem chronologischen Alter zu tun haben, sondern mit der Gesundheit, der Lebenskraft, der Motivation usw. Und das trifft sowohl auf unser eigenes Altern wie auf das unserer Söhne und Töchter mit Behinderung zu. Bei meiner Vorbereitung stützte ich mich auf eine Studie, die in der Stiftung „Les Perce-Neige“ zur Frage der Begleitung von älter werdenden Menschen mit einer geistigen Behinderung durchgeführt worden war. Die Studie verfolgte unter anderem das Ziel, die besonderen Bedürfnisse der älteren BewohnerInnen der Institution zu definieren und ein Begleitkonzept für diese Personen zu erarbeiten. Sie wurde 2003 vom damaligen Leiter des Wohnbereichs, Herrn Jean-Daniel Vautraver, durchgeführt und führte im März 2006 zur Eröffnung einer neuen Wohneinheit in der Stiftung, der Gruppe der Älteren. Diese Einheit hat ein ei- genes Betreuungskonzept, das sich stark von den anderen Konzepten unterscheidet. Für uns war es sehr wichtig, dass die Eltern in diese Studie einbezogen waren, so dass sie ihre Sicht und ihre Bedürfnisse auch formulieren konnten. Mein Referat ist also ein bisschen die Frucht meiner persönlichen Überlegungen, ergänzt um Elemente aus der Studie der Stiftung “Les Perce-Neige” und um konkrete Probleme, wie sie sich gegenwärtig eini- gen Familien stellen. Probleme, die mir die Eltern mitteilen oder die ich als Präsidentin einer Elternorgani- sation in meiner Umgebung wahrnehme. Aber warum denn machen sich die Eltern heute, 2006, so viele Sorgen und Gedanken im Hinblick auf ihr Alter oder das ihrer Kinder? Immerhin ist es fast 50 Jahre her, das sich in unserem Land Elternvereine gegründet haben. Und während all dieser Jahre haben die Eltern dafür gearbeitet, dass Institutionen, Ta- ges- und Beschäftigungsstrukturen und eine Vielzahl an Diensten entstehen. Immer mit dem Ziel vor Au- gen, dass ihre eigenen Söhne und Töchter und die künftiger Generationen nach dem Tode der Eltern ein würdiges Leben in einem sicheren und guten Rahmen führen können. Ein bedeutendes Netz von Son- dereinrichtungen wurde in unserem Land entwickelt. Konsequenterweise sollten wir sagen können, dass wir gut dran sind und beruhigt sein können.
Die 40er Jahre
Vorgeburt 1. Alter 2. Alter 3. Alter
Bevölkerungs-
20 Jahre 65 Jahre
druchschnitt
Familienabhängigkeit Selbstbestimmung
Lebenserwartung Überleben
62,7 Jahre1
Kindheit Schule Ausbildung Aktives Leben
9 Mte 6 Jahre 15 Jahre 20 Jahre 65 Jahre
Vorgeburt 1. Alter 2. Alter 1946
Person mit
Down Syn-
Einführung der
AHV
Familienabhängigkeit (mit 65 Jahren)
drom
Lebenserwartung Überleben
9 Monate 13,5 Jahre2
Im Jahr 2000
Vorgeburt 1. Alter 2. Alter 3. Alter 4. Alter
18 Jahre 65 Jahre 80 Jahre
Familienabhängigkeit Selbstbestimmung Abhängig-
Bevölkerungs-
keit
durchschnitt
Lebenserwartung Überleben
3
76,9 Jahre
Kindheit Schule Ausbildung Aktives Leben Pensioniertenleben
4 Jahre 15 - 16 19 -25 60 - 65 Jahre
5 - 9 Mo- Jahre Jahre
nate
Vorgeburt 1. Alter 2. Alter 3. Alter
Person mit Down
18 Jahre 65 Jahre
Familiäre und institutionelle Abhängigkeit
Lebenserwartung Überleben
4
Syndrom
64Jahre
Kindheit Schule Ausbildung Aktives Pensionier- Pensioniertenleben
4Jahre 18 Jahre 20 Jahre tenleben
5 - 9 Mo-
?
nate
Vautravers Jean-Daniel, Accompagnement des personnes handicapées mentales vieillissantes - Etat de
la question, Fondation Les Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys, Mars 2004, p. 14 et 15
1
Amt für Statistik, Neuchâtel, 2001
2
COLLMAN & STOLLER, zitiert in BREITENBACH Nancy, Une saison de plus – Handicap mental et vieillissement,
Ed. Desclée de Brouwer. Paris, 1999,S. 51
3
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zitiert in der Tageszeitung « L’Express », Neu-
châtel, 16. Oktober 2003
4
STRAUSS & EYMAN, zitiert in BREITENBACH Nancy, Une saison de plus – Handicap mental et vieillissement, op.
cit., S. 51Die hier präsentierte Tabelle lässt uns rasch verstehen, dass sich mit Beginn des 21. Jahrhunderts neue Probleme stellen. Ich vereinfache etwas, aber folgende Aspekte sollten wir uns merken: • Die Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung erhöht sich. Auch sie erreichen das 3. Alter, und immer mehr Menschen mit Behinderung überleben ihre Eltern. • Die Bevölkerungsgruppe der Menschen mit Behinderung wächst markant. • Die Eltern selber werden immer älter. Im Grunde genommen können wir uns über diese Tatsachen freuen, gleichzeitig lösen sie aber eine An- zahl neuer Bedürfnisse aus – denen man wird entsprechen müssen. Was bedeutet diese Entwicklung für Menschen mit einer geistigen Behinderung? Wie jedermann hat ein Mensch mit Behinderung das Recht auf den Ruhestand oder Teil-Ruhestand, nicht nur entsprechend der Altersskala, sondern auch entsprechend seines Gesundheitszustandes und seiner persönlichen Ressourcen. Welche Konsequenzen hat das für die Institutionen? Das Altern wirkt sich in verstärkter Abhängigkeit aus, was zu einem erhöhten Bedarf an Unterstützung führt. Es braucht: • mehr Wohnplätze • Anpassung der Strukturen für ältere Menschen, Eröffnung von speziellen Gruppen für diesen Bewohne- rInnenkreis • Erhöhung des Assistenzbedarfs und als Konsequenz des Betreuungspersonals • Betreuung durch Personal aus verschiedenen Fachrichtungen, Anstellung von Personal mit Zusatzaus- bildung in Geriatrie und Pflege. Dies wird den gegenwärtigen institutionellen Rahmen stark verändern. • Grosszügigere Ausgestaltung der Lebensräume (für Rollstühle, aber auch weil bedeutend mehr Zeit in der Wohneinrichtung verbracht wird). Es braucht Raum für Tätigkeiten und Aktivitäten, weil die Bewoh- nerInnen nicht mehr in die Werkstätten gehen. • Bewusstsein, dass es immer häufiger zu Notfällen kommen kann. • Definition der Grenze, wie weit eine Institution bei dementen Person oder im Fall einer degenerativen Krankheit Verantwortung übernimmt. Was bedeutet das für die Eltern? Sicher, das grösste und legitimste Anliegen der Eltern bleibt emotionaler Natur. Über alle Altersstufen hinweg und trotz allen guten Willens und aller guten Dienste, die uns zur Verfügung stehen: Welche Ga- rantie kann man uns geben, dass man sich um unsere Tochter oder unseren Sohn weiterhin gut kümmert, auch wenn wir nicht mehr da sind? Diese Sorgen werden beträchtlich gemildert, wenn wir darauf vertrau- en können, dass allen Rahmenbedingungen mit Sorgfalt Rechnung getragen wird. Bei den Eltern sprechen wir heute vom 4. Alter. Und in dieser Phase verändern sich die familiären und sozialen Konstellationen erheblich. Die Eltern sehen sich selbst mit Schwierigkeiten konfrontiert, z.B. dem Schwinden der Lebenskraft, dem Verlust der Mobilität, der Autonomie. Sie stehen vielleicht vor gesund- heitlichen Problemen, dem Tod des Partners, sie müssen möglicherweise ins Krankenhaus oder sogar in ein Pflegeheim. Einige dieser Eltern lebten bis dahin mit ihren behinderten Söhnen oder Töchtern zu Hau- se oder haben sie regelmässig am Wochenende nach Hause genommen.
• Auf welchem Zeitpunkt hin sollten sich die Eltern für die Person, um die sie sich kümmern, eine definiti- ve Platzierung suchen? Viele Eltern stehen unter Druck, auch wenn sie ihren Sohn oder ihre Tochter bereits in eine Warteliste einer Wohneinrichtung eingeschrieben haben. Der Tag, an dem man ihnen mitteilt, dass ein Platz frei sei, ist vielleicht noch nicht der richtige Moment. Sie nehmen so viel auf sich, wie sie können. Doch weil es keine Garantie für einen Platz zum gewünschten Zeitpunkt gibt, ist die Unsicherheit unerträglich. • Wer hilft ihnen, diese schmerzhafte und schwere Entscheidung zu fällen? • Was lässt sich tun, um diesen Übergang zu erleichtern? • Ist es möglich, Übergangslösungen zu planen? Eine Platzierung in Etappen? A la carte? • Sollen die Institutionen den betagten Eltern Wochenendplätze anbieten, damit die Eltern ein Wochen- ende mit dem Familienmitglied mit Behinderung verbringen können, anstatt dass die Eltern ihren Sohn oder ihre Tochter zu sich holen? • Haben die Institutionen die Infrastruktur, um das zu tun? • Wird man es einer behinderten Person ermöglichen, so oft, wie sie es wünscht, ihren Vater oder ihre Mutter zu besuchen, wenn diese im Krankenhaus sind oder in einem Altersheim wohnen? Wird sie dorthin gefahren werden? • Wenn die behinderte Person weiterhin bei den Eltern wohnt, wäre dann nicht gut, auf einen Transport- und Begleitdienst zählen zu können, der es ihr erlaubt, an den Freizeitaktivitäten teilzunehmen? Fehlt dieses Angebot, besteht die Gefahr, dass der soziale Kontakt und die Möglichkeit zu stimulierenden Ak- tivitäten verloren gehen. • Kann er (oder sie) bis zum Schluss am gleichen Ort wohnen bleiben? • Sind die normalen Pflegeheime für die Aufnahme von Menschen mit geistiger Behinderung gerüstet? • Und schliesslich, wird es für jede Person einen Platz geben? Angepasst an ihre persönlichen Bedürf- nisse? Wird es gelingen, die Entwurzelung zu verhindern? Ich könnte diese Liste mit Fragen und Sorgen noch unendlich verlängern. Viele Eltern wagen es nicht einmal, ihre Sorgen und Fragen zu äussern, so sehr haben sie Angst, dass es keine wirkliche Antwort gibt. Oft ziehen sie es vor, sich ins Schicksal zu ergeben. Haben wir in sozial und ökonomisch unruhigen und schwierigen Zeiten realistische Chancen, wenn wir die Gründung zusätzlicher Institutionen in Betracht ziehen? Werden wir uns nicht bloss an den Behörden aufreiben, die auf ihren ökonomischen Prinzipien beharren und jedes neue Anliegen sofort weit von sich weisen? Wir riskieren, dass man uns Billiglösungen vorschlägt und dass man immer mehr Lasten auf die Familien abwälzt. Es stimmt, das Boot unserer Anliegen ist reich befrachtet! Zum Zeitpunkt, wenn einige Eltern langsam zu ermüden beginnen, weil sie schon so dafür gekämpft ha- ben, dass sich die starren Strukturen der Institutionen lockern und dass sie als Partner betrachtet werden, und weil sie weiter für die Integration kämpfen, dafür, dass die Rechte der behinderten Personen respek- tiert werden….. verlängert die Erhöhung der Lebenserwartung die Liste der Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen. Es stimmt auch, dass wir in einer Epoche grosser Veränderungen leben. • Ist das gut oder schlecht?
Es verunsichert, gewiss, aber es erlaubt Innovationen. Denn es wird nichts anderes übrig bleiben, als neue Lösungen zu finden! Lassen wir also vor allem die Arme nicht sinken und lassen wir uns von den Appellen der Ökonomie nicht erschüttern. Ich hoffe inständig, dass es immer Eltern gibt, die genügend Energie und Mittel finden, um sich einzusetzen und neue, visionäre Projekte zu verteidigen. Wenn Eltern vor 30, 40 oder 50 Jahren aus dem nichts riesige Institutionen auf die Beine stellen konnten, sollten wir fähig sein, es ihnen gleich zu tun, indem wir uns neue, flexiblere, leichtere, integrativere, indivi- duellere Lösungen auszudenken. Seien wird imaginär, innovativ und lassen wir uns vor allem nichts vor- schreiben. Vor einigen Jahren sagte mir eine Mutter, deren Sohn mit einer Behinderung bei ihr zu Hause wohnte und eine geschützte Werkstätte besuchte: „Wenn wir alt sind, werden wir in ein Altersheim gehen und nehmen unseren Sohn mit.“ Damals fand ich diese Idee unmöglich. Heute sage ich mir: „Und warum nicht?“ Das Wesentliche ist, dass jede Person die Lösung findet, die ihr zusagt. Als Elternvereine könnten wir vielleicht Gesprächsgruppen oder Kurse mit Fachpersonen zu Fragen des Alterns organisieren. Die Familien sollten eine Person zur Verfügung haben, die ihnen helfen könnte, alle existierenden Unter- stützungsmöglichkeiten ausfindig zu machen. Meine Schlussfolgerung lautet: Verlassen wir etwas das traditionelle institutionalisierte Schema. Und vor allem: Lasst uns vorurteilslos unsere Sorgen teilen und unsere Ideen austauschen!
Sie können auch lesen