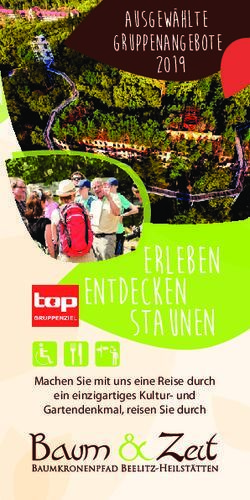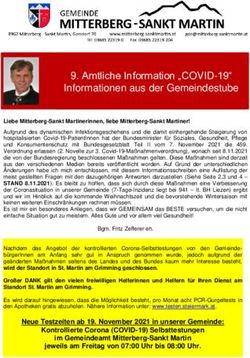Die wichtigsten Bestimmungen der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge - BVG
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
BVG
Die wichtigsten Bestimmungen
der beruflichen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
Stand Januar 2007BVG
4Grundlage und Ziel der beruflichen Vorsorge
Geregelt wird die berufliche Vorsorge in der Schweiz hauptsächlich in den Bestimmungen des Bundes-
gesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und den darauf
gestützten Verordnungen (BVV). Zusammen mit den Leistungen aus der AHV/IV (1. Säule) hat sie als
2. Säule das Ziel, dem Versicherten die gewohnte Lebenshaltung in angemessener Weise zu ermög-
lichen. Das BVG definiert Mindestleistungen für das Alter, im Todesfall und bei Invalidität. Die Vorsorge-
einrichtungen sind frei, über das vom Gesetz geforderte Minimum hinauszugehen. Es handelt sich
hierbei um überobligatorische Leistungen.
4Versicherte Personen
Obligatorisch
Alle AHV-pflichtigen Arbeitnehmer, die ein Jahresgehalt von mehr als CHF 19 890 beziehen,
unterstehen dem BVG
– ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und Invalidität,
– ab dem 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres zusätzlich für Altersleistungen.
Freiwillig
Selbstständig Erwerbende können sich freiwillig versichern und haben zudem die Möglichkeit,
sich ausschliesslich im Bereich der weitergehenden Vorsorge zu versichern. Die geleisteten
Beiträge und Einlagen müssen dauernd der beruflichen Vorsorge dienen.
4Der versicherte Lohn
Obligatorisch zu versichern ist derjenige Teil des AHV-Jahreslohnes, der zwischen CHF 19 890 und
CHF 79 560 liegt (Stand 2007). Dieser Lohnteil wird koordinierter Lohn oder BVG-Lohn genannt.
Der maximale koordinierte Lohn liegt somit bei CHF 56 355. Erreicht der koordinierte Lohn den Be-
trag von CHF 3315 nicht, wird er auf diesen Wert angehoben. Die erwähnten Grenzbeträge werden
in der Regel bei Erhöhungen der AHV auf Beschluss des Bundesrates angepasst.
Löhne über CHF 79 560 werden nur versichert, sofern dies das Pensionskassenreglement vorsieht.
Es handelt sich hierbei um überobligatorische Versicherungen.
in CHF 1000
100
80
60
40
effektiver Jahreslohn CHF 90 000
20 anrechenbarer Jahreslohn maximal CHF 79 560
versicherter oder koordinierter Jahreslohn maximal CHF 56 355
0 Koordinationsabzug CHF 23 205BVG
4Ende der Versicherung
Die obligatorische Versicherung endet
– bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses
– bei Unterschreiten des Mindestjahreslohnes (CHF 19 890)
– bei Anspruch auf Altersleistungen
Tritt die versicherte Person nach der Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht sofort einer neuen
Vorsorgeeinrichtung bei, so gewährt ihr die bisherige Vorsorgeeinrichtung für die Risiken Tod und
Invalidität eine Nachdeckung von längstens 30 Tagen.
4Versicherungsleistungen
Die Leistungen werden grundsätzlich in Rentenform ausgerichtet. Das Reglement der Vorsorgeein-
richtung kann aber vorsehen, dass anstelle einer Rente eine einmalige Kapitalabfindung eingeräumt
wird. Bei Altersleistungen muss die versicherte Person die Auszahlung in Form einer Kapitalabfindung
spätestens 6 Monate vor Entstehen des Anspruches schriftlich bei der Vorsorgeeinrichtung beantragen.
• Altersrente
Der Anspruch auf Altersleistungen entsteht für Männer ab 65 und für Frauen ab 64 Altersjahren.
Die Höhe der jährlichen Altersrente beträgt 7,2% (schrittweise sinkend auf 6,8% bis im Jahr 2014)
des im ordentlichen Rücktrittsalter vorhandenen Altersguthabens. Das Altersguthaben wird aus
den jährlichen Altersgutschriften, den eingebrachten Freizügigkeitsleistungen und weiteren Einlagen
(z.B. Einkauf von Beitragsjahren) gebildet sowie aus den daraus entstandenen Zinserträgen.
• Invalidenrente
Die Höhe der jährlichen Invalidenrente beträgt 7,2% (schrittweise sinkend auf 6,8% bis im Jahr 2014)
des existierenden Altersguthabens zuzüglich der Summe der künftigen Altersgutschriften ohne Zins.
Ab einer 40%igen Invalidität besteht Anspruch auf eine Viertelrente, ab einem Invaliditätsgrad von
mindestens 50% auf eine halbe Rente, ab 60% auf eine Dreiviertelrente und eine volle Rente ab 70%.
• Ehegattenrente
Die Höhe der jährlichen Ehegattenrente beträgt vor dem Rücktrittsalter 60% der versicherten Inva-
lidenrente bzw. nach dem Rücktrittsalter 60% der laufenden Altersrente. Der überlebende Ehegatte
hat Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente, wenn er beim Tod des Ehegatten
– für den Unterhalt eines oder mehrerer Kinder aufkommen muss oder
– das 45. Altersjahr zurückgelegt hat und die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat.
Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so hat der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine
einmalige Abfindung in der Höhe von drei Jahresrenten.
• Kinderrenten
Die Höhe der jährlichen Kinderrenten (Waisenrente, Invaliden-Kinderrente, Pensionierten-Kinderrente)
beträgt vor dem Rücktrittsalter 20% der Invalidenrente bzw. nach dem Rücktrittsalter 20%
der Altersrente. Anspruchsberechtigt ist das Kind bis zur Vollendung des 18. Altersjahres oder
solange es in Ausbildung steht, längstens aber bis zur Vollendung des 25. Altersjahres.BVG
4Finanzierung
Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers fest.
Der Arbeitgeber bezahlt mindestens die Hälfte der insgesamt aufzuwendenden Summe. Die Beiträge
setzen sich zusammen aus:
– Altersgutschriften für die Altersvorsorge
Alter Altersgutschrift in %
Mann/Frau des koordinierten Jahreslohnes
25 – 34 7
35 – 44 10
45 – 54 15
55 – 65/64 18
Der Mindestzinssatz zur Verzinsung der Altersgutschriften wird vom Bundesrat festgelegt und
beträgt zurzeit 2,5%.
– Individuellen Risikoprämien für die Deckung von Tod und Invalidität.
– 0,2% des koordinierten Jahreslohnes für den Teuerungsausgleich.
– Beiträge für den Sicherheitsfonds.
Kosten in % des versicherten Lohnes
Sicherheitsfonds ca. 0,1%
Teuerungsausgleich 0,2%
Risikoprämien 2 bis 5%
Altersgutschriften 7 bis 18%
Arbeitgeberbeiträge ArbeitnehmerbeiträgeBVG
4Anpassung der Renten an die Teuerung
Die Hinterlassenen- und Invalidenrenten, deren Laufzeit drei Jahre überschritten hat, werden gemäss
Anordnung des Bundesrates der Preisentwicklung angepasst.
Die laufenden Altersrenten können im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Vorsorgeeinrichtung
der Teuerung angepasst werden.
4Sicherheitsfonds
Der Sicherheitsfonds richtet Zuschüsse an Vorsorgeeinrichtungen mit ungünstiger Altersstruktur aus
und stellt bis zu einer bestimmten Höhe die Leistungen von zahlungsunfähigen Vorsorgeeinrichtungen
sicher.
4Die Freizügigkeit in der beruflichen Vorsorge
Versicherte Personen, welche die Vorsorgeeinrichtung verlassen und bereits ein Altersguthaben
angespart haben, bevor ein Vorsorgefall eingetreten ist, haben Anspruch auf eine Austrittsleistung.
In der Regel entspricht sie dem bis zum Austrittsdatum erworbenen Altersguthaben (Freizügigkeits-
gesetz vom 1. Januar 1995).
Die versicherte Person hat in jedem Fall Anspruch auf nachfolgende Freizügigkeitsleistung:
– eingebrachte Eintrittsleistung inklusive Zinsen
– die selbst einbezahlten Sparbeiträge samt einem Zuschlag von jährlich 4% ab dem 20. Altersjahr,
wobei der gesamte Zuschlag höchstens 100% betragen darf.
4Freiwilliger Einkauf
Die Vorsorgeeinrichtung darf den Einkauf höchstens bis zur Höhe der reglementarischen Leistung
gestatten. Wurden Vorbezüge für die Wohneigentumsförderung getätigt, dürfen freiwillige Einkäufe
erst vorgenommen werden, wenn die Vorbezüge zurückbezahlt sind. Von der Begrenzung ausge-
nommen sind die Wiedereinkäufe im Falle der Ehescheidung oder Auflösung der eingetragenen Part-
nerschaft. Die aus dem Einkauf resultierenden Leistungen dürfen innerhalb der nächsten 3 Jahre
nicht in Kapitalform zurückgezogen werden.BVG
4Steuern
Die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern für die obligatorische und die überobligatorische
Vorsorge sind bei der Einkommenssteuer grundsätzlich voll abzugsfähig.
Die Vorsorgeleistungen sind in vollem Umfang als Einkommen zu versteuern.
4Wohneigentumsförderung
Bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruches auf Altersleistungen kann die versicherte Person
Mittel der beruflichen Vorsorge zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum vorbeziehen oder
verpfänden. Ein Vorbezug ist sofort voll steuerpflichtig, eine Verpfändung hat nur im Falle der Pfand-
verwertung steuerliche Konsequenzen.
4Die Vorsorgeeinrichtungen
Die Vorsorgeeinrichtungen der beruflichen Vorsorge haben die Rechtsform einer Stiftung (firmen-
eigene Stiftung oder Sammelstiftung), einer Genossenschaft oder einer Einrichtung des öffentlichen
Rechts. Sie unterstehen einer Aufsichtsbehörde und sind in das Register für berufliche Vorsorge
eingetragen. Verwaltet wird die Vorsorgeeinrichtung durch ein paritätisch zusammengesetztes Organ
(gleiche Anzahl von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern). Unter Wahrung der gesetzlichen
und steuerrechtlichen Vorschriften sind die Vorsorgeeinrichtungen in der Gestaltung der beruflichen
Vorsorge (Leistungen, Finanzierung und Organisation) frei, weshalb es in der Schweiz eine Vielzahl
unterschiedlichster Pensionskassenreglemente gibt.
4Neue Bestimmung
Ab dem 1. Juni 2007 ist die Barauszahlung des BVG-Altersguthabens nicht mehr möglich, wenn die
Person der obligatorischen Versicherung in einem EU-Mitgliedsstaat (bzw. Island oder Norwegen)
unterstellt ist oder wenn die Person in Liechtenstein wohnt.
PAX. Für die berufliche und private Vorsorge.
PAX, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft
Aeschenplatz 13, Postfach, 4002 Basel, Telefon +41 61 277 66 66, Telefax +41 61 277 64 56
info @ pax.ch, www.pax.ch
2074/Marketing/10.06Sie können auch lesen