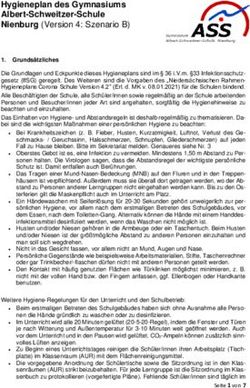Ein Beteiligungsrat für dauerhafte Bürgerbeteiligung auf Bundesebene - Netzwerk Bürgerbeteiligung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
________________________________________________________________________________________________
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Ein Beteiligungsrat für dauerhafte Bürgerbeteiligung auf Bundes-
ebene
Prof. Dr. Brigitte Geißel • Stefan Jung
Belgien, Brasilien, Frankreich, Irland, Island – dies sind nur einige Länder, in denen in den letzten Jahren
Bürgerbeteiligung auf nationaler Ebenen ermöglicht wurde. Bürgerbeteiligung auf nationaler Ebene kann
frühzeitig gesellschaftliche Probleme auf die politische Agenda bringen sowie die Gesetzgebung mitgestal-
ten und transparenter machen. Auch in Deutschland wurde sowohl von Seiten der Bundesregierung (z.B.
Klimaschutzplan 2050) als auch der Zivilgesellschaft (z.B. Bürgerrat Demokratie) Bürgerbeteiligung auf Bun-
desebene erprobt. Diese Beispiele sind vielversprechend. Damit Bürgerbeteiligung ihre Qualitäten vollstän-
dig entfalten kann, so unser Argument, muss diese jedoch ähnlich wie Wahlen und Abstimmungen ein dau-
erhaft verfügbarer Bestandteil der Politik werden.
Erfahrungen mit bereits bestehender nationaler Bürgerbeteiligung in anderen Ländern können für die Gestal-
tung eines nationalen Beteiligungsverfahrens für die Bundesrepublik herangezogen werden. Im Rahmen der
Studie »Mehr Mitsprache wagen: ein Beteiligungsrat für die Bundesrepublik« (Geißel und Jung 2019) haben
wir für die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) auf diese Weise das Modell eines Beteiligungsrats entwickelt. Im
Folgendem diskutieren wir Argumente und Herausforderungen für eine dauerhafte Bürgerbeteiligung auf
Bundesebene. Wichtige Punkte illustrieren wir anhand von zwei Fallbeispielen und stellen die zentralen Cha-
rakteristiken des Beteiligungsrats vor.
Warum es eine dauerhafte Bürgerbeteiligung auf nationaler Ebene braucht
Erste Fallbeispiele in Deutschland zeigen, dass Bürgerbeteiligung auf nationaler Ebene möglich ist. Bisher
wurde Bürgerbeteiligung jedoch nur sporadisch und ad-hoc eingesetzt, wodurch die Sichtbarkeit und Rele-
vanz für Politik und Zivilgesellschaft begrenzt blieb. Dazu tragen aber auch weitere Defizite im derzeitigen
Umgang mit Bürgerbeteiligung auf nationaler Ebene bei, von denen wir einige hier kurz benennen möchten:
a) Starke Unterschiede im Design: Die genutzten Verfahren variieren stark in ihrer Ausgestaltung. Politik und
Zivilgesellschaft müssen sich demnach über jedes Verfahren und deren Charakteristiken neu informieren
und auch die Einbeziehung von Interessen gestaltet sich sehr unterschiedlich.
b) Abhängigkeit von der Regierung: Die Möglichkeiten für die Zivilgesellschaft aber auch die Opposition, Bür-
gerbeteiligung zu initiieren, sind beschränkt. Dadurch ist die Themen- und Interessenvielfalt bei Bürgerbetei-
ligung reduziert.
c) Fehlende Verbindlichkeit: Eine verbindliche Berücksichtigung der durch Bürgerbeteiligung erarbeiteten
Ergebnisse durch die Regierung ist oft nicht gegeben. Somit ist für Politik und Zivilgesellschaft auch kaum
erkennbar, wie die Ergebnisse politische Entscheidungen beeinflussen.
Angesichts dieser Defizite stellt sich die Frage, wie bisher in anderen Ländern mit nationalen Beteiligungs-
verfahren mit den entsprechenden Herausforderungen umgegangen wurde. Für die Studie »Mehr
Brigitte Geißel, Stefan Jung: Ein Beteiligungsrat für dauerhafte Bürgerbeteiligung auf Bundes-ebene
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Seite 1________________________________________________________________________________________________
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Mitsprache wagen« haben wir unter anderem zwei Fallbeispiele genauer betrachtet: die Nationalen Poli-tik-
konferenzen in Brasilien und das irische Verfassungskonvent. Grund für die Fallauswahl waren bei den Nati-
onalen Politikkonferenzen, dass diese mit Blick auf die Beteiligung der Zivilgesellschaft eines der bisher um-
fassendsten Verfahren darstellten. Das irische Verfassungskonvent hat besonders hinsichtlich der Verbind-
lichkeit der Ergebnisse sowie der inklusiven Auswahl der Teilnehmer/innen neue Maßstäbe auf nationaler
Ebene gesetzt.
Nationale Bürgerbeteiligung im internationalen Vergleich
Bei den nationalen Politikkonferenzen in Brasilien und beim irischen Verfassungskonvent handelte es sich
um deliberative Verfahren, in denen Bürger/innen politische Themen unter fairen Gesprächsregeln diskutier-
ten und Empfehlungen an politische Entscheider/innen abgaben.
Eines der wohl umfangreichsten Beteiligungsverfahren waren die von der brasilianischen Regierung einberu-
fenen Nationalen Politikkonferenzen, die besonders von 2003 bis 2010 eine Hochphase erlebten. Nationale
Politikkonferenzen fanden zu einem im Vorhinein festgelegten Themenbereich (z.B. Gesundheitspolitik oder
Frauenrechte) statt und begannen mit lokalen Konferenzen in Städten und Gemeinden. Auf den lokalen Kon-
ferenzen konnten Bürger/innen Vorschläge zum Thema mit zivilgesellschaftlichen Vertreter/innen und Politi-
ker/innen diskutieren und Delegierte bestimmen. Die Teilnahme an den lokalen Konferenzen war im Allge-
meinen offen, d.h. jede/r Interessierte konnte teilnehmen und auch als Delegierte/r bestimmt werden (Pogre-
binschi 2014, S. 335). Die lokal bestimmten Delegierten brachten die Diskussionsergebnisse in Konferenzen
auf Ebene der Bundesstaaten ein. Auf diesen Konferenzen wurden die eingebrachten Vorschläge diskutiert
und Delegierte für die abschließende nationale Politikkonferenz bestimmt. Auf der nationalen Politikkonfe-
renz wurden die Vorschläge aus den vorangegangenen Konferenzen in einem Abschlussbericht zusammen-
gefasst und an die Regierung weitergegeben.
Durch die mehrstufige Gestaltung konnten sich hunderttausende Bürger/innen am Verfahren beteiligen,
meist dauerte der gesamte Prozess über ein Jahr. Da zivilgesellschaftliche Vertreter/innen frühzeitig an der
Planung des Prozesses beteiligt waren, kamen politische Themen auf die Agenda, die von der Politik ver-
nachlässigt waren (vgl. Pogrebinschi 2014). Während nationale Politikkonferenzen besonders zwischen
2003 und 2011 einen deutlichen politischen Einfluss hatten und von der Regierung stark gefördert wurden
(Pogrebinschi und Ryan 2018), zeigten die darauffolgenden Regierungen geringeres Interesse an den Poli-
tikkonferenzen. Trotz Bestrebungen der Zivilgesellschaft nationale Politikkonferenzen selbstständig zu orga-
nisieren, haben diese nicht mehr die Bedeutung vergangener Jahre erreicht (Tanscheit und Pogrebinschi
2017). Somit wurde auch deutlich, wie stark nationale Politikkonferenzen vom guten Willen der Regierung
abhängig waren.
Der irische Verfassungskonvent war ein Beteiligungsverfahren, das von 2012 bis 2014 zur Beratung einer
geplant Verfassungsreform tagte. Über zwei der vom Verfassungskonvent formulierten Empfehlungen zur
Verfassungsänderung wurde in Referenden abgestimmt. Der Verfassungskonvent bestand aus 66 Bürger/in-
nen, 33 Politiker/innen und einem Vorsitzenden, wobei die Bürger/innen zufällig ausgewählt wurden. Teil-
nehmen konnten alle ausgewählten Bürger/innen, die zur Abstimmung bei einem Referendum berechtigt wa-
ren (d.h. mindestens 18 Jahre alt, im Wahlregister eingetragen und irische/r Staatsbürger/in). Bei der
Brigitte Geißel, Stefan Jung: Ein Beteiligungsrat für dauerhafte Bürgerbeteiligung auf Bundes-ebene
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Seite 2________________________________________________________________________________________________
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Auswahl der Bürger/innen wurde zudem anhand von Quoten darauf geachtet, dass die Zusammensetzung
der Teilnehmer/innen annähernd repräsentativ für die irische Bevölkerung war. Die Regierung verpflichtete
sich vorab innerhalb von vier Monaten im Parlament Stellung zu den Empfehlungen beziehen. Bei den jewei-
ligen Treffen konnten die Teilnehmenden auf Expert/innen zurückgreifen. Darüber hinaus konnten alle Bür-
ger/innen über eine Website die Beratungen mitverfolgen und kommentieren.
Durch die Verbindung einer Zufallsauswahl der Teilnehmer/innen und Online-Beteiligungsmöglichkeiten für
die Bevölkerung konnte beim Verfassungskonvent eine Vielzahl von Interessen berücksichtigt und diskutiert
werden (vgl. Suiter u. a. 2016, S. 20). Die klare und rechtlich verbindliche Regelung des Umgangs mit den
Ergebnissen stellte sicher, dass diese berücksichtigt wurden (The Convention on the Constitution 2019). Al-
lerdings wurde der Verfassungskonvent, ähnlich wie die nationalen Politikkonferenzen, allein von der Regie-
rung bzw. dem Parlament eingeleitet und war damit von diesen abhängig.
Aus den beiden Fallbeispielen ziehen wir zusammengefasst folgende Schlüsse:
a) Festgelegtes Design: Ein klar umrissenes und in seinen Grundzügen festgelegtes Design der Beteili-
gungsverfahren ist wichtig, damit die Ergebnisse und der Umgang mit diesen nachvollziehbar sind. Damit
eine möglichst große Vielfalt an Interessen einbezogen werden kann, empfiehlt sich zum einen ein mehrstu-
figer Aufbau und zum anderen die Nutzung von Zufallsauswahl und Online-Beteiligung.
b) Einleitungsmöglichkeit für die Zivilgesellschaft: Wenn ausschließlich die Regierung Beteiligungsverfahren
einleiten kann, bleiben manche gesellschaftlich relevante Themen außen vor und auch die dauerhafte Nut-
zung des Beteiligungsverfahrens ist gefährdet. Darum sollten durch entsprechende Gesetze auch Zivilgesell-
schaft und Opposition Beteiligungsverfahren einleiten können.
c) Verpflichtende Stellungnahme: Damit der politische Einfluss eines Beteiligungsverfahrens für die Bür-
ger/innen erkennbar und nachvollziehbar wird, muss der Umgang mit den Ergebnissen klar festgelegt wer-
den. Deshalb sollten sich Regierung bzw. Parlament gesetzlich verpflichten, zu den Ergebnissen Stellung zu
nehmen.
Darauf aufbauend haben wir das Modell eines Beteiligungsrats entwickelt.
Ein Beteiligungsrat für die Bundespolitik
Beteiligungsräte sollen Bundestag und Bundesregierung sowohl vor Beginn als auch während des Gesetz-
gebungsprozesses unterstützen. Dies geschieht zum einen, indem gesellschaftliche Probleme und Heraus-
forderungen frühzeitig von Beteiligungsräten diskutiert werden und die Zivilgesellschaft wichtige Themen auf
die politische Agenda bringen kann. Zum anderen tragen Beteiligungsräte dazu bei, dass der Gesetzge-
bungsprozess transparenter wird und vielfältige gesellschaftliche Interessen berücksichtigt. Dieses Verfah-
ren stellen wir im Folgenden im Detail vor.
Ein Beteiligungsrat berät ein Thema immer in zwei Stufen (siehe Abbildung 1). Um die gesellschaftliche
Diversität auch unter den Teilnehmer/innen abzubilden, werden diese in beiden Stufen zufällig ausgewählt.
Hierfür wird zunächst eine gegenüber der anvisierten Teilnehmerzahl mindestens zehnmal größere Anzahl
von Bürger/innen nach dem Zufallsprinzip aus den Melderegistern ausgewählt und um eine Teilnahme
Brigitte Geißel, Stefan Jung: Ein Beteiligungsrat für dauerhafte Bürgerbeteiligung auf Bundes-ebene
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Seite 3________________________________________________________________________________________________
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
gebeten. Außerdem werden weitere Merkmale (z. B. Bildungsstand) abgefragt. An einem Beteiligungsrat
können neben volljährigen deutschen Staatsbürger/innen auch Jugendliche ab 14 Jahre sowie mindestens
drei Monate in Deutschland wohnhafte Ausländer/innen teilnehmen. Zudem ist es möglich weitere Gruppen
z. B. Geflüchtete oder Kinder im Rahmen der verschiedenen Verfahren gezielt zu rekrutieren. Im zweiten
Schritt werden aus den positiven Rückmeldungen die endgültigen Teilnehmer/innen nach bestimmten Merk-
malen (z.B. Alter, Geschlecht, Bildungsstand) ausgewählt und eingeladen. Um auch sozial Benachteiligten
und Minderheiten eine Teilnahme zu ermöglichen, kann ein zuvor bestimmtes Kontingent der Teilnehmer/in-
nen gezielt rekrutiert werden.
In der ersten Stufe sollen ein möglichst breites Spektrum gesellschaftlicher Interessen in die Diskussion mit-
einbezogen und daraus erste Empfehlungen zum Thema entwickelt werden. Deswegen findet die erste
Stufe über ein Online-Beteiligungsportal statt. Idealerweise nehmen mehrere hundert Teilnehmer/innen an
der Online-Beteiligung teil und diskutieren eine Woche lang gemeinsam mit Politiker/innen über das Thema.
Die Teilnehmer/innen werden in Online-Diskussionsrunden bestehend aus ca.10 bis 20 Personen aufgeteilt,
damit jede/r mitdiskutieren kann. Sie werden bei inhaltlichen Fragen von Expert/innen unterstützt. Zudem
wird die Diskussion von Moderator/innen strukturiert und begleitet, womit eine ausgewogene und zielfüh-
rende Debatte ermöglicht werden soll.
Quelle: Geißel und Jung (2019, S. 33), geringfügig modifiziert.
Abbildung 1 Die zwei Stufen des Beteiligungsrats
Die zweite Stufe dient zur Sammlung, Ergänzung und Priorisierung der Empfehlungen aus der ersten Stufe.
Ziel ist es, einen Beratungsbericht zu erstellen, der an die Bundesregierung oder den Bundestag übermittelt
wird. Hierfür werden 100 Bürger/innen zufällig ausgewählt, die an einem Wochenende bei einer
Brigitte Geißel, Stefan Jung: Ein Beteiligungsrat für dauerhafte Bürgerbeteiligung auf Bundes-ebene
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Seite 4________________________________________________________________________________________________
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Beratungstagung zusammenkommen. In kleineren Arbeitsgruppen werden die einzelnen Empfehlungen dis-
kutiert und es können Expert/innen angehört werden. Die Dauer der beiden Stufen kann je nach Umfang und
Komplexi-tät des Themas auch verlängert werden.
Beteiligungsräte sollten sowohl von der Bundesregierung, dem Bundestag als auch der Zivilgesellschaft ein-
geleitet werden können (siehe Abbildung 2). Damit kann eine möglichst große Bandbreite an gesellschaftli-
chen Themen von Beteiligungsräten diskutiert werden. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass die
Themen eine gewisse gesellschaftliche Relevanz haben. Deshalb sind für die Einleitung durch Zivilgesell-
schaft und Bundestag Quoren, d.h. ein Mindestanteil der Bevölkerung bzw. der Abgeordneten, nötig.
Beteiligungsräte sollen jedoch nicht nur vor, sondern auch während des Gesetzgebungsprozesses von Bun-
destag und Zivilgesellschaft stattfinden. So wird der Bundestag beraten und der Gesetzgebungsprozess in-
klusiver und transparenter gestaltet. Beteiligungsräte ergänzen die bestehenden öffentlichen Anhörungen in
den Bundestagsausschüssen.
Design, Ablauf und insbesondere der Umgang mit den Empfehlungen der Beteiligungsräte sollten gesetzlich
verankert werden. Damit soll ein gewisses Maß an Kontinuität von Beteiligungsräten auch bei Regierungs-
wechseln gewährleistet werden.
Quelle: Geißel und Jung (2019, S. 29), geringfügig modifiziert.
Abbildung 2 Das Modell eines Beteiligungsrats
Brigitte Geißel, Stefan Jung: Ein Beteiligungsrat für dauerhafte Bürgerbeteiligung auf Bundes-ebene
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Seite 5________________________________________________________________________________________________
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Darüber hinaus ist die Einrichtung von drei ergänzenden Organen notwendig, um eine dauerhafte Nutzung
von Beteiligungsräten zu ermöglichen.
Eine Koordinationsstelle, die Teil der Bundestagsverwaltung ist, soll eine professionelle und unabhängige
Organisation und Durchführung der Beteiligungsräte gewährleisten. Sie übermittelt die Empfehlungen eines
Beteiligungsrats an Bundesregierung und Bundestag und stellt sicher, dass diese zu den Empfehlungen
Stellung nehmen.
Die Koordinationsstelle wird durch einen Beirat bestehend aus zivilgesellschaftlichen Organisationen und
den im Bundestag vertretenen Parteien beraten und unterstützt. Der Beirat stellt sicher, dass die Koordinati-
onsstelle bei der Auswahl der Teilnehmer/innen und Expert/innen der gesellschaftlichen Diversität Rechnung
getragen und Beteiligungsräte kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Die Empfehlungen der Beteiligungsräte sowie die Stellungnahmen der Bundesregierung bzw. des Bundes-
tags werden auf einem Online-Beteiligungsportal veröffentlicht. Das Beteiligungsportal wird von der Koordi-
nationsstelle betreut. Bürger/innen finden hier weiterhin aktuelle Informationen zu allen laufenden und ge-
planten Gesetzesvorhaben. Auf dem Beteiligungsportal findet auch die Online-Beteiligung der Beteiligungs-
räte statt und Bürger/innen können eine Initiative für einen Beteiligungsrat starten. Zuletzt sollte es auch für
alle Bürger/innen eine Möglichkeit geben, die Empfehlungen der Beteiligungsräte zu kommentieren und zu
priorisieren.
Fazit
Die derzeitigen Defizite der Bürgerbeteiligung auf Bundesebene verlangen nach dauerhaft institutionalisier-
ten Beteiligungsverfahren. Die Beispiele der Nationalen Politikkonferenzen in Brasilien und des irischen Ver-
fassungskonvents geben hierfür aufschlussreiche Hinweise und zeigen, welche Anforderungen eine dauer-
hafte Bürgerbeteiligung auf nationaler Ebene erfüllen muss. In der Studie »Mehr Mitsprache wagen« (Geißel
und Jung 2019) haben wir darauf aufbauend das Modell eines Beteiligungsrats entwickelt. Ein Beteiligungs-
rat berät Bundestag und Bundesregierung vor und während des Gesetzgebungsprozesses. Mit einem zwei-
stufigen Design mit Zufallsauswahl, Einleitungsmöglichkeiten für die Zivilgesellschaft und einer gesetzlich
verankerten Pflicht zur Stellungnahme durch Bundesregierung und Bundestag werden die beschriebenen
Anforderungen erfüllt. Ein Beteiligungsrat kann so die Gesetzgebung effektiver, inklusiver und transparenter
gestalten.
Die gesamte Studie »Mehr Mitsprache wagen. Ein Beteiligungsrat für die Bundespolitik« kann unter
https://www.fes.de/studie-beteiligung abgerufen werden.
Brigitte Geißel, Stefan Jung: Ein Beteiligungsrat für dauerhafte Bürgerbeteiligung auf Bundes-ebene
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Seite 6________________________________________________________________________________________________
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Literatur
▪ Geißel, Brigitte/Jung, Stefan (2019): Mehr Mitsprache wagen: ein Beteiligungsrat für die Bundesrepublik,
Bonn, Online unter: Friedrich-Ebert-Stiftung https://www.fes.de/studie-beteiligung (letzter Zugriff:
29.06.2020).
▪ Pogrebinschi, Thamy (2014): Partizipation in Brasilien, In: Bertelsmann-Stiftung/Staatsministerium Ba-
den-Württemberg (Hrsg.): Partizipation im Wandel: unsere Demokratie zwischen Wählen, Mitmachen
und Entscheiden, Gütersloh, S. 327–354.
▪ Pogrebinschi, Thamy/Ryan, Matt (2018): Moving beyond input legitimacy: When do democratic innovati-
ons affect policy making? In: European Journal of Political Research 57 (1), S. 135–152.
▪ Suiter, Jane/Farrell, David M./Harris, Clodagh (2016): The Irish Constitutional Convention: A Case of
„High Legitimacy“?, In: Min Reuchamps/Jane Suiter (Hrsg.): Constitutional deliberative democracy in Eu-
rope, Colchester, United Kingdom, S. 33–52.
▪ Tanscheit, Talita/Pogrebinschi, Thamy (2017): Moving Backwards: What Happened to Citizen Participa-
tion in Brazil?, Online unter: openDemocracy, https://www.opendemocracy.net/en/democraciaa-
bierta/moving-backwards-what-happened-to-citizen-part/ (letzter Zugriff: 01.07.2019).
▪ The Convention on the Constitution (2019): Constitutional Convention, Online unter: Summary of Re-
ports & Recommendations, http://www.constitutionalconvention.ie/Recommendations.aspx (letzter Zu-
griff: 04.07.2019).
Autor/innen
Prof. Dr. Brigitte Geißel lehrt und forscht am Institut für Politikwissenschaft der Goethe Universität Frank-
furt am Main und leitet dort die Forschungsstelle »Demokratische Innovationen«. Schwerpunkte ihrer Arbeit
sind neue Demokratieformen und die Zukunft der Demokratie.
Stefan Jung ist Doktorand am Institut für Politikwissenschaft der Goethe Universität Frankfurt am Main.
Schwerpunkte seiner Arbeit sind direkte Demokratie, soziale Ungleichheit und lokale Politik.
Kontakt
E-Mail Prof. Dr. Brigitte Geißel: geissel@soz.uni-frankfurt.de
E-Mail Stefan Jung: stefan.jung@stud.uni-frankfurt.de
Website der Forschungsstelle »Demokratische Innovationen«: www.demokratische-innovationen.de
Brigitte Geißel, Stefan Jung: Ein Beteiligungsrat für dauerhafte Bürgerbeteiligung auf Bundes-ebene
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Seite 7________________________________________________________________________________________________
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Redaktion eNewsletter
Netzwerk Bürgerbeteiligung
c/o Stiftung Mitarbeit
Redaktion eNewsletter
Ellerstraße 67
53119 Bonn
E-Mail: newsletter@netzwerk-buergerbeteiligung.de
Brigitte Geißel, Stefan Jung: Ein Beteiligungsrat für dauerhafte Bürgerbeteiligung auf Bundes-ebene
eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2020 vom 02.07.2020
Seite 8Sie können auch lesen