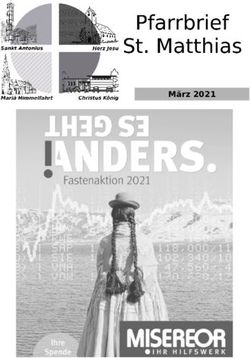Elektroplaner/-in EFZ Interner Schullehrplan
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Scalettastrasse 33
7000 Chur
Telefon 081 254 45 16
info@gbchur.ch
www.gbchur.ch
Elektroplaner/-in EFZ
Interner SchullehrplanElektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 2
-in EFZ
Grundlagen: Verordnung über die berufliche Grundbildung vom 27.04.2015
Bildungsplan des VSEI vom 27.04.2015
Lehrplan für Berufsfachschulen des VSEI vom 1.8.2015
Lektionentafel der GBC (nicht im Schullehrplan integriert)
Die allgemeine schulische Bildung (ABU) und der Unterricht im
Turnen + Sport werden nach den jeweils gültigen internen Schul-
lehrplänen dieser Bereiche erteilt. Diese Lehrpläne sind separat
verfügbar.
Freigabe: Reto Peng am 1. Juni 2016
Verantwortlich Schulleitung: R. Peng, Vizedirektor
Nachführung: Hansruedi Liechti, Lehrperson berufskundliche schulische Bil-
dung
Version Änderungsdatum Änderungsgrund betroffene Seiten
Personen- und Berufsbezeichnungen in diesem „Internen Schullehrplan“ beziehen sich auf
beide Geschlechter.
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 3
-in EFZ
Inhaltsverzeichnis
Technologische Grundlagen Bereich Elektrotechnik, Elektronik 4
Technologische Grundlagen Bereich erweiterte Fachtechnik Physik 8
Technologische Grundlagen Bereich Mathematik 9
Bearbeitungstechnik Bereich Werkstoffkunde und Arbeitssicherheit 10
Bearbeitungstechnik Bereich Chemie 11
Planungsunterlagen und technische Dokumentation Bereich Anlagendokumentation 12
Planungsunterlagen und technische Dokumentation Bereich Regeln der Technik 14
Kommunikationstechnik 17
Übergreifende Bildungsthemen 19
Elektrische Systemtechnik 20
Beschreibung der Taxonomiestufen 24
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 4
-in EFZ
Technologische Grundlagen Bereich Elektrotechnik, Elektronik
Lektionenverteilung über alle Semester:
1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. 7. Sem. 8. Sem. Total Lektionen
90 70 40 60 0 0 0 0 260
Qualifikation:
Die Durchschnittsnote aus diesem Bereich ist im ersten und zweiten Semester Teil der Zeugnisnote
Technologischen Grundlagen. Gewichtung: Elektrotechnik 3-fach; Mathematik 2-fach; Physik 1-fach
Lernziel Informationsziele K-Stufe Lektionen
Grundlagen
Das Wesen der Elektrizität mit Hilfe des Atomaufbaus erklä- 2 5
ren.
Die Begriffe Spannung, Widerstand und Strom im Stromkreis 2 5
erklären und die gebräuchlichen Einheiten nennen.
Die gebräuchlichen Leiter, Halbleiter und Nichtleiter nennen 1 2
sowie ihre Eigenschaften und Anwendungen auf zählen.
Stromfluss in festen flüssigen und gasförmigen Stoffen erklä- 2 4
ren.
Arten und Anwendung der Erzeugung elektrischer Spannun- 2 4
gen beschreiben.
Wirkungen und Anwendungen der elektrischen Energie nen- 2 4
nen und erklären.
Wechsel- und Gleichstrom unterscheiden können, Formen und 1 2
typische Anwendungen nennen können.
Stromdichte erklären und berechnen. 2 3
Das ohmsche Gesetz rechnerisch anwenden. 3 6
1. Semester
Widerstände von Leitern und Widerstandsänderungen infolge 3 10
Erwärmung berechnen.
Die Begriffe Arbeit, Leistung, einfacher und mehrfacher Wir- 3 10
kungsgrad in Energieumformungssystemen kennen und be-
rechnen.
Die Zusammenhänge zwischen den Leistungsformeln und 3 4
dem ohmschen Gesetz aufzeigen und rechnerisch anwenden.
Elektrische Leistungen aufgrund von Zählerablesungen be- 2 2
rechnen.
Die verschiedenen Gewinnungsmöglichkeiten der elektrischen 2 6
Energie nennen und erklären können. Erneuerbar und nicht
erneuerbare Energieformen unterscheiden können. Die Begrif-
fe Bandenergie und Spitzenenergie erklären.
Den Anschluss von Volt-, Ampere-, Watt- und Ohmmeter er- 2 3
klären.
Widerstandsschaltungen
Spannungs-, Strom- und Leistungsverhältnisse sowie Ersatz- 3 10
widerstand bei Serieschaltung erklären und berechnen sowie
Anwendungen davon nennen.
Spannungs-, Strom- und Leistungsverhältnisse sowie Ersatz- 3 10
widerstand bei Parallelschaltung erklären und berechnen so-
wie Anwendungen davon nennen.
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 5
-in EFZ
Lernziel Informationsziel K-Stufe Lektionen
Widerstandsschaltungen
Spannungs-, Strom- und Leistungsverhältnisse sowie Ersatz- 3 10
widerstand bei gemischten Schaltungen berechnen.
Anwendungen gemischten Schaltungen erklären. (Spannungs- 3 10
teiler, Brückenschaltung).
Messungen in gemischten Schaltungen praktisch durchführen 2 5
können.
Spannungsabfall auf Leitungen mit ohmschem Widerstand 3 8
berechnen und die Bedeutung für die Leitungsdimensionie-
rung erklären.
Magnetismus
Den Unterschied zwischen magnetischen und nichtmagneti- 1 2
schen Stoffen erklären.
Eigenschaften von magnetisch harten und magnetisch weichen 1 1
2. Semester
Werkstoffen erläutern und Anwendungen nennen.
Den Verlauf der magnetischen Feldlinien an Magneten auf- 1 3
zeichnen.
Den Zusammenhang zwischen Strom- und Magnetfeldrichtung 2 5
bei Elektromagneten aufzeigen und den Verlauf des Magnetfel-
des beziehungsweise der Stromrichtung aufzeichnen.
Durchflutungen berechnen und die magnetische Begriffe Feld- 2 6
stärke, Induktion, magnetische Sättigung erläutern.
Die gössen Stromrichtung, Magnetfeldrichtung sowie Kraftrich- 1 4
tung in Anwendungen kombinieren. Motorprinzip.
Anwendungen von Dauer- und Elektromagneten erklären. 1 2
Induktion
Die Begriffe Induktion und Selbstinduktion erklären, die Vor- 2 8
gänge beschreiben und Anwendungen erläutern. Trafoprinzip
und Generatorprinzip.
Den Begriff Induktivität sowie deren Abhängigkeit erklären und 2 4
anwenden.
Die Entstehung und Wirkung von Wirbelströmen sowie Mass- 2 2
nahmen zu deren Unterdrückung erläutern.
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 6
-in EFZ
Lernziel Informationsziel K-Stufe Lektionen
Elektrochemie
Die Begriffe Elektrolyt und Elektrolyse sowie Anwendungen 1 3
davon erklären.
Aufbau, Wirkungsweise und Daten von Primär- und Sekundä- 2 4
relementen erklären und Anwendungen können.
Die Kapazität von chemischen Spannungsquellen rechnerisch 2 2
anwenden.
Schaltungen von chemischen Spannungsquellen zeichnen und 3 4
unter Berücksichtigung der Innenwiderstände berechnen.
Brennstoffzellen bezüglich Input Output erklären können. 1 2
Elektrisches Feld / Kondensator
3. Semester
Aufbau, Arten und Wirkungsweise von Kondensatoren erläu- 1 2
tern (geometrische Abmessungen Materialwerte).
Den Begriff der Kapazität erklären. 1 1
Schaltungen von Kondensatoren zeichnen und berechnen. 2 3
Kondensator im Gleichstromkreis bei Ein- Ausschaltung be- 2 4
rechnen können (Zeitkonstante). Lade- und Entladekurven an-
wenden.
Elektronik
Arten von Widerständen unterscheiden und Anwendungen auf- 1 3
zählen.
Die Funktion erläutern und Verwendungen erklären von: 2 8
- Dioden, Gleichrichterschaltungen, LED, Z-Diode
- Transistor, Thyristor, Triac, photovoltaische Elemente.
Einfachen Dimmer für ohmsche Verbraucher erklären können. 2 2
Aufbau und Funktion eines einfachen Netzgerät 230V AC 12V 2 2
DC erklären.
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 7
-in EFZ
Lernziel Informationsziel K-Stufe Lektionen
Wechselstrom (Einpolig)
Die Entstehung einer Wechselspannung erklären und den zeit- 1 2
lichen Verlauf (Sinuskurve) grafisch darstellen
Die Wechselstromgrössen Frequenz, Periodendauer, Scheitel- 1 2
und Effektivwert erklären. Arithmetischer Mittelwert, Quadrati-
scher Mittelwert TRMS.
Drehfrequenz, Polzahl und Frequenz miteinander in Beziehung 1 2
setzen und Berechnungsbeispiele lösen.
Die Wirkung von Spulen und Kondensatoren im Wechselstrom- 2 6
kreis erklären. Impedanzdreieck erklären können. Einfache
Berechnungen machen (R L X L Z).
Die Phasenlage zwischen Spannung und Strom bei ohmschen, 2 4
induktiven und kapazitiven Verbrauchern am Wechselstromnetz
mit Hilfe des Linien- und Zeigerdiagramms erklären.
Die Impedanzen von Induktivitäten und Kapazitäten aus Strom 2 2
und Spannung berechnen.
Die Zusammenhänge zwischen Schein-, Wirk- und Blindleis- 3 2
tung sowie Leistungsfaktor am Leistungsdreieck aufzeigen und
4. Semester
berechnen.
Schein-, Wirk- und Blindleistung sowie Leistungsfaktor von 2 6
verschiedenen Verbrauchern kennen und berechnen.
Schaltungen mit 3 Elementen berechnen und Anwendungen 2 3
davon nennen.
Möglichkeiten zur Kompensierung von Blindleistung erklären 2 3
und grafisch darstellen.
Die Bedeutung der Kompensation in Bezug auf die Verminde- 2 2
rung des Stromes erklären.
Netzfreischalter: Funktionsweise und Anwendung erläutern. 1 2
Drehstromerzeugung 2 6
Die Entstehung der dreiphasigen Spannung im Generator
erklären und den Spannungsverlauf mit Hilfe des Linien- und
Zeigerdiagramms darstellen.
Das Normspannungsnetz mit Neutral- und Schutzleiter nach
begründen.
Drehstromberechnungen 2 10
Spannungs- und Stromverhältnisse für die Stern- und Drei-
eckschaltung rechnerisch bestimmen (symmetrisch).
Die Zusammenhänge zwischen Schein-, Wirk- und Blindleis-
tung sowie den Leistungsfaktor beim Drehstrom aufzeigen
und berechnen.
Berechnungen bei Kompensationsanlagen
Repetition sämtlicher Stoffgebiete 8
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 8
-in EFZ
Technologische Grundlagen Bereich erweiterte Fachtechnik Physik
Lektionenverteilung über alle Semester:
1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. 7. Sem. 8. Sem. Total Lektionen
20 20 0 0 0 0 0 0 40
Qualifikation:
Die Durchschnittsnote aus diesem Bereich ist Teil der Zeugnisnote Technologischen Grundla-
gen. Gewichtung: Elektrotechnik 3-fach; Mathematik 2-fach; Physik 1-fach
Lernziel Informationsziele K-Stufe Lektionen
Internationales Einheitensystem (SI)
Übersicht über die Basisgrössen die abgeleiteten Einheiten 1 4
Bewegungslehre 2 10
1. Semester
die Beziehungen zwischen Weg, Zeit und Geschwindigkeit für
gleichförmige geradlinige und gleichförmige Kreisbewegung
aufzeigen sowie Berechnungsaufgaben dazu lösen.
grafische Darstellungen von Weg-Zeit- und Geschwindigkeits-
Zeit Diagrammen
erstellen und interpretieren können.
die Begriffe Beschleunigung und Fallbeschleunigung erklären
Kraft, Drehmoment, mechanische Arbeit und Leistung
die Begriffe erklären 1 2
mechanische Energie, potentielle Energie, mechanische Leis- 2 6
tung erklären können
W Fs W mgh
mgh
P F v P P M 2 n
t
P M
an praktischen Beispielen Berechnungsaufgaben lösen, unter 2 6
Berücksichtigung der Einfach- und Mehrfachwirkungsgrade
(Koordination mit Fachlehrer)
2. Semester
Wärmelehre
die Temperaturskalen Celsius und Kelvin vergleichen und 1 1
umrechnen
die Begriffe Temperatur und Wärmemenge erklären und die 1 1
Einheiten zuordnen
den Begriff spezifische Wärmekapazität erläutern und Be- 2 4
rechnungsaufgaben lösen
Aggregatszustände und die Übergänge Verdampfen und Kon- 2 4
densieren kennen
Mechanik der Flüssigkeiten und Gase 1 2
den Begriff hydrostatischer Druck erklären
den Begriff Gasdruck erklären
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 9
-in EFZ
Technologische Grundlagen Bereich Mathematik
Lektionenverteilung über alle Semester:
1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. 7. Sem. 8. Sem. Total Lektionen
40 40 0 0 0 0 0 0 80
Qualifikation:
Die Durchschnittsnote aus diesem Bereich ist Teil der Zeugnisnote Technologischen Grundla-
gen. Gewichtung: Elektrotechnik 3-fach; Mathematik 2-fach; Physik 1-fach
Lernziel Informationsziele K-Stufe Lektionen
Allgemeine Zahlen
addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren 2 10
Klammerausdrücke auflösen 2 8
Gleichungen 2 10
Gleichungen, wie sie in den Fächern dieses Lehrplanes ver-
wendet werden, umformen
1. Semester
Massvorsätze 2 6
Buchstabensymbole für dezimale Vielfache und Teile von
Einheiten nach dem internationalen Maßsystem (SI) nennen
und verwandeln.
Zehnerpotenzen 2 5
Beim Rechnen mit großen und kleinen Zahlenwerten zur si-
cheren Stellenwertbestimmung anwenden
Pythagoreischer Lehrsatz 2 4
Längen am rechtwinkligen Dreieck berechnen
Grafische Darstellungen 2 8
Graphische Darstellungen im rechtwinkligen Koordinatensys-
tem deuten und solche Darstellungen aufgrund von Daten
selbständig aufzeichnen
Trigonometrische Funktionen
Winkel und Seitenlängen am rechtwinkligen Dreieck mit Hilfe 2 8
der Sinus und Cosinusfunktion bestimmen 2. Semester
Sinus- und Cosinusfunktionen im Einheitskreis darstellen und 2 4
erklären sowie Kurven aufzeichnen
Vektorielles Rechnen 2 8
Grafische Addition und Subtraktion von Vektoren ausführen
können.
Geometrisches Rechnen
Flächen, Volumen und Masse berechnen 2 5
Logische Operationen 4
Grundoperationen der Logik: AND, OR, NOT anwenden 2
Duales Zahlensystem erklären 1
Wahrheitstabellen 1
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 10
-in EFZ
Bearbeitungstechnik Bereich Werkstoffkunde und Arbeitssicherheit
Lektionenverteilung über alle Semester:
1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. 7. Sem. 8. Sem. Total Lektionen
20 20 0 0 0 0 0 0 40
Qualifikation:
Die Durchschnittsnote aus diesem Bereich ist Teil der Zeugnisnote der Bearbeitungstechnik.
Gewichtung Semester 1: Chemie 2-fach; Werkstoffkunde 1-fach
Gewichtung Semester 2: Chemie 1-fach; Werkstoffkunde und Arbeitssicherheit 2-fach
Lernziel Informationsziele K-Stufe Lektionen
Werkstoffarten unterscheiden: Metalle, Nichtmetalle Kunst- 1 1
stoffe
Die für den Beruf relevanten Werkstoffeigenschaften erklären. 1 2
1. Semester
Die mechanischen Beanspruchungsarten Zug, Druck, Bie- 1 2
gung, Scherung, Torsion (Verdrehung) unterscheiden.
Anhand berufsbezogener Anwendungsbeispiele die Eigen- 1 3
schaften und Verwendung der gebräuchlichen Metalle (Fe,
Cu, Al , Ni, Sn ,Zn, Hg, Pb , Au, Ag, W, Cr) und Hartmetalle
aufzeigen und erläutern.
Den Begriff und den Zweck des Legierens an berufsbezoge- 1 2
nen Beispielen erklären.
Den Begriff Verbundwerkstoff an berufsbezogenen Beispielen 1 2
erklären.
Natürliche und künstliche Isolierstoffe, die im Elektroinstallati- 1 5
onsgewerbe verwendet werden, nennen und ihre Eigenschaf-
ten erläutern.
2. Semester
Die Weisungen der VREG erläutern können. Besuch eines 1 5
Recycling Unternehmens.
Ein Bewusstsein für den Umgang mit Elektroabfall entwickeln. 2 2
Ein Bewusstsein für das Vermeiden von Arbeitsunfällen ins- 2 3
besondere Elektrounfällen entwickeln.
Die 5+5 Sicherheitsregeln vor Arbeiten an elektrischen Anla- 1 3
gen erklären und anwenden.
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 11
-in EFZ
Bearbeitungstechnik Bereich Chemie
Lektionenverteilung über alle Semester:
1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. 7. Sem. 8. Sem. Total Lektionen
20 20 0 0 0 0 0 0 40
Qualifikation:
Die Durchschnittsnote aus diesem Bereich ist Teil der Zeugnisnote der Bearbeitungstechnik.
Gewichtung Semester 1: Chemie 2-fach; Werkstoffkunde 1-fach
Gewichtung Semester 2: Chemie 1-fach; Werkstoffkunde und Arbeitssicherheit 2-fach
Lernziel Informationsziele K-Stufe Lektionen
1. Semester
Physikalische und chemische Vorgänge unterscheiden 1 2
Die Begriffe Element und Verbindung erklären. 1 3
Die Einteilung der Elemente anhand des Periodensystems er- 1 3
klären.
Die chemischen Bindungsarten unterscheiden. 1 4
An praktischen Beispielen Sauerstoff- und Kohlenstoffverbin- 1 4
dungen aufzeigen sowie ihre Entstehung und Eigenschaften er-
läutern.
Oxidations- und Reduktionsvorgänge an berufsbezogenen Bei- 1 4
2. Semester
spielen erläutern.
(elektrochemische Korrosion innerhalb der Elektrochemie beim
Fachlehrer)
Korrosionsschutzmassnahmen und deren Anwendung kennen 1 4
(galvanisieren innerhalb der Elektrochemie beim Fachlehrer)
Kennzeichnung und Umgang von Gefahrenstoffen und deren 1 6
Entsorgung kennen.
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 12
-in EFZ
Planungsunterlagen und technische Dokumentation
Bereich Anlagendokumentation
Lektionenverteilung über alle Semester:
1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. 7. Sem. 8. Sem. Total Lektionen
0 0 40 20 20 20 20 0 120
Lernziel Informationsziele K-Stufe Lektionen
Einführung, Sinn und Zweck 1 2
Symbole und deren Beschriftung 1 4
Zur Vereinheitlichung der Symbolik stützt sich die Ausbildung auf das
Handbuch "Symbole für die Elektrotechnik". Bezugsquelle:
www.electrosuisse.ch)
3. Semester
Anlagendokumentation, Schemaarten 1 2
Wirkschaltschema, Stromlaufschema, Prinzipschema, An-
schlussschema, Installationsplan, Anlagebeschreibungen: Er-
kennen und Zweck beschreiben
Lichtanlagen
Schaltungen Sch 0, Sch 3, Sch 6 und Steckdosen 2 6
Schaltungen mit Schrittschaltrelais, Zeitrelais, Bewegungsmel- 2 6
der, Dämmerungsschalter, Schaltuhr in Wohn- und allgemei-
nen Räumen
Schwachstromanlagen
Sonnerieschaltungen, Chefbüro Anmeldung, 2 5
Rufschaltungen
Alarmanlagen mit Ruhestrom und Arbeitsstromprinzip, Batte- 2 5
rieschaltungen
Relaisschaltungen 10
Prinzip von Schütz und Relais 1
3. Semester
Kontaktnummerierungssystem bei Schützten Anschlussstellen 1
Dauer- und Impulskontaktsteuerungen 2
Mehrere Schaltstellen, Selbsthaltung, Prioritäten, 2
Meldeleuchten
Zeitrelaisschaltungen, Einschalt- und Ausschalt- 2
verzögert
Relaisschaltungen aufgrund von Funktionsbe- 2
schreibungen erstellen
Funktion von Relaisschaltungen beschreiben und analysieren 2
mittels Erstellen von Funktionsbeschreibungen und mittels
Zeitdiagrammen
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 13
-in EFZ
Lernziel Informationsziel K-Stufe Lektionen
Motorensteuerungen
Schemas für Installationen von Motorenanlagen mit Schaltern 2 3
4. Semester
und Schützen analysieren und bearbeiten.
Sterndreiecksteuerungen in Varianten 2 3
Umkehrsteuerungen mit Umschaltverzögerungen 2 4
Sterndreiecksteuerungen mit Umkehrsteuerungen kombiniert 2 3
Steuerungen zur Drehzahlveränderung 2 4
Steuerungen mit Einphasenmotoren 2 3
Speicherprogrammierbare Steuerungen 10
Idee, Prinzip und Grundlagen zu SPS kennen 1
Die logischen Funktionen UND, ODER, NICHT, NOR und 2
NAND anwenden
Einfache Verknüpfungen erklären und die entsprechende 2
Wahrheitstabelle erstellen
5. Semester
Einfache Programme interpretieren, eingeben und testen. 2
Einfache Anwendungsbeispiele mit SPS Steuerungen lösen. 2
Erstellen der entsprechenden Anlagendokumentation 1
Gebäudeautomation / Bussysteme 10
Prinzip erklären und wichtigste Elemente nennen 1
Verdrahtungsprinzip aufzeichnen 1
Bus-Anwendungsbeispiele aufzählen: EIB/KNX, Feldbusse 1
Anschlussschemas von einfachen Bussystemen interpretieren. 1
Wärmeanlagen 5
Kochherd, Boiler, Heizlüfter analysieren und bearbeiten 2
Schemas für Wärmeapparate bearbeiten
6. Semester
2
Messschaltungen 5
Anlagendokumentationen mit Messgeräten (Voltmeter, Am- 2
peremeter, Wattmeter, Energiezählern) bearbeiten
Komplexe Stromlaufschemas aus allen Teilgebieten 3 10
Elektronikschaltungen 4
Schaltungen mit Dioden, Thyristoren, Triac und Diac 1
Anschlussschemas einfacher elektronischer Anlagen interpre- 1
tieren.
Mit speicherprogrammierbaren Steuerungen ausgeführte Schal- 2
7. Semester
tungen erklären.
Repetition
Repetition sämtlicher Stoffgebiete 2 8
Vorbereitung auf das Qualifikationsverfahren 8
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 14
-in EFZ
Planungsunterlagen und technische Dokumentation
Bereich Regeln der Technik
Lektionenverteilung über alle Semester:
1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. 7. Sem. 8. Sem. Total Lektionen
0 0 20 20 20 20 20 20 120
Lernziel Informationsziele K-Stufe Lektionen
Einführung, Sinn und Zweck, gesetzliche Grundlagen 1 3
Die wichtigsten Artikel der NIV kennen und anwenden
3. Semester
2 8
- Allgemeine Bestimmungen
- Bewilligungen für Installationsarbeiten
- Ausführung von Installationsarbeiten
- Installationskontrolle
- Anhang
Gliederung der NIN kennen und Suchübungen durchführen 2 7
Kapitel 1 NIN: Geltungsbereich und Grundsätze kennen und 2 4
anwenden
Kapitel 2 NIN: Die wichtigsten Begriffe erklären können 2 2
Kapitel 3 NIN: Die wichtigsten Zuordnungen aus dem Bereich 1 6
Klassifizierung der äusseren Einflüsse kennen , insbesondere
das IP-System
Die Grenzwerte bei den Personenschutzmassnahmen kennen 2 4
und die entsprechenden Maßnahmen zuordnen
4. Semester
Die Wirkungsweise folgender Schutzmassnamen genau 2 6
erklären können
- Isolierter Standort
- Sonderisolierung
- Schutzkleinspannung
- Schutztrennung
- Begründung der Netzerdung
- Schema TN generell (TN-C, TN-S, TN-CS)
- einfache Berechnungen von Berürhungspannungen
- Schutzpotenzialausgleich
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 15
-in EFZ
Lernziel Informationsziele K-Stufe Lektionen
Schutzmassnahmen
Schutzpotenzialausgleich 2 5
Fehlerstromschutzschaltung
zusätzlicher Potenzialausgleich
Richtlinien für die Installation von Telekommunikationsanla-
gen RIT
Kapitel 1:
Grundlagen und Geltungsbereich der RIT aufzählen. 1 1
Aspekte der Arbeitssicherheit (LWL, Laser, Feuerschutz) be- 2 1
schreiben.
5. Semester
Kapitel 2:
Die unterschiedlichen Gebäudeerschliessungen aufzählen. 1 2
Kapitel 3:
Grundlagen von Multimedia – Installationen im Wohnungs- 2 3
bau beschreiben
Kapitel 4:
Grundlagen einer Gebäudeverkabelung erklären. 2 3
Relevante Punkte für die Ausführung und Betrieb befolgen. 3 3
Die Lernenden verdeutlichen die Aspekte und den Kun- 1 2
dennutzen einer Installation nach den EMV -Richtlinien.
Die normengerechte Anwendung und Ausführung der Perso- 2 2
nenschutzmassnahmen kennen. Auch Anordnung und Dimen-
6. Semester
sionierung von PEN, N , PE, PA ,EL
Aufbau, Funktionsweise, Daten und Anwendung von Überstro- 2 8
munterbrecher erläutern 8
Wichtige Inhalte des Kapitels N6 kennen und anwenden Sicht- 2 10
prüfung, Isolationsmessung, Leitfähigkeitsprüfung, rechtzeiti-
ges Abschalten
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 16
-in EFZ
Lernziel Informationsziel K-Stufe Lektionen
Die Leiterdimensionierung (Überlast und Kurzschluss) vom 2 5
Grundsatz und von den Einflussfaktoren her erklären können.
- Möglichkeiten für den Überlastschutz anwenden
- Möglichkeiten für den Kurzschlussschutz anwenden
Die Polleiterdimensionierung an einfachen Beispielen aufzei- 2 5
7. Semester
gen
Normenorganisationen 1 10
Die lernenden nennen die für den Beruf relevanten Nor-
menorganisationen und erläutern deren Zweck
- Internationale Organisationen: ISO, IEC, EN
- Nationale Organisationen: SN, DIN; SIA (108,112,380/4)
Die Lernenden erklären den Ablauf eines Kun-
denauftrags nach den Vorgaben der SIA108.
Effizientes Bauen (Norm SIA 380/4, Minergie,
Passivhaus, u.a.)
Die Normen betreffend Wahl und Anordnung von Schaltern und 1 6
8. Semester
Steckvorrichtungen anwenden können.
Die Überhitzungsschutzmassnahmen bei Motoren und Umluft- 2 4
heizungen kennen.
Die Lernenden erläutern den Zweck der NISV-Richtlinien. 1 1
Repetition und Vorbereitung Qualifikationsverfahren 2 9
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 17
-in EFZ
Kommunikationstechnik
Lektionenverteilung über alle Semester:
1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. 7. Sem. 8. Sem. Total Lektionen
0 0 0 0 20 20 20 20 80
Lernziel Lerninhalte K-Stufe Lektionen
Systemübersicht (6)
Analoge und digitale Signalformen erklären und grafisch 2
2
darstellen.
Die unterschiedlichen Signale – Übertragungsmedien mit 1
deren Einsatzbereichen aufzählen (Kupfer-, Koaxial-, 2
Lichtwellenleitung, Funk, PLC usw.).
Unterschied zwischen einer Steuerung und einer Rege- 2
1
lung erklären.
Provider – Angebote der „letzten Meile“ vergleichen. 2 1
Übertragungstechniken (digitale und analoge Systeme) (10)
5. Semester
Analoge und digitale Signalverarbeitungen nennen. 1 1
Codierung, Dekodierung, Modulation, Demodulation, Mul- 2
3
tiplexing und Demultiplexing unterscheiden.
Die verschiedenen Vermittlungsarten (Festleitung, Lei- 1
tungsvermittlung, Paketvermittlung) und deren Einsatzbe- 2
reich aufzählen.
Die unterschiedlichen Übertragungsarten (seriell, parallel, 2
2
synchron, asynchron) unterscheiden.
Die verschiedenen Bandbreiten und Kommunikationsrich- 1
2
tungen (Simplex, Halbduplex und Duplex) aufzählen.
Topologie (Anlageteile fachtechnisch korrekt bezeichnen) (2)
Die verschiedenen Abschnitte einer Kommunikationsin- 2
2
stallation beschreiben.
Telematiksysteme (18)
analoge Telefonie: Funktionsweise erläutern. 2 3
digitale Telefonie (ISDN): Funktionsweise erläutern. 2 2
Netzwerke (UKV) inkl. PLC: Funktionsweise erläutern. 2 7
6. Semester
DECT, WLAN, LTE etc. (Drahtlose Systeme): Funktions- 2
6
weise erläutern.
Schema- und Planzeichnen (4)
Kommunikationsanlagen schematisch und planerisch auf- 2
3
zeichnen.
Schemas und Pläne lesen und interpretieren. 2 1
Lernziel Lerninhalte K-Stufe Lektionen
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 18
-in EFZ
Lernziel Lerninhalte K-Stufe Lektionen
Installationsmaterialien (10)
Eigenschaften und Anwendungen von Installationsmate- 2
rialien kennen. (Stecksysteme, Drähte, Kabel, Lichtwellen- 10
leiter etc.)
7. Semester
Internetzugänge (Breitbandtechnologie) (8)
Die verschiedenen Möglichkeiten für den Internetzugang 2
und die dafür nötigen Installationsmaterialien (Aktiv- und 8
Passivkomponenten) beschreiben.
Dienste und Zusatzdienste (2)
Für einfache Kommunikationsanlagen die wichtigsten 1
2
Dienste und Zusatzdienste nennen.
Messungen für Kommunikationsverkabelungen (2)
Messverfahren inkl. Prüfgeräte aufzählen können. 1 0.5
Verschiedene Messresultate eines Messprotokolls unter- 2
1.5
scheiden.
Koaxiale Anlagen (10)
Installationen
Die Eigenschaften von koaxialen Installationen (Dämp- 2
fung, Verstärkung, Pegel, Pegelverlauf, Rückflussdämp- 4
8. Semester
fung, Schieflage usw.) nennen und beschreiben.
Netzaufbau und Verteilerstruktur
Den Netzaufbau inkl. Verteilerstruktur grafisch darstellen. 2 3
Die Übergabestellen aufzählen. 1 1
Erdungskonzept, bestehend aus Potentialausgleich und 2
1
Blitzschutz erklären.
Messung von koaxialen Anlagen
Verschiedene Messresultate eines Messprotokolls (Sig- 2
1
nalpegelmessgerät) unterscheiden.
Repetition und QV Vorbereitung 8
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 19
-in EFZ
Übergreifende Bildungsthemen
Lektionenverteilung über alle Semester:
1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. 7. Sem. 8. Sem. Total Lektionen
20 20 0 0 0 0 0 20 60
Qualifikation: Keine
Lernziel Informationsziel K-Stufe Lektionen
Die Lernenden setzen sich mit Lernstrategien auseinander, die 2 10
für den Berufsschulunterricht geeignet sind.
1. Semester
Die Lernenden bearbeiten selbstständig oder in Kleingruppen 1 10
aktuelle Themen.
Die Aktivitäten richten sich nach der aktuellen Situation und Themenla-
ge.
Beispiele: Spannungserzeugung, Teamfähigkeit, Abfallentsorgung,
Recycling, Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Cleantec, Oxidations- und
Reduktionsvorgänge aus der Praxis
Die Lernenden bearbeiten selbstständig oder in Kleingruppen 1 10
aktuelle Themen.
Die Aktivitäten richten sich nach der aktuellen Situation und Themen-
lage.
Beispiele: Lerntechnik, Energie, Energieeffizienz, galvanische Elemente,
Akkumulatoren, Oxidations- und Reduktionsvorgänge aus der Praxis
2. Semester
Die Lernenden besuchen im Klassenverband zur fachlichen 1 10
und allgemeinen Horizonterweiterung Firmen oder technische
Objekte.
Die Besuchsobjekte richten sich nach der Angebotslage und den organisa-
torischen Bedingungen.
Beispiele: Besuch von Recycling Unternehmen, Besuch von Kraftwerken,
Erzeugungsanlagen, Herstellungsfirmen von Installationsmaterial, Appara-
ten,
Ausstellungen technisch-wissenschaftlicher Natur, Fachmessen, Objekten
in der Praxis, u.a.
8. Semester
Die Lernenden halten Fachvorträge zur fachlichen und allge- 1 10
meinen Horizonterweiterung.
Vorbereitung auf das Qualifikationsverfahren 3 10
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 20
-in EFZ
Elektrische Systemtechnik
Lektionenverteilung über alle Semester:
1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. 7. Sem. 8. Sem. Total Lektionen
0 0 0 0 40 40 40 40 160
Lernziel Informationsziel K-Stufe Lektionen
Drehstromvertiefung 2 10
Die Bedeutung des Neutralleiters bei der Sternschaltung
anhand der Spannungsverhältnisse erklären.
Spannungs- und Stromverhältnisse für die Sternschaltung
mit Neutralleiter graphisch bestimmen (unsymmetrisch).
Den Neutralleiterstrom grafisch bestimmen.
Spannungsabfall auf Drehstromleitungen
Kurzschlussberechungen im Drehstromnetz
Transformatoren
Funktionsweise und Anwendung von Einphasentransforma- 2 4
toren / Spartransformatoren erklären
Verlustarten und Streuung erklären 2 3
5. Semester
Aufbau und Schaltungsarten von Drehstromtransformatoren 1 2
erklären
Das Prinzip, sowie die Vor- und Nachteile von elektroni- 1 2
schen Transformatoren nennen
Anwendung von Messwandlern erklären 1 1
Motoren
Die Entstehung des Drehfeldes erklären. 1 2
Funktionsweise und Anwendung erklären Drehstrom- 2 4
Asynchronmotor (Motor mit Kurzschlussanker)
Anlaufverfahren und Drehzahlregulierung von Kurzschluss- 1 4
ankermotoren erklären
Funktionsweise von und Anwendung von Motorschutzeinrich- 2 4
tungen erklären
einphasige Asynchronmotoren Prinzip und Anschluss erklären 1 2
gebräuchliche Kleinmotoren und Universalmotor Prinzip und 1 2
Anschluss erklären
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 21
-in EFZ
Lernziel Informationsziel K-Stufe Lektionen
Elektrowärme
Energieübertragung durch Wärmeleitung, Wärmeübergang, 1 1
Wärmestrahlung erklären können
Begriff Wärmekapazität kennen und erklären können 2 1
Aggregatzustände und deren Änderung 1 2
Berechnungsaufgaben lösen (Energie und Leistungsbe- 3 6
rechnungen / Wärmewirkungsgrad).
Wärme- und Kälteapparate
Funktionsweise und Anwendung der verschiedenen 2
Elektrogeräte erklären.
1. Kochgeräte 4
2. Warmwasserwärmer 4
3. Kühlgeräte 2
4. Wärmepumpe 4
Anwendung des Energielabels erklären können 1 1
6. Semester
Gebäudeautomation
(erteilt durch Kommunikationsfachlehrperson) 2 5
Aufbau, Struktur und Aufgabe der Gebäudesystemtechnik
erklären
Funktionsprinzip von Bussystemen erklären und die
wichtigsten Elemente nennen
Bussysteme
Verschiedene Bussysteme nennen 2 10
KNX Organisation aufzählen
Busstruktur (inkl. PLC) mit Verdrahtungsprinzip erklären und
aufzeichnen
Parametrierung (physikalische und Gruppenadresse) unter-
scheiden und zuordnen.
Anwendung von Bauteile wie Sensoren, Aktoren, Koppler,
Verstärker usw. mittels Herstellerinformationen definieren
Kleine Anlagen aufzeichnen und beschreiben.
Anschlussschemas von SPS-Anlagen und einfachen
Bussystemen unterscheiden.
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 22
-in EFZ
Lernziel Informationsziel K-Stufe Lektionen
Elektrische Messinstrumente
Funktionsweise und Einsatz von konventionellen 2 2
Messwerken erklären.
Spannungs-, Strom-,Leistungs- und Widerstandsmessung 2 3
Berechnungen für Messbereichserweiterungen. 2 4
Erkennen und vermeiden von Messfehlern 2 4
Direktes und indirektes Messverfahren 1 2
7. Semester
Messinstrumente für NIV-Messungen erläutern und deren 2 3
Messwerte beurteilen
Anwendung und Anschluss von Messwandlern erklären 1 2
Energietransport und Verteilung
Das schweizerische Verbundnetz mit den verschieden 1 3
Spannungsebenen erläutern
Unterschiedliche Netzstrukturen im Verteilnetz erklären. 2 10
Berechnungen im Strahlennetz durchführen
USV und Notstromanlagen -> das Funktionsprinzip grob 1 4
erklären und Anwendung nennen
Rundsteueranlagen: Zweck und Funktionsprinzip erläutern. 1 1
Unterschied Netzverbund und Inselbetrieb erklären 1 2
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 23
-in EFZ
Lernziel Informationsziel K-Stufe Lektionen
Energietransport und Verteilung
Die Lernenden erklären die Materialien, Komponenten und 2 7
Schutzeinrichtungen von Energieverteilanlagen bis 36 kV.
Die Lernenden beschreiben Aufgaben, Funktion und Einsatz 2 7
von Anlagen zur Stromerzeugung mit neuen erneuerbaren
Energien.
Lichttechnik
Wesen des Lichtes und die spektrale Zusammensetzung des 1 1
Lichtes kennen.
Den Einfluss der Lichtquelle auf das Farbempfinden kennen. 1 1
8. Semester
Die Grundgrössen in der Lichttechnik erklären und die 2 1
Einheiten zuordnen.
Die Begriffe Wirkungsgrad und Lichtausbeute interpretieren. 2 1
Einfache Beispiele der Beleuchtungsdimensionierung 3 4
berechnen. Abstandgesetz, Lampenzahlermittlung
Arten der elektrischen Lichterzeugung nennen. 1 1
gebräuchliche Leuchten unterscheiden und Anwendungen 2 1
aufzählen.
Funktionsprinzip und Schaltungen von FL 2 2
Leuchten erläutern.
Gasentladungslampen und LED Lampen -> ihre Eigenschaften 1 1
und Anwendungen nennen.
Lichtsteuerungen (Präsenzmelder, Tageslichtsteuerung, Däm- 2 3
merungsschalter) Prinzip erklären und verdrahten können.
Repetition 10
Repetition sämtlicher Stoffgebiete
Vorbereitung auf das Qualifikationsverfahren
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Elektroplaner/ Seite
Interner Schullehrplan 24
-in EFZ
Beschreibung der Taxonomiestufen
Kompetenzstufe Denk- und Arbeits- Bedeutung
prozess
K 1: Wissen nennen, aufzählen Punkte, Gedanken, Argumente, Fakten auflisten
Informationen wie- Benennen Vorgegebenen Elementen den Namen geben.
der-geben und in
gleichartigen Situa-
tionen abrufen
K2: Verstehen bestimmen, definieren Den Inhalt eines Begriffs auseinanderlegen; feststellen; etwas herausle-
Informationen nicht sen, etwas veranschaulichen.
nur wiedergeben, Das Grundprinzip von Die Idee erklären, die einer Sache zugrunde liegt, nach der etwas wirkt;
sondern auch ver- etwas erklären schematisch erklären, wie etwas aufgebaut ist (keine Einzelheiten des
stehen inneren Aufbaus, der inneren Abläufe).
zuordnen Elemente miteinander in Verbindung bringen, gruppieren
unterscheiden, verglei- Die Unterschiede zwischen Dingen anhand bestimmter Merkma-
chen le/Kriterien herausheben.
beschreiben, erläutern, Etwas mit eigenen Worten deutlich machen, darstellen, kennzeichnen,
erklären treffend schildern (z.B. indem „W-Fragen“ beantwortet werden).
K3: Anwenden anwenden Bei einer Arbeit ein bestimmtes Verfahren, eine bestimmte Technik zu
Informationen über einem bestimmten Zweck verwenden. Wissen, Begriffe, Konzepte, Model-
Sachverhalte in le umsetzen um gewohnte, bekannte Anforderungen zu bewältigen.
verschiedenen ausführen, durchführen Ein Vorhaben in allen Einzelheiten verwirklichen, eine bestimmte Arbeit
Situationen anwen- erledigen, fachgerecht in die Praxis umsetzen.
den Lokalisieren Örtlich auffinden; den Ort, die Lage von etwas bestimmen.
instand halten, warten In brauchbarem Zustand halten. Arbeiten ausführen, die für die Funktions-
fähigkeit periodisch nötig sind. Bauteile oder Systeme austauschen.
Instand setzen, reparie- Bauteile oder Systeme reparieren.
ren
Berechnen Mit Hilfe üblicher Angaben, dem Formelbuch und Taschenrechner praxis-
gerechte Antworten auf branchenspezifische Fragestellungen geben. Nur
Formeln anwenden, keine Formeln umstellen oder entwickeln.
Befolgen Sich nach etwas richten (z. B. nach einer Vorschrift handeln). Informatio-
nen über Sachverhalte in verschiedenen Situationen anwenden.
K4: Analyse kommentieren Einen Befund abgeben zu Theorien, Anforderungen, Situationen, zur
Sachverhalte in Beschaffenheit eines Gegenstandes. Dies erfolgt durch Erläuterung, Aus-
Einzelelemente legung, kritische Stellungnahmen.
gliedern, die Bezie- Beraten Bei einem komplexen, theoretischen Phänomen oder einer praktischen
hungen zwischen Problemstellung, mit Rat beistehen bzw. Ratschläge geben.
Elementen aufde- begründen Etwas breit und tief und von verschiedenen Standpunkten aus prüfen,
cken und Zusam- auslegen, nachweisen, deutlich machen; dazu Gründe und Argumente
menhänge erken- hervorheben.
nen
K5: Synthese situationsgerecht um- Einzelne Elemente eines Sachverhalts, einer Situation, zu einer neuen
Elemente eines gehen, optimieren, Lösung zusammenfügen. Die bestmögliche Lösung eines neuen Problems
Sachverhalts kom- geeignete Massnah- finden und in die Praxis umsetzten.
binieren u. zu ei- men ableiten
nem Ganzen zu- zeichnen, aufzeichnen Etwas (Ganzes und Teile) bildhaft darstellen. Die Wirklichkeit mit Hilfe von
sammenfügen od. Normen abbilden. Ein Gegenstand als Handskizze darstellen.
eine Lösung für
Probleme entwer-
fen.
K6: Bewerten Prüfen Der Zustand und die Funktion gewisser Elemente anhand von Kriterien
Bestimmte Gegen- untersuchen. Daraus ein Urteil ableiten.
stände, Informatio- beurteilen, diagnosti- Gegenstände, Sachverhalte, Phänomene, Lösungen anhand von Kriterien
nen und Sachver- zieren, ableiten beurteilen (Kriterien können sein: Zustand, Aussehen, einwandfreies
halte nach Kriterien Funktionieren, …). Aus dem Urteil eine Lösung, Empfehlung oder Ent-
beurteilen scheidung ableiten.
interpretieren Die Bedeutung von etwas erklären, die Kernaussagen herausschälen, mit
einer persönlichen Beurteilung verknüpfen.
Verfasser: Liechti Hansruedi Erstellungsdatum: 1. Juni 2016 Änderungsdatum: 22. Juli 2016Sie können auch lesen