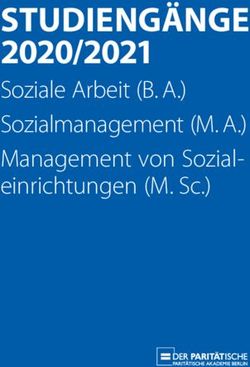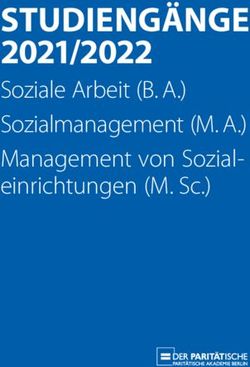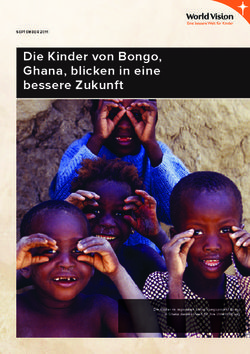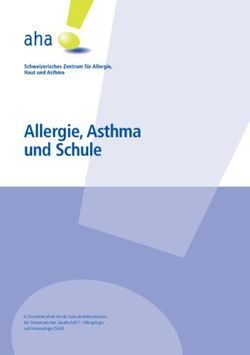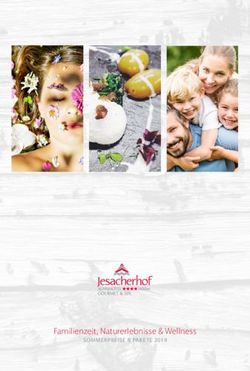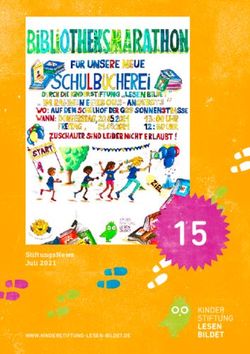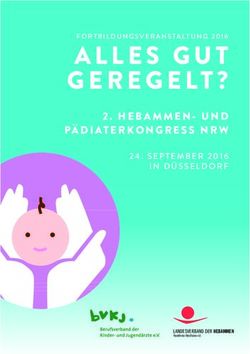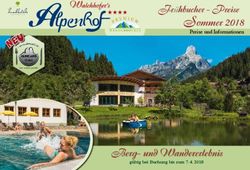Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021 - Personal, Arbeitsmarkt und Qualifizierung - zentrale Ergebnisse 17. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
s entati
r ä o
P
n
Fachkräftebarometer
Frühe Bildung 2021
Personal, Arbeitsmarkt und Qualifizierung –
zentrale Ergebnisse
17. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag
19. Mai 2021
1
Ein Projekt der WiFF am DJIFachkräftebarometer Frühe Bildung 2021
Das Fachkräftebarometer
Frühe Bildung 2021
Das Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021 ist ein Pro- Inhalt
jekt der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fach-
1 Einführung
kräfte (WiFF) am Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) und
an der Uni Dortmund. 2 Das Kita-Personal
3 Das Kita-Team
Es liefert auf der Grundlage der amtlichen Statistik umfas- 4 Das Personal in der Kindertagespflege
sende Informationen zu Personal, Arbeitsmarkt und Qua- 5 Die Ausbildung in die Frühe Bildung
lifizierung in der Kindertagesbetreuung.
6 Der Arbeitsmarkt
Das erste Fachkräftebarometer Frühe Bildung erschien 7 Das Personal in Ganztagsangeboten an Grundschulen
2014. Flankiert wird die der Datenbericht seither durch die 8 Herausforderungen
Website www.fachkraeftebarometer.de. 9 Fazit
Die nunmehr vierte Ausgabe erscheint im September 2021. Die Publikation wird – unter Federführung von Profes-
Sie schreibt den Bericht mit aktuellen Zahlen fort und bie- sorin Dr. Kirsten Fuchs-Rechlin und Professor Dr. Tho-
tet wieder vertiefte Analysen, beispielsweise zum Personal mas Rauschenbach – von einer Autorengruppe aus Wis-
in Ganztagsangeboten an Grundschulen. senschaftlerinnen und Wissenschaftlern der WiFF am DJI
und an der Uni Dortmund. Zu ihr gehören: Karin Beher,
Angélique Gessler, Dr. Kirsten Hanssen, Pascal Hartwich,
Christian Peucker, Anna Pilchowski und Katja Tillmann.
2Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021
Autorengruppe Fachkräftebarometer
Fachkräftebarometer
Frühe Bildung 2021
Ein Projekt der WiFF am DJI
Erscheint im September 2021
Autorengruppe Fachkräftebarometer
Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021
München 2021
ISBN 978-3-86379-366-1
DOI: 10.36189/wiff32021
www.fachkraeftebarometer.de
3Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021
1. Der Personalbestand in den Kitas wächst weiter
Abb. 1 Pädagogisches und leitendes Personal sowie rechnerische Vollzeitstellen in Kindertageseinrichtungen
2006 bis 2020 (Deutschland; Anzahl; Veränderung absolut und in %)1, 2
Pädagogisches und leitendes Personal Rechnerische Vollzeitstellen
+322.874 | +92 % Veränderung 2006–2020 +267.410 | +95 %
Anzahl +26.375 +40.513 +44.596 +58.288 +48.120 +49.990 54.992 +20.893 36.432 +38.563 +47.396 +37.802 +41.181 +45.142
800.000 |+7 % |+11 % |+11 % |+13 % |+9 % |+9 % |+9 % |+7 % |+12 % |+11 % |+13 % |+9 % |+9 % |+9 %
700.000 675.645
620.653
600.000 570.663 548.968
522.543 503.826
500.000 464.255 462.645
419.659 424.843
400.000 379.146 377.447
352.771 338.884
302.452
300.000 281.558
200.000
100.000
0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Veränderung zum vorigen Wert
Pädagogisches und leitendes Personal 2006 und 2020
1 Inklusive Horte; pädagogisches und leitendes Personal ohne Verwaltung (im ersten Arbeitsbereich).
124.562
2 Rechnerische Vollzeitstellen: Vollzeitäquivalente (VZÄ) mit 39 Wochenstunden; ohne Verwaltung.
NW 73.957
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Kinder und tätige Personen
106.499 in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege, ver-
BY Jahrgänge; eigene Berechnungen
schiedene 44.792
99.620
BW 46.355
62.148
NI 30.597
53.580
HE 30.019
SN Das Personalwachstum in Kindertageseinrichtungen hat sich auch in
20.941
38.009
BE den letzten beiden Jahren ungebremst fortgesetzt. Dennoch zählen
15.987
34.098
RP Erzieherinnen und Erzieher sowie Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger
19.444
33.803
BB mittlerweile bei der Bundesagentur für Arbeit zu den „Engpassberufen“.
12.530
23.085
21.780
SH 11.230
19.108
ST 12.820
17.728
Im Jahr
HH 20208.281arbeiteten bundesweit rund 675.650 päda- befinden sich Kindertageseinrichtungen nunmehr fast auf
15.620
gogisch
TH und leitend
10.311 Tätige in Kindertageseinrichtungen. Augenhöhe mit den allgemeinbildenden Schulen, in denen
Dies entspricht
MV einer
13.137 Steigerung des Personalbestands im Schuljahr 2019/20 rund 693.750 Lehrkräfte tätig waren
8.068
von 92SL% seit 2006, dem Beginn des Ausbaus der Ange-
6.919 (Statistisches Bundesamt 2021).
4.110
bote für Kinder
5.949 unter drei Jahren. Umgerechnet in Voll-
HB 3.329
zeitstellen, fällt der Zuwachs sogar noch etwas höher Mit dem hohen Personalbedarf geht ein Fachkräfteengpass
20.000
aus: In 0diesem Zeitraum 40.000
wurden60.000 80.000
gut 267.400 100.000
rechneri- 120.000 140.000
in Kindertageseinrichtungen
Anzahl einher. So verzeichnete die
2006 2020
sche Vollzeitstellen hinzugewonnen – ein Plus von 95 %. Bundesagentur für Arbeit 2020 rund 10.900 offene sozial
versicherungspflichtige Stellen für Erzieherinnen und Er-
Die Personalexpansion hat sich bis zuletzt ungebremst fort- zieher. Demgegenüber meldeten sich nur etwa 7.700 Perso-
gesetzt: Im Vergleich zu 2018 wurden rund 55.000 bzw. 9 % nen mit diesem Zielberuf arbeitslos. Nicht verwunderlich
pädagogisch und leitend Tätige zusätzlich eingestellt, wo- ist somit, dass Erzieherinnen und Erzieher kürzlich von der
bei insbesondere in 2020 der Zuwachs mit 28.700 Tätigen Bundesagentur für Arbeit in den Katalog der „Engpassberu-
im Vergleich zum Vorjahr sehr stark ausfiel. Zahlenmäßig fe“ aufgenommen wurden (Bundesagentur für Arbeit 2020).
4Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021
2. Das Qualifikationsgefüge bleibt konstant
Abb. 2 Pädagogisches und leitendes Personal in Kindertageseinrichtungen nach Qualifikationsniveau 2006 bis 2020 (in %)1
2020 6 68 13 5 6 2 Einschlägiger
2018 6 70 13 4 5 2 Hochschulabschluss
Einschlägiger
Deutschland 2016 5 70 13 4 5 2
Fachschulabschluss
2014 5 70 13 4 4 2 Einschlägiger Berufs-
2006 3 72 14 4 4 2 fachschulabschluss
Sonstige Berufs- und
Hochschulabschlüsse
2020 5 65 16 5 6 2 In Ausbildung
2018 5 66 16 5 5 2 Ohne Abschluss
West 2016 5 66 16 5 5 3
(ohne BE)
2014 5 66 16 5 5 3
2006 4 66 18 4 5 2
2020 7 81 2 3 5 1
2018 7 83 2 3 4 1
Ost 2016 6 85 13 3 1
(mit BE)
2014 6 86 1 3 3 1
2006 2 90 2 31 1
0 20 40 60 80 100 %
1 Inklusive Horte; pädagogisches und leitendes Personal ohne Verwaltung. Zuordnung der Berufe zu Qualifikationsgruppen ▶ Tab. D2.22 im Datenanhang.
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege,
verschiedene Jahrgänge; eigene Berechnungen
Erzieherinnen und Erzieher sind nach wie vor die Hauptberufsgruppe
in Kindertageseinrichtungen. Die Akademisierung schreitet
hingegen kaum voran.
Trotz des enormen Ausbaus hat sich das Qualifikationsge- Der Ost-West-Vergleich zeigt, dass in Ostdeutschland der
füge in Kindertageseinrichtungen seit 2006 kaum verän- Zuwachs einschlägiger Akademikerinnen und Akade-
dert. So verfügten im Jahr 2020 anteilsbezogen fast ebenso miker deutlicher ausgefallen ist. Ihr Anteil ist zwischen
viele der pädagogisch und leitend Tätigen über einen ein- 2006 und 2020 von 2 auf 7 % gestiegen. Insgesamt ist das
schlägigen Fachschulabschluss als Erzieherin und Erzieher Qualifikationsniveau im Osten höher. Während dort nur 11 %
(68 %) wie schon 2006 (72 %). Diese geringfügige Differenz über einen Qualifikationsabschluss unterhalb der Fachschu-
ist auf die Gruppe der einschlägig qualifizierten Akademike- le verfügen, trifft dies im Westen auf 29 % des Personals zu.
rinnen und Akademiker mit Abschlüssen etwa in Sozialpä- Grund dafür ist die im Vergleich ausgeprägte Präsenz der
dagogik oder Sozialer Arbeit, Erziehungswissenschaft oder berufsfachschulisch ausgebildeten Kinderpflegerinnen und
Kindheitspädagogik zurückzuführen. Ihr Personalanteil Kinderpfleger bzw. Sozialassistentinnen und Sozialassisten-
hat sich um drei Prozentpunkte auf zuletzt 6 % verdoppelt. ten in Westdeutschland.
5Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021
3. Die Altersstruktur der Fachkräfte verändert sich
Abb. 3 Pädagogisches und leitendes Personal in Kindertageseinrichtungen nach Altersgruppen 2006 und 2020 (in %)1
% Deutschland West (ohne BE) Ost (mit BE)
100 Unter 30 Jahre
19 28 16 27 31 34 30 bis < 40 Jahre
40 bis < 50 Jahre
80 50 Jahre und älter
31
33 23
60 22
19
38
40 24 23
23 24
28
20 22
3,1 6,2 3,4 5,7 2,3 7,8
24 26 29 28 9 19
0
2006 2020 2006 2020 2006 2020
1 Inklusive Horte; pädagogisches und leitendes Personal ohne Verwaltung (im ersten Arbeitsbereich).
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege, 2006 und
2020; eigene Berechnungen
In den letzten Jahren sind überdurchschnittlich viele Nachwuchskräfte
in das Arbeitsfeld der Frühen Bildung eingemündet. Gleichzeitig verbleiben
die Fachkräfte länger im Beruf.
Bei der Altersstruktur fällt auf, dass sich die Zahl der nahezu gleicher Gesamtzahl verbergen. Rechnet man die
50-Jährigen und Älteren seit 2006 von 68.600 auf 191.220 Altersgruppe der unter 30-Jährigen und der über 50-Jähri-
(+179 %) und damit am stärksten erhöht hat. Hierdurch gen (176.975 bzw. 191.220 Beschäftigte) in die einzelnen
ist bundesweit ihr Anteil am Personal von 19 auf 28 % ge- Altersjahrgänge um, dann entfallen auf einen Jahrgang
wachsen und bildet damit inzwischen die größte Alters- der jüngsten Altersgruppe rund 30.400 Personen, auf ei-
gruppe. Auch auf Seiten der jüngeren Beschäftigten unter nen Jahrgang der höchsten Altersgruppe hingegen ledig-
30 Jahren lassen sich hohe Personalzuwächse beobach- lich 13.800 Personen.
ten. Während im Jahr 2006 nur rund 85.650 Beschäftig-
te unter 30 Jahren in Kindertageseinrichtungen tätig wa- Betrachtet man Ost- und Westdeutschland getrennt vonein-
ren, betrug ihre Zahl 2020 bereits 176.975 (+107 %). Die ander, dann fällt auf, dass im Osten die Gruppe der 50-Jähri-
überdurchschnittliche Berufseinmündung jüngerer Be- gen und Älteren mit einem Anteil von 34 % am Kita-Personal
schäftigter in das Berufsfeld ging mit einem Anteilszu- größer ist als im Westen (27 %). Dagegen machen die jün-
wachs von 24 auf 26 % einher. Sie bilden damit die zweit- geren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 19 % einen
größte Altersgruppe in Kindertageseinrichtungen. Der geringeren Anteil aus. Dies zeigt sich auch am Altersdurch-
Personalzuwachs bei den unter 30-Jährigen wird jedoch schnitt von 39,7 Jahren im Westen gegenüber 41,8 Jahren in
in dieser Betrachtungsweise unterschätzt, da sich hinter den ostdeutschen Ländern.
den Altersgruppen unterschiedlich viele Jahrgänge bei
6Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021
4. Die Frühe Bildung bietet
solide Beschäftigungsbedingungen
Abb. 4 Pädagogisches und leitendes Personal in Kindertageseinrichtungen nach befristeten Arbeitsverhältnissen
2015 bis 2020 (Anzahl; in %)1
Deutschland West (ohne BE) Ost (mit BE)
Anzahl 15 % 15 % 15 % 14 % 13 % 12 % 16 % 16 % 16 % 15 % 14 % 13 % 11 % 11 % 11 % 10 % 9 % 8 % Anteil befristeter
Arbeitsverträge
75.812
78.526
79.948
in befristeten
79.309
600.000 Beschäftigungsverhältnissen
77.239
75.558
64.734
in unbefristeten
67.140
67.700
500.000 Beschäftigungsverhältnissen
66.561
64.776
63.574
400.000
300.000
11.078
11.386
12.248
200.000
106.533 12.748
11.984
102.467 12.463
100.000
539.752
116.497
121.168
429.705
445.880
466.577
491.207
330.568
343.413
360.044
379.627
418.584
111.580
512.951
396.454
99.137
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Inklusive Horte; pädagogisches und leitendes Personal ohne Verwaltung (im ersten Arbeitsbereich). Ohne übriges pädagogisches Personal (Praktikanten, Auszubildende,
Freiwilligendienst und Sonstige).
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege,
verschiedene Jahrgänge; eigene Berechnungen
Bei den Beschäftigungsbedingungen wurden insbesondere
hinsichtlich Arbeitsplatzsicherheit und Einkommen Verbesserungen erzielt.
Vor allem ein Aufstieg in eine Leitungsposition zahlt sich aus.
Nur 12 % der pädagogisch und leitend Tätigen in Kinderta- Gruppenleitungen haben einen befristeten Arbeitsvertrag.
geseinrichtungen arbeiteten 2020 in einem befristeten Ar- Demgegenüber ist fast ein Viertel (23 %) der Tätigen in der
beitsverhältnis, 2015 waren es noch 15 %. Befristete Arbeits- Eingliederung und Förderung von Kindern mit (drohender)
verträge sind in der Frühen Bildung vor allem ein Phänomen körperlicher, geistiger und seelischer Behinderung nach
des Berufseinstiegs. Während 23 % der unter 30-Jährigen SGB VIII/SGB XII befristet angestellt.
befristet beschäftigt sind, liegt der Anteil bei den Fachkräf-
ten ab 50 Jahren lediglich bei 6 %. Aber auch bei den jün- Auch die Gehälter haben sich in den letzten Jahren positiv
geren Altersgruppen zeigt sich seit 2015 ein rückläufiger entwickelt. So lag 2019 der Median des Bruttomonatsentgelts
Trend. Diese Entwicklung kann dem Bemühen der Träger für eine Vollzeitstelle in der Frühen Bildung bei 3.428 Euro
zugeschrieben werden, Personal zu gewinnen und zu bin- und damit knapp 22 % über dem von 2012. Dieser Anstieg ist
den. Das Risiko einer Befristung ist auch von der Position im gleichen Zeitraum höher ausgefallen als die durchschnitt-
abhängig: Nur 2 % der Einrichtungsleitungen und 7 % der liche Gehaltserhöhung aller Erwerbstätigen (+18 %).
7Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021
5. Die Qualität in der Frühen Bildung bleibt stabil
Abb. 5 Teams in Kindertageseinrichtungen nach Leitungsressourcen und Ländern 2011 und 2020 (in %)1
2011 2020
5 TH 0,4 3 21 59 16
14 MV 3 6 47 28 15
17 ST 4 8 51 23 14
18 SN 5 3 12 43 37
61 BY 5 35 36 15 9
32 BB 6 14 41 19 20
28 RP 7 15 41 20 17
21 SL 7 2 35 32 23
18 NW 7 4 24 38 27
36 BW 8 27 43 12 10
28 SH 9 4 23 36 27
26 HH 11 5 16 33 36
28 HE 13 7 28 28 23
30 NI 14 4 41 28 13
34 BE 22 6 27 24 22
34 HB 25 3 19 31 22
32 D 9 14 33 26 18
34 West (ohne BE) 9 16 33 24 17
21 Ost (mit BE) 8 6 30 32 23
0 50 100 0 20 40 60 80 100
%
Kitas mit ... wöchentlichen Leitungsstunden/Kopf:
keine > 0 bis 1 > 1 bis 2 > 2 bis 3 mehr als 3
1 Inklusive Horte; Leitungsressourcen: wöchentliche Leitungsstunden pro Kopf des pädagogischen und leitenden Personals (inkl. Leitung mit erstem Arbeitsbereich
Verwaltung).
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege,
2011 und 2020; eigene Berechnungen
Trotz Expansion der Frühen Bildung sind die Personalschlüssel –
mit leichter Tendenz zur Verbesserung – stabil geblieben und auch die
Leitungsposition ist gestärkt worden. Allerdings bleiben die erreichten Werte
hinter den fachlich geforderten Zielmarken zurück.
Die Zahl der Kindertageseinrichtungen, die über keine Leitung Auch hinsichtlich des Personalschlüssels, d. h. der Relation
verfügen, die mit zeitlichen Ressourcen für diese Aufgabe aus- zwischen einer vollzeittätigen pädagogischen Fachkraft zur
gestattet ist, ist insgesamt rückläufig. Während der bundes- Anzahl ganztagsbetreuter Kinder, bestehen weiterhin er-
weite Anteil dieser Einrichtungen 2011 noch bei rund 32 % lag, hebliche Unterschiede zwischen den Ländern. So variiert
sank er bis 2020 auf rund 9 %. In diesem Zeitraum hat in allen 2020 etwa der Personalschlüssel bei U3-Gruppen zwischen
Ländern eine Verbesserung der Ressourcenausstattung statt- 2,8 und 5,6 Kindern pro Vollzeitkraft. Die größte Spannbrei-
gefunden, worin sich eine zunehmende Anerkennung der Lei- te weist die Betreuung von Schulkindern in Kindertages-
tungsaufgaben seitens der Träger spiegelt. Dennoch zeigen einrichtungen auf. Hier kommen zwischen 5 und 15 Kinder
sich auch 2020 im Ländervergleich deutliche Unterschiede: auf eine Vollzeitkraft. Dennoch konnte der Personalschlüs-
Am günstigsten stellt sich die Situation in Thüringen, Meck- sel zwischen 2018 und 2020 in nahezu allen Betreuungsset-
lenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt dar, in denen die tings leicht verbessert werden. Im bundesweiten Mittel ver-
Anteile der Kindertageseinrichtungen ohne Leitungsressour- ringerte er sich bei den U3-Kindern von 4 auf 3,8 und bei den
cen bei 4 % und weniger liegen. Die Stadtstaaten Bremen und Schulkindern von 9,9 auf 9,7.
Berlin bewegen sich mit einem Viertel und einem guten Fünf-
tel dieser Einrichtungen weit über dem Bundesdurchschnitt.
8Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021
6. Die Kapazitäten der Ausbildung zur Erzieherin
und zum Erzieher wurden ausgeweitet
Abb. 6 Schülerinnen und Schüler im ersten Jahr der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung 2007/08 bis 2019/20
(Anzahl; Veränderung in %)1, 2
Anzahl +11 % +15 % +7 % +9 % +9 % +8 % 0% +2 % +1 % +2 % +4 % +5 %
45.000
41.483 Deutschland
39.619
40.000 38.274 Ost (mit BE)
37.026 37.477
36.507 36.338
West (ohne BE)
35.000 33.904 12.194
11.072 11.728
31.221 10.671 Veränderung
10.211 10.321 10.482
30.000 28.580 9.837 zum Vorjahr in %
26.634
9.183
25.000 23.159 8.257
20.918 7.133
20.000 5.781
4.746
15.000
10.000
5.000 16.172 17.378 19.501 20.323 22.038 24.067 26.296 26.017 26.544 26.806 27.202 27.891 29.289
0.000
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020
1 Für 2012/13 liegen für MV keine Daten vor. Es wurde der Vorjahreswert übernommen.
2 Für NW enthalten die Daten Schüler/innen am Beruflichen Gymnasium, ab 2009/10 mit integrierter Form der Ausbildung.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 2, verschiedene Jahrgänge, sowie ergänzende Tabellen zur Fachserie; Statistische Landesämter: WiFF-Länderabfrage,
verschiedene Jahrgänge; eigene Berechnungen ▶ M1
In den vergangenen Jahren bestand die vorrangige Strategie
der Personalbedarfsdeckung im Ausbau der Ausbildungskapazitäten,
hauptsächlich an den Fachschulen für Sozialpädagogik.
Die Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher war in den Auch die Zahl der Anfängerinnen und Anfänger einer Ausbil-
,
letzten Jahren Dreh- und Angelpunkt, um den gestiegenen dung zur Erzieherin und zum Erzieher steigt kontinuierlich
Fachkräftebedarf in der Frühen Bildung zu decken. Traditio- und lag im Schuljahr 2019/20 erstmals über 41.000. Das ent-
nell handelt es sich um eine vollzeitschulische Ausbildung, spricht nahezu einer Verdoppelung der Ausbildungskapazi-
die an den Fachschulen für Sozialpädagogik angesiedelt ist. täten gegenüber dem Schuljahr 2007/08 (+98 %). Das Inter-
Das Angebot an Schulen, die Erzieherinnen und Erzieher esse an der Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher ist
ausbilden, wurde in den vergangenen Jahren deutschland- damit ungebrochen. Die jährlichen Zuwachsraten, die zwi-
weit stark ausgebaut. Zwischen den Schuljahren 2012/13 schen 2008/09 und 2013/14 noch bei mindestens 7 % lagen,
und 2019/20 ist die Zahl der Fachschulen für Sozialpädago- werden zwar nicht mehr erreicht, aber in den letzten beiden
gik kontinuierlich von 553 auf 649 gestiegen. Allein im Schul- Schuljahren sind sie wieder deutlich angestiegen.
jahr 2019/20 sind bundesweit zehn weitere Fachschulen hin-
zugekommen.
9Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021
7. Die Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher
ist Gegenstand von Reformen
Abb. 7 Formate der Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher nach Ländern 20201
Schleswig-
Schleswig-
Holstein Ausbildungsform
Holstein Mecklenburg- Ausbildungsform
Mecklenburg-
Vorpommern 1 = Vollzeitschulische Ausbildung
Vorpommern 1 = Vollzeitschulische Ausbildung
Hamburg 2 = Teilzeitschulische Ausbildung
Bremen Hamburg Brandenburg 2 = Teilzeitschulische Ausbildung
Bremen Brandenburg 3 = Berufsbegleitende Teilzeitausbildung
Niedersachsen
3 = Berufsbegleitende Teilzeitausbildung
Niedersachsen 4 = Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Berlin
Berlin 4 = Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Sachsen-
Anhalt
Sachsen- Ausbildungsformen in den Bundesländern
Nordrhein-
Westfalen
Nordrhein-
Anhalt 1 +Ausbildungsformen
3 in den Bundesländern
Sachsen
Westfalen 1 + 2 +13+ 3
Thüringen Sachsen
Hessen
Thüringen 1 + 2 +14+ 2 + 3
Rheinland- Hessen 1 + 3 +14+ 2 + 4
Pfalz
Rheinland- 1 + 2 +13++ 34 + 4
Pfalz
1+2+3+4
Saarland
Bayern
Saarland Baden-
Württemberg Bayern
Baden-
Württemberg
1 In der vollzeitschulischen, teilzeitschulischen und berufsbegleitenden Ausbildung können die Praxisanteile je nach Land integrativ über die gesamte Ausbildungsdauer oder
konsekutiv, d.h. hauptsächlich am Ende (Berufspraktikum), stattfinden.
Quelle: Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Länder für Fachschulen und Fachakademien für Sozialpädagogik; eigene Recherche 2020
Der Ausbau der Ausbildungskapazitäten an den Fachschulen wurde
flankiert von einer Pluralisierung der Ausbildungsformen und
einer Diversifizierung der Zugänge zur Ausbildung.
Um die Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher attrakti- Daneben lässt sich in den letzten Jahren eine schrittwei-
ver für Personen mit unterschiedlichen Bildungs- und Berufs- se Erweiterung der Zugangsmöglichkeiten zu den Ausbil-
biografien zu machen, existiert in den Ländern mittlerweile dungsgängen beobachten. Grundsätzlich erfordert die Er-
eine Vielzahl an Ausbildungsformaten. So bieten einige Län- zieherinnenausbildung mindestens einen mittleren oder
der neben der klassischen Vollzeitausbildung auch eine Aus- gleichwertigen Schulabschluss sowie eine abgeschlosse-
bildung in Teilzeit oder in der tätigkeits- bzw. berufsbeglei- ne einschlägige Erstausbildung (z. B. in Kinderpflege oder
tenden Teilzeitform sowie als sogenannte praxisintegrierte Sozialassistenz). In 14 Ländern wird der Zugang allerdings
Ausbildung (PIA) an. Darüber hinaus gibt es weitere Aus- und auch mit einer fachfremden Berufsausbildung ermöglicht.
Weiterbildungsvarianten an den Fachschulen für Sozialpäda- In zwölf Ländern genügt sogar eine mehrjährige, in der Re-
gogik, die Modellcharakter haben, z. B. in Bayern die Ausbil- gel einschlägige berufliche Tätigkeit. Auch die Zugangsmög-
dung zur „Pädagogischen Fachkraft für Grundschulkindbe- lichkeit über eine Hochschulzugangsberechtigung, meistens
treuung“ (StMUK 2019). Der Ausbau dieser Formate schreitet in Verbindung mit Praxiserfahrung in relevanten Arbeits
voran: Inzwischen gibt es in 13 Ländern ein berufsbegleiten- feldern, wurde ausgebaut und besteht inzwischen in fast al-
des Teilzeitmodell. Ein PIA-Ausbildungsformat bieten aktuell len Ländern.
zehn Länder regulär oder als Modellversuch an.
10Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021
8. Die Ausbildungszahlen an Berufsfachschulen
und Hochschulen steigen kaum
Abb. 8 Absolventinnen und Absolventen der Kinderpflege- und Sozialassistenzausbildung 2007/08 und 2010/11
bis 2018/19 (Anzahl; Veränderung in %)1, 2
Anzahl Kinderpflege Sozialassistenz
20.000
+2 % +2 % –5 % +6 % +1 % –4 % –5 % +0 % +3 % +4 % +5 % +6 % +15 % –4 % +3 % +1 %
18.000
16.000 15.641 15.555 15.670
15.087
14.000 13.596
12.863 5.684
12.221
12.000 11.128 11.425 11.726 5.558 6.070 6.372
5.601
10.000 4.857 5.266
4.351 4.683
4.546
8.000
6.139 5.368 5.465 5.559 5.595 5.654
6.000 5.266 5.415 5.171 5.194
1.309 882 818 776 710 723
890 797 769 816
4.000
2.000 4.830 4.486 4.575 4.741 4.469 4.819 4.944 4.692 4.402 4.378 6.777 6.875 7.043 7.364 7.597 7.995 9.957 9.529 9.485 9.298
0.000
2007/08 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2007/08 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
West (ohne BE) Ost (mit BE) Deutschland Veränderung zum Vorjahr in %
1 Für 2007/08 liegen für HE und für 2013/14 bis 2015/16 liegen für HB keine Daten zur Sozialassistenzausbildung vor. Es wurden jeweils die Schüler/innenzahlen des
2. Ausbildungsjahres des Vorjahres eingesetzt.
2 Ab dem Schuljahr 2015/16 wurde in NW die Ausbildungsrichtung „Sozialhelfer/in“ in die Ausbildungsrichtung „Sozialassistent/in“ umgeändert und berücksichtigt.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 2, verschiedene Jahrgänge, sowie ergänzende Tabellen zur Fachserie; Statistische Landesämter: WiFF-Länderabfrage,
verschiedene Jahrgänge; eigene Berechnungen ▶ M1
Im Vergleich zur fachschulischen Ausbildung sind die Zugewinne
bei den berufsfachschulischen Ausbildungen auf der einen Seite
des Ausbildungsspektrums und bei den Hochschulstudiengängen auf
der anderen Seite geringer. Bei den kindheitspädagogischen Studiengängen
stagnieren die Zahlen seit einigen Jahren.
Vor allem in den westlichen Ländern ermöglichen auch be- gebildete Sozialassistentinnen und Sozialassistenten die
rufsfachschulische Ausbildungen – vorrangig in den Berei- Berufsfachschulen verlassen. Dies hat auch damit zu tun,
chen Kinderpflege und Sozialassistenz – den Einstieg in die dass dieser Abschluss in vielen Ländern die erste Phase der
Frühe Bildung. Dabei zeichnet sich in den letzten Jahren Erzieherinnenausbildung ausmacht.
ein Rückgang der Ausbildungsgänge in der Kinderpflege zu-
gunsten der Sozialassistenz ab. Dies spiegelt sich auch in der Bei den kindheitspädagogischen Studiengängen, die spezi-
Zahl der Absolventinnen und Absolventen. Die Anzahl der ell auf eine Tätigkeit in der Frühen Bildung zugeschnitten
Auszubildenden, die einen Abschluss in der Kinderpflege sind, stagniert die Anzahl der Absolventinnen und Absolven-
erwerben, betrug im Schuljahr 2007/08 noch 6.139, bewegt ten. Die Zahl derer, die die Hochschule mit einem Bachelor-
sich seitdem jedoch nur zwischen rund 5.200 und 5.600. Die Abschluss in Kindheitspädagogik verlassen, hat sich in den
Zahl der Absolventinnen und Absolventen der Sozialassis- letzten fünf Jahren bei etwa 2.500 eingependelt. Zum Ver-
tenzausbildung ist seit dem Schuljahr 2007/08 kontinuier- gleich: Die Zahl der fertig ausgebildeten Erzieherinnen und
lich angestiegen. Im Schuljahr 2018/19 haben 15.670 aus Erzieher lag im Schuljahr 2018/19 bei gut 31.000.
11Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021
9. In westdeutschen Kitas droht
ein Fachkräftemangel
Abb. 9 Benötigter Personalbestand in westdeutschen Tageseinrichtungen für Kinder vor dem Schuleintritt
und Deckung durch verbleibendes Personal sowie Neuzugänge aus Ausbildungen, 2020 bis 2030
(kumuliert, Anzahl an Personen, auf 100 gerundet)1
Variante 1: Hohe Deckung Westdeutschland Variante 2: Geringe Deckung
Geringere Bedarfe + höhere Zahl an Neuzugängen Höhere Bedarfe + geringere Zahl an Neuzugängen
10.400 22.900 469.100 2020 469.100 19.500 19.200
16.600 46.900 459.700 2021 459.700 39.800 34.600
20.000 71.900 449.800 2022 449.800 61.000 47.300
20.400 96.900 439.500 2023 439.400 82.200 57.000
19.000 122.000 428.900 2024 428.800 103.400 65.000
17.200 147.000 418.200 2025 418.000 124.600 72.500
1.200 172.000 407.300 2026 407.100 145.800 60.200
181.200 396.200 2027 396.000 167.000 46.900
188800 384.900 2028 384.500 188.200 33.100
196.100 373.200 2029 372.800 209.400 19.000
202.900 361.500 2030 361.000 230.600 4.300
700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Anzahl 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000
Verbleibendes Personal aus 2019 Neuzugänge aus Ausbildungen Personallücke
1 Das jeweils pro Jahr verbleibende pädagogische Personal entspricht dem Bestand in Tageseinrichtungen für Kinder vor dem Schuleintritt im Jahr 2019 –
abzüglich altersbedingt ausscheidender sowie zurückkehrender oder wechselnder Fachkräfte.
Quelle: Rauschenbach/Meiner-Teubner/Böwing-Schmalenbrock/Olszenka (2020)
Für den weiteren Kita-Ausbau zeichnet sich in Westdeutschland
ein kurzfristiger hoher Personalbedarf ab. In Ostdeutschland könnte dagegen
aufgrund des sinkenden Personalbedarfs bei – konstanten Ausbildungszahlen –
Personal für Qualitätsverbesserungen eingesetzt werden.
In den westdeutschen Bundesländern werden bis 2025 zwi- Personallücke 2025 bei 72.500 fehlenden Fachkräften.
schen rund 20.000 und 72.500 Fachkräfte fehlen, um den
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab dem vollendeten In den ostdeutschen Ländern werden hingegen bald schon
ersten Lebensjahr zu erfüllen und den Bedarf der Eltern zu mehr Personen ausgebildet, als in den Kindertageseinrich-
decken. Die Spannbreite ergibt sich durch die Kombination tungen für die Erfüllung des Rechtsanspruchs und die De-
wahrscheinlicher Szenarien: Angenommen, der Personalbe- ckung des Elternbedarfs benötigt werden. Diese könnten
darf ist niedrig und eine hohe Anzahl an Erzieherinnen und für qualitative Verbesserungen des Personalschlüssels so-
Erzieher startet nach der Ausbildung in das Arbeitsfeld Kita, wie für den Ausbau an Ganztagsangeboten für Grundschul-
wächst die Personallücke bis zum Jahr 2023 auf einen Wert kinder eingesetzt werden.
von etwa 20.000 fehlenden Fachkräften. Geht man jedoch
von einem höheren Bedarf aus bei gleichzeitig weniger Neu-
zugängen aus den Ausbildungsstätten in die Kitas, läge die
12Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021
10. Aufholbedarf bei Ganztagsangeboten
an Grundschulen
Abb. 10 Pädagogisches und leitendes Personal in Kindertageseinrichtungen sowie weiteres Personal in der Schulkinder-
betreuung nach Qualifikationsniveau 2016 und 2018 (Deutschland; in %)1
Personal in Kindertageseinrichtungen Personal in der Kinderbetreuung und Einschlägiger
(KJH-Statistik 2020) -erziehung von Grundschulkindern und Hochschulabschluss
in der Frühen Bildung
% Einschlägiger
(Mikrozensus 2018)
100 Fachschulabschluss
Einschlägiger Berufs-
86 fachschulabschluss
80 Sonstige Ausbildungen
67 68 68 68 70
In Ausbildung
60 Ohne Abschluss
40
Akademischer
20 15 16 Abschluss
13 13 14
9 8 9 5 9 Anerkannter
5 4 5 2 6 5 6 6 5 6 5
2 2 2 beruflicher Abschluss
0
Horte Einrichtungen mit Einrichtungen Kindertages- Kinderbetreuung Frühe Bildung Kein anerkannter
Schulkindern und ohne einrichtungen und -erziehung beruflicher Abschluss/
weiteren Kindern Schulkinder insgesamt in Grundschulen ohne Angabe
1 Personal in Kindertageseinrichtungen (KJH-Statistik): pädagogisches und leitendes Personal ohne Verwaltung (im ersten Arbeitsbereich); Horte: Kindertages
einrichtungen, in denen nur Schulkinder im Alter von 5 bis unter 14 Jahren betreut werden.
Erwerbstätige in der Berufsuntergruppe „Kinderbetreuung u. -erziehung“ in Grundschulen (Mikrozensus): Aktive Erwerbstätige in der Berufsuntergruppe 8311 im
Wirtschaftszweig 852. Weitere Anmerkungen ▶ Kap. 5 M1.
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege, 2020;
FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Mikrozensus, 2018; eigene Berechnungen
Das pädagogisch tätige Personal in Ganztagsschulen verfügt mit 14 % etwa sechsmal
so häufig wie das Hortpersonal über keinen anerkannten beruflichen Abschluss. Zugleich
ist der Anteil an akademisch ausgebildeten Fachkräften deutlich höher als in den Ein
richtungen für Nicht-Schulkinder. Die Arbeitsbedingungen im schulischen Ganztag sind
im Unterschied zu denen in der Frühen Bildung vielfach deutlich prekärer.
Im Jahr 2020 waren rund 131.500 Personen in Horten, alters- an Grundschulen geringfügig beschäftigt, im Gegensatz zu
gemischten Kindertageseinrichtungen und Grundschulen in nur 4 % des Personals in der Frühen Bildung. Auch die Be-
der Betreuung von rund 1,8 Millionen Kindern (Stand 2019) im fristungsquote ist höher (15 % vs. 9 %). 46 % der Erwerbstä-
Grundschulalter tätig. Mehr als die Hälfte des Personals (54 %) tigen im Bereich der Kindertagesbetreuung und Erziehung
arbeitete an Grundschulen, 30 % in Horten ausschließlich für an Grundschulen gehen einer atypischen Beschäftigung mit
Schulkinder und 16 % in Einrichtungen, die sowohl Schulkin- einem Stundenumfang von weniger als 21 Wochenstunden
der als auch jüngere Kinder betreuen. Während in der Frühen nach; 12 % arbeiten sogar weniger als zehn Wochenstunden.
Bildung 86 % des Personals eine abgeschlossene Berufsausbil- Dazu passt, dass jede fünfte Person in diesem Bereich ihren
dung vorweisen kann, trifft das beim Personal im Ganztag an Arbeitsumfang ausbauen möchte. In der Frühen Bildung trifft
Grundschulen nur auf 70 % zu. 14 % verfügen laut Mikrozensus das auf nur 7 % der Beschäftigten zu. Die im Vergleich hetero-
über keinen anerkannten beruflichen Abschluss. gene Qualifikationsstruktur der Beschäftigten – Hochschul-
ausgebildete einerseits, Unausgebildete andererseits – sowie
Auch die Beschäftigungsbedingungen des pädagogischen die prekären Arbeitsbedingungen sind ein Hindernis im Wett-
Personals an Grundschulen fallen gegenüber denen des bewerb um Fachkräfte, die im Zuge des weiteren Ausbaus
Personals an Kindertageseinrichtungen schlechter aus. So von Ganztagsangeboten für Grundschulkinder insbesonde-
ist knapp ein Viertel des Personals in Ganztagsangeboten re in den westlichen Ländern dringend benötigt werden.
13Das dieser Publikation zugrunde liegende Vorhaben wird mit
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
unter den Förderkennzeichen 01NV1901A und 01NV1901B gefördert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt
beim Autorenteam.
© 2021 Deutsches Jugendinstitut e.V.
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF)
Nockherstraße 2
81541 München
info@weiterbildungsinitiative.de
Herausgeber: Deutsches Jugendinstitut e.V. (DJI)
Gestaltung und Satz: Christiane Zay, Passau
www.weiterbildungsinitiative.de
www.fachkraeftebarometer.de
14Sie können auch lesen