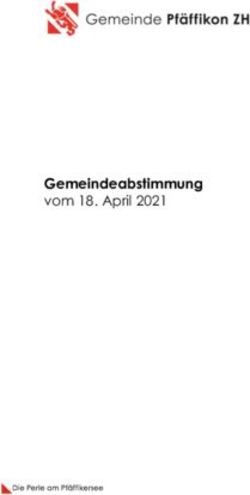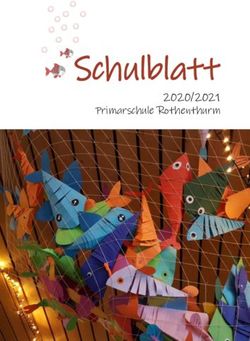In Sport, Spiel und Bewegung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Das vorliegende Buch wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch erfolgen alle Angaben ohne
Gewähr. Weder der Herausgeber noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder
Schäden, die aus den im Buch vorgestellten Informationen resultieren, Haftung über-
nehmen.
Sollte diese Publikation Links auf Websiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für
deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigenmachen, sondern lediglich
auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröf fentlichung verweisen.
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 2 22.09.20 12:38Vermittlungskompetenz in Sport, Spiel und Bewegung: Sportartspezifische Perspektiven
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Details sind im Internet über
abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie das Recht der Übersetzung,
vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes
Verfahren – ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer
Systeme verarbeitet, gespeichert, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2020 by Meyer & Meyer Verlag, Aachen
Auckland, Beirut, Dubai, Hägendorf, Hongkong, Indianapolis, Kairo, Kapstadt,
Manila, Maidenhead, Neu-Delhi, Singapur, Sydney, Teheran, Wien
Member of the World Sport Publishers’ Association (WSPA)
9783840313813
E-Mail: verlag@m-m-sports.com
www.dersportverlag.deInhalt
Vorwort ................................................................................................................................................................................................... 8
Tobias Vogt
I Theoretische Einordnung ................................................................................................................. 11
1 Zur Vermittlungskompetenz in Sport, Spiel und Bewegung ......................... 12
Tobias Vogt
2 Zielgruppenspezifische Vermittlung:
Inhalte, Methoden und Modelle ............................................................................................................... 29
Tobias Vogt & Daniel Klein
II Vermittlungskompetenz in den Sportarten .......................................... 51
Volleyball
3 Das Spielgemäße Konzept in der Volleyballvermittlung:
Zeitgemäß interpretiert – immer noch aktuell .................................................................. 52
Jimmy Czimek & Simon Timmer
4 Engagement durch Motivation – Möglichkeiten der
Motivationsförderung im Volleyballunterricht an der Schule ................... 60
Simon Timmer & Jimmy Czimek
Turnen
5 Effizient, ästhetisch, sicher: Biomechanisches Grundverständnis
als Fundament turnerischer Bewegungsvermittlung .............................................. 70
Jonas Rohleder, Maria Becker & Ilona Gerling
6 Vermittlungswege im Gerätturnen: Förderung von Lernprozessen
durch zielgruppenadäquaten Methodeneinsatz ............................................................. 93
Maria Becker, Ilona Gerling & Jonas Rohleder
5
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 5 22.09.20 12:387 „Teamsport“ Turnen: Gegenseitiges Helfen und Sichern
zur Förderung sozialer Kompetenzen ........................................................................................... 106
Ilona Gerling, Jonas Rohleder & Maria Becker
Schwimmen
8 Vermittlungsinhalte einer umfassenden
schwimmerischen Grundbildung .......................................................................................................... 129
Ilka Staub & Inga Fokken
9 Handlungsoptionen und Potenziale
eines geöffneten Schwimmunterrichts –
wirkungsvoll und motivierend Schwimmen lehren ................................................. 149
Luis Ohlendorf & Ilka Staub
10 Das Show-Room-Prinzip mit und ohne Videofeedback –
individualisierte Schwimmtechnikvermittlung
im Schul-, Breiten- und Leistungssport ....................................................................................... 171
Lucas Abel, Andreas Bieder & Ilka Staub
Badminton
11 Vermittlung des Badmintonspiels am Beispiel
des Racketspeedmodells in Schule und Verein ............................................................. 189
Daniel Hoffmann
12 Fehlerkorrekturen im Badminton
aus funktionaler Perspektive ..................................................................................................................... 199
Daniel Hoffmann
Tennis
13 Eine kompetenzorientierte Einordnung
zur Tennisvermittlung im Sportunterricht ............................................................................. 207
Philipp Born & Ralph Grambow
6
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 6 22.09.20 12:38Inhalt
14 Moderne spiel- und wettkampforientierte
Vermittlungskompetenz im Tennis ..................................................................................................... 218
Philipp Born & Dominik Meffert
Fußball
15 Spielorientierte Vermittlung technisch-taktischer Aspekte
im Sportspiel Fußball ............................................................................................................................................. 228
Martin Jedrusiak-Jung & Jörg Jakobs
16 Ein Leitfaden für eine Lehrprobe zur Planung,
Durchführung und Analyse im mannschaftstaktischen Rahmen
am Beispiel Fußball ................................................................................................................................................... 238
Gerd Merheim & Hans-Jürgen Tritschoks
Kampfsport
17 Vermittlungsmethoden: Kämpfen im Schulsport
im Spannungsfeld zwischen Tradition und Nichtlinearität ....................... 245
Susen Werner, Swen Körner & Mario S. Staller
18 Begrenzen für mehr Freiheit: Der Constraints-Led-Approach
als trainingspädagogische Perspektive auf das Design
von Lehr-Lern-Settings in- und außerhalb des Sports ........................................ 276
Swen Körner & Mario S. Staller
Autorenschaft ...................................................................................................................................................................... 300
Index .................................................................................................................................................................................................. 306
Bildnachweis ........................................................................................................................................................................... 320
7
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 7 22.09.20 12:389 Handlungsoptionen und Potenziale
eines geöffneten Schwimmunterrichts
– wirkungsvoll und motivierend
Schwimmen lehren
Luis Ohlendorf & Ilka Staub
Schwimmenlernen als anfänglicher und zentraler Auseinandersetzungsprozess mit dem
Element Wasser sollte freudvoll und motivierend gestaltet werden, denn Sicherheit im
und Freude am Wasser lassen sich nicht erzwingen, sondern entwickeln sich in den Ler-
nenden, wenn die Lernumgebung richtig gestaltet ist (Rheker, 2010).
Schwimmunterricht nach dem hier dargestellten Verständnis schafft daher eine Lernum-
gebung, in der die Schüler selbstbestimmt vielfältige Erfahrungen sammeln und ihren
individuellen Lernweg gehen können. Die Befriedigung des psychologischen Grundbe-
dürfnisses nach Selbstbestimmung gilt als wichtige Voraussetzung für intrinsisch moti-
viertes Handeln . Intrinsische Motivation ist jedoch nicht nur ein starker und nachhaltiger
Antrieb für den Lernprozess, sondern beeinflusst die Qualität des motorischen Lernens
auch direkt positiv (Wulf & Lewthwaite, 2016).
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse stellt das folgende Kapitel den geöffneten
Schwimmunterricht als methodischen Ansatz des Anfängerschwimmunterrichts dar, in
dem Schüler selbstbestimmt Schwimmen lernen. Es werden Möglichkeiten zur Unter-
richtsgestaltung begründet dargestellt und anhand von Beispielen aus der Unterrichts-
praxis verdeutlicht. Die so entstehenden Handlungsempfehlungen beschreiben einen
Unterrichtsrahmen, aufbauend auf einer umfassenden schwimmerischen Grundbildung
(s. Kap. 8).
149
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 149 22.09.20 12:38Ohlendorf & Staub
9.1 Zum Verständnis von geöffnetem Schwimmunterricht
Geöffneter Schwimmunterricht ist ein Unterricht, der Rahmenbedingungen für intrin-
sisch motiviertes Verhalten im Wasser schafft und so optimales und nachhaltiges Lernen
fördern soll. Der Begriff geöffnet wird verwendet, um zu verdeutlichen, dass die Rahmen-
bedingungen auf das selbstbestimmte Handeln der Lernenden ausgerichtet sind. Das
fordert Organisationsformen und Strukturen, die Freiheit und individuelle Gestaltung
zulassen und somit als offen(er) bezeichnet werden.
Theoretischer Exkurs
Das Motivationsspektrum der Selbstbestimmungstheorie nach Ryan und Deci (2017)
Tab. 9.1.: Das Motivationsspektrum der Selbstbestimmungstheorie in Anlehnung an Ryan und
Deci (2017)
Extrinsisch/
Autonomiegrad Regulation Grund des Verhaltens
intrinsisch
Selbstbestimmt/ Intrinsisch Intrinsische Interesse
autonom Motivation Freude
Den Werten entsprechend
Extrinsisch Integrierte Sinn und Notwendigkeit von Hand-
Regulation lungen wurden erkannt (identifiziert)
und werden in das eigene Wertesys-
tem integriert.
Identifizierte Handlungsgründe werden als sinn-
Regulation voll und/oder notwendig wahrge-
nommen.
Introjizierte Schuld
Regulation Scham
Angst vor Ablehnung
Ego
Externe Belohnung
Fremdbestimmt/
Regulation Bestrafung
kontrolliert
150
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 150 22.09.20 12:38Handlungsoptionen und Potenziale eines geöffneten Schwimmunterrichts
Begründet ist dieses Konzept auf der Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deci
(2017), die das Bedürfnis nach Selbstbestimmung als Grundlage für intrinsisch motivier-
tes Verhalten erklärt. Je mehr sich eine Person als Verursacher der eigenen Handlungen
und Erfahrungen erlebt, desto mehr können diese Handlungen und Erfahrungen als wert-
voll und in Übereinstimmung mit den eigenen Werten und Interessen wahrgenommen
werden und sind intrinsisch motiviert.
Extrinsisch motiviertes Verhalten, hervorgerufen durch z. B. Belohnungs- oder Bestra-
fungssysteme, zeichnet sich durch ein hohes Maß an Fremdbestimmung aus und gilt als
weniger nachhaltig (Deci, Koestner & Ryan, 1999). In Bezug auf das motorische Lernen
stellen Wulf und Lewthwaite (2016) fest, dass die Unterstützung des Bedürfnisses nach
Selbstbestimmung das motorische Lernen verbessert und fordern dazu auf, motorische
Lernprozesse so zu gestalten, dass über Wahlmöglichkeiten und eine autonomieunter-
stützende Sprache das selbstbestimmte Handeln und die Motivation der Lernenden ge-
fördert wird. Für die Unterrichtspraxis des Anfängerschwimmens ergeben sich hieraus
Möglichkeiten der praktischen Gestaltung, die im Folgenden in Form von Handlungs-
empfehlungen dargestellt werden.
Theoretischer Exkurs
Die OPTIMAL-Theorie nach Wulf und Lewthwaite (2016)
Die OPTIMAL-Theorie (Optimizing Performance through Intrinsic Motivation and
Attention for Learning) ist eine Theorie des motorischen Lernens, die den Einfluss
der Motivation auf motorische Lernprozesse erklärt. Es werden zwei Voraussetzun-
gen postuliert, die sich positiv auf die Motivation und motorische Lernprozesse
auswirken:
1) Eine positive Erwartungshaltung an die Ergebnisse einer Handlung (z. B. einer
motorischen Übung („Enhanced Expectancies“) wir handeln, wenn wir daran
glauben, positive (Lern-)Ergebnisse zu erzielen.
151
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 151 22.09.20 12:38Ohlendorf & Staub
Diese positive Erwartungshaltung lässt sich u. a. durch folgende Faktoren be-
einflussen:
positives Feedback;
die wahrgenommene Aufgabenschwierigkeit;
die Vorstellung über die eigenen Fähigkeiten (Selbstkonzept).
2) Selbstbestimmtes Handeln, also das Gefühl, die Ergebnisse einer Handlung
selber herbeigeführt zu haben („Autonomy“) wir handeln, wenn wir daran
glauben, positive (Lern-)Ergebnisse zu erzielen und das Gefühl haben, diese Er-
gebnisse selbst herbeigeführt zu haben.
Das Gefühl, selbstbestimmt zu handeln, lässt sich durch folgende Faktoren be-
einflussen:
Kontrolle über die Lernbedingungen durch die Lernenden;
Kommunikation der Lehrperson.
Schlussfolgerung:
Eine positive Erwartungshaltung gegenüber Ergebnissen einer (motorischen) Hand-
lung sowie selbstbestimmtes Handeln sind zwei wichtige Voraussetzungen für ge-
steigerte Motivation, diese Handlung auszuführen. Die Verbindung zwischen den
Zielen der Handlung und der Handlung selbst wird gestärkt, was zu verbesserter
motorischer Leistungs- und Lernfähigkeit führt („coupling of goals to action“).
152
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 152 22.09.20 12:38Handlungsoptionen und Potenziale eines geöffneten Schwimmunterrichts
9.2 Allgemeine Unterrichtsstruktur
Für die Planung von geöffnetem Anfängerschwimmunterricht lässt sich der Unterricht
grundsätzlich in drei organisatorische Einheiten unterteilen.
1. Gemeinsame Rituale: Der Unterricht beginnt und endet mit der ganzen Gruppe mit
wiederkehrenden Ritualen.
2. Übungsphasen (in Kleingruppen): Für einen begrenzten Zeitraum von nicht mehr
als 15 Minuten wird gezielt für bestimmte Teillernziele geübt. Hier bietet sich eine
Unterteilung der Gruppe in leistungshomogenere Kleingruppen an, ist aber nicht
zwingend erforderlich.
3. Offene Phase in einer Lernlandschaft: Eine gut vorbereitete Lernlandschaft mit viel-
fältigen Möglichkeiten, sich im Wasser auszuprobieren, hat einen hohen Aufforde-
rungscharakter und schafft für jedes Kind individuelle Lern- und Explorationszugän-
ge (Abb. 9.8).
Die Wassertiefe für den hier vorgestellten Unterricht beträgt ca. 75-80 cm, sodass die
Kinder stehen können. Grundsätzlich lassen sich die folgenden Empfehlungen auch im
für Kinder nicht stehtiefen Wasser umsetzen, erfordern dann allerdings eine engere Be-
treuung und Variation einiger Organisationsformen.
9.3 Einen klaren Rahmen für selbstbestimmtes Handeln schaffen
Begründung
Die Begriffe Autonomie und Selbstbestimmung im Lernkontext führen leicht zu der An-
nahme, Autonomieunterstützung im Unterricht bedeutet, die Schüler könnten völlig frei
machen, was sie wollen. Im Anfängerschwimmen würde das bedeuten, dass die Lehrkraft
die Schüler dauerhaft frei spielen ließe und sich lediglich um die Aufsicht kümmert und
Material bereitstellt.
Auch wenn solche Phasen durchaus ihre Berechtigung haben, sind sie nicht dauerhaft
und ausschließlich mit einem zielgerichteten Schwimmenlernen zu vereinbaren (Wilke &
153
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 153 22.09.20 12:38Ohlendorf & Staub
Daniel, 2007). Diese Arrangements fördern auch nicht zwingend das Gefühl der Selbst-
bestimmung der Lernenden. Eine klare Struktur und präzise Aufgabenstellungen sowie
Zielformulierungen in den Übungsphasen ermöglichen es den Schülern, den Lernfort-
schritt auf ihre eigenen Leistungen zurückzuführen und den Übungsprozess zu interna-
lisieren (Tab. 9.1).
Umsetzung
Ritualisierte Stundenbeginne und Abschlüsse.
Transparente Phasierung, sodass der Unterschied zwischen Übungsphasen und
offenen Spielphasen klar erkennbar ist.
Klar formulierte Teillernziele in der Übungsphase, die es den Schülern ermöglicht,
die Sinnhaftigkeit des Übens zu verstehen.
Eindeutige und verständliche Bewegungsanweisungen.
Praxisbeispiel
Anfangsritual
Als Anfangsritual lässt sich folgender Kinderreim gut nutzen:
Ene mene miste,
Es rappelt in der Kiste,
Ene mene meg,
Und wir sind weg!
Die Schüler stehen mit der Lehrkraft im Kreis in der Mitte des Beckens und tauchen
nach dem Aufsagen so gut sie können unter. Je nach Könnensstand kann das Un-
tertauchen mit kleinen Zusatzaufgaben verbunden werden:
Untertauchen mit Blubbern;
Augenzwinkern nach dem Tauchen, um das Wasser ohne Hilfe der Hände aus
den Augen zu bekommen;
sich auf den Boden setzen oder legen.
154
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 154 22.09.20 12:38Handlungsoptionen und Potenziale eines geöffneten Schwimmunterrichts
Teillernziel Gleiten
Der Sinn des widerstandsarmen Gleitens wird vielen Schülern deutlich, wenn sie,
wie in Abb. 9.2 und 9.6 dargestellt, die Möglichkeit bekommen, ihre zurückgelegte
Strecke zu messen und verschiedene Positionen zu erproben. Korrekturmaßnahmen
an der Gleitposition schaffen eine direkte und sichtbare Verbesserung und lassen
den Sinn der Übung deutlich werden.
Abb. 9.1: Der Start erfolgt in einer widerstandsarmen Gleitposition vom Beckenrand.
155
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 155 22.09.20 12:38Ohlendorf & Staub
Abb. 9.2: Durch die Markierungen am Beckenrand erhalten die Kinder eine direkte Rückmel-
dung über die von ihnen erreichte Weite.
156
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 156 22.09.20 12:38Handlungsoptionen und Potenziale eines geöffneten Schwimmunterrichts
9.4 Wahlmöglichkeiten lassen – in Übungsphasen
Begründung
Es ist mehrfach belegt, dass sich das motorische Lernen verbessert, sobald den Schü-
lern die Kontrolle über die Lernbedingungen gegeben wird (Sanli, Patterson, Bray & Lee,
2012). Einflussnahme führt zur verbesserten Informationsverarbeitung und zur besseren
Anwendung individueller Lernstrategien (Bund, 2004). Zusätzlich ist die Einflussnahme
ein entscheidender Mechanismus zur Befriedigung des Grundbedürfnisses nach Selbst-
bestimmung und der damit einhergehenden Förderung der intrinsischen Motivation
(Deci & Ryan, 2008; Wulf & Lewthwaite, 2016).
Über verschiedene Wahlmöglichkeiten im Laufe des Übungsbetriebs der Unterrichtsstun-
de bekommen die Schüler die Möglichkeit, Selbstkontrolle auszuüben (Abb. 9.3). Auch
wenn diese Wahlmöglichkeiten mit dem eigentlichen Übungsgegenstand nichts zu tun
haben und ihn scheinbar nicht beeinflussen, bleibt der positive Effekt auf die Motivation
und darüber auf das motorische Lernen erhalten (Wulf & Lewthwaite, 2016).
Umsetzung
Wahlmöglichkeiten entstehen durch den Einsatz unterschiedlicher
Wege durch das Becken, die verschiedene Aufgaben beinhalten und sich an den
Stufen der schwimmerischen Grundbildung (s. Kap. 8) orientieren;
Materialien, wie z. B. verschiedenfarbige Tauchringe, Bälle oder Bausteine
(Abb. 9.7);
Bewegungsaufgaben, wie z. B. Gleiten in Bauch- oder Rückenlage mit verschiede-
nen Armpositionen (Abb. 9.6).
157
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 157 22.09.20 12:38Ohlendorf & Staub
Praxisbeispiel
Organisationsform eines Übungsbetriebs
Im Gegensatz zur offenen Bewegungslandschaft ist der Übungsbetrieb oft stark reg-
lementiert. Das dargestellte Beispiel zeigt einen exemplarischen Aufbau, der unter-
schiedliche Wege, Materialien und Bewegungsaufgaben gut miteinander verbindet
und eine individuelle Impulsgebung zulässt.
1) Start, hier können von der Lehrkraft verschiedene Bewegungsaufgaben gestellt
werden (s. Kap. 8, Abb. 8.2).
2) Die Schüler dürfen sich für einen der beiden Rückwege entscheiden.
3) Gleitstation zur Erprobung verschiedener Gleitpositionen (s. Abb. 9.6)
4) Sprungstation mit der Möglichkeit, verschiedene Sprünge durchzuführen
(s. Abb. 9.5).
5) Untertauchen, unter Wasser ausatmen und in einem Reifen auftauchen und
Luft holen. So lässt sich das rhythmische Atmen erfahren.
6) Tauchstation mit verschiedenen Tauchgegenständen, die Tauchtiefe lässt sich
z. B. durch den Einsatz der Leitersprossen variieren (s. Abb. 9.7).
Eine alternative Form des Übungsbetriebs mit Schwerpunkt auf einer individualisier-
ten und strukturierten Rückmeldung wird in Kapitel 10.4 beschrieben.
Abb. 9.3: Gestaltungsmöglichkeit eines Übungsbetriebs mit verschiedenen Wahlmöglich-
keiten
158
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 158 22.09.20 12:38Handlungsoptionen und Potenziale eines geöffneten Schwimmunterrichts
9.5 Implizite Lernphasen ermöglichen –
in offenen Bewegungslandschaften
Begründung
Intrinsisch motiviertes Handeln drückt sich bei Kindern oft als Spiel aus (Meinel, Schna-
bel & Krug, 2015). Während des freien Spiels verfolgen die Schüler unbewusst bestimmte
Lernziele, dennoch machen sie eine Vielzahl an Erfahrungen und schaffen sich einen
eigenen Zugang zum Bewegungsraum Wasser. Völlig selbstbestimmt tauchen sie unter,
stoßen sich ab, öffnen vielleicht unter Wasser die Augen und fühlen sich zunehmend
sicher im Umgang mit dem Element Wasser. Freien Spielphasen sollte daher in jeder Un-
terrichtsstunde eine gewisse Zeit eingeräumt werden. Anregend gestaltete Bewegungs-
landschaften, die dazu auffordern, sich mit dem Wasser vielfältig auseinanderzusetzen,
bieten hier ideale Voraussetzungen.
Diese Bewegungslandschaften bedürfen einer vorausschauenden Planung und sollten
nicht dem Trugschluss zum Opfer fallen, dass Offenheit und Planung gegensätzlich zu
verstehen sind (Zimmer, 2003).
Umsetzung
Das Schaffen von Lernlandschaften mit unterschiedlichen Stationen ist eine gute
Möglichkeit, das freie Spiel anzuregen und für alle Lernenden Zugänge zu schaf-
fen (Abb. 9.8).
Die verschiedenen Stationen können sich an den vorgestellten Lerngelegenheiten
der schwimmerischen Grundbildung (s. Kap. 8) orientieren.
159
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 159 22.09.20 12:38Ohlendorf & Staub
Praxisbeispiel
Offene Lernlandschaft
Eine offene Lernlandschaft (Abb. 9.8) mit den folgenden Stationen:
1) Schwimmstation: Ein Teil des Beckens wird für Schüler, die bereits erste
Schwimmversuche oder andere Formen der Fortbewegung selbstständig durch-
führen möchten, zur Verfügung gestellt.
Abb. 9.4: Die Möglichkeiten der Fortbewegung können von den Kindern frei gewählt wer-
den. Dabei steht die Lehrkraft für Anregungen und Beobachtungen zur Verfügung.
160
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 160 22.09.20 12:38Handlungsoptionen und Potenziale eines geöffneten Schwimmunterrichts
2) Sprungstation: Von einer Matte oder einem kleinen Podest können verschiede-
ne Sprungmöglichkeiten und -aufgaben ausprobiert werden. Springen ist eine
attraktive Beschäftigung, die einen spielerischen Zugang zum Wasser oft gut
gewährleistet.
Abb. 9.5: Die Lehrkraft sorgt an der Sprungstation für die Einhaltung der Sicherheits- und
Verhaltensregeln.
161
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 161 22.09.20 12:38Ohlendorf & Staub
3) Gleiten: Drei Hütchen markieren verschiedene Streckenlängen. Die Schüler dür-
fen Gleitpositionen erproben und ihre eigene Strecke messen.
Abb. 9.6: Das Experimentieren mit verschiedenen Gleitpositionen führt zu Unterschieden in
der erreichten Weite und macht den Widerstand des Wassers direkt erfahrbar.
162
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 162 22.09.20 12:38Handlungsoptionen und Potenziale eines geöffneten Schwimmunterrichts
4) Tauchen: Ein Teil des Beckens wird für verschiedene Tauchspiele und Übungen
zur Verfügung gestellt. Tauchringe, andere Gegenstände und Reifen zum Durch-
tauchen schaffen vielfältige Anreize.
Abb. 9.7: Möglichkeiten zur Gestaltung einer Tauchstation (auch in Becken mit größerer
Wassertiefe realisierbar)
Abb. 9.8: Aufbau einer offenen Lernlandschaft mit vier Stationen
163
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 163 22.09.20 12:38Ohlendorf & Staub
9.6 Autonomieunterstützend sprechen und Feedback geben
Begründung
Im Schwimmunterricht in der Schule und im Verein spielt die Art und Weise, wie die Leh-
renden mit den Schülern umgehen, eine große Rolle. Es ist ihre Aufgabe, ein Lernumfeld
zu schaffen, in dem die Schüler gerne und motiviert lernen.
Wird unterstützende Sprache verwendet, die Perspektive der Lernenden eingenommen
und Anweisungen gut begründet, kann von autonomieunterstützender Unterrichtsfüh-
rung gesprochen werden (Reeve, 2016). Diese wirkt sich positiv auf die Motivation und
damit auf das motorische Lernen aus (Chang, Chen, Tu & Chi, 2016; Shen, McCaughtry,
Martin & Fahlman, 2009; Wulf & Lewthwaite, 2016).
Umsetzung
Verzicht auf kontrollierende Formulierungen wie: „Du musst“ oder: „Ich möchte,
dass du . . .“;
Einsatz von autonomieunterstützender Sprache wie: „Probiere doch mal . . .“ oder:
„Du kannst es auch so versuchen“;
sachliches und gut begründetes Feedback (s. Kap. 10.1).
164
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 164 22.09.20 12:38Handlungsoptionen und Potenziale eines geöffneten Schwimmunterrichts
Praxisbeispiel
Korrektur zur Kopfsteuerung
Bei Schülern, die in Rückenlage ihren Kopf stark zur Brust gebeugt haben, sinken
die Beine oft stark ab, sodass ein effizientes Gleiten oder Schwimmen auf dem Rü-
cken nicht möglich ist. Ein Feedback und ein Korrekturvorschlag im Sinne der Auto-
nomieunterstützung könnte lauten:
„Wenn dein Kopf so stark zur Brust geneigt ist, sinken deine Beine ab und das
Schwimmen wird viel anstrengender. Probiere doch mal, etwas weiter nach oben/
hinten zu schauen und teste, ob du so besser auf dem Wasser liegst.“
Zusätzlich dazu können Gegensatzerfahrungen mit verschiedenen Kopfhaltungen
dazu führen, dass die Lernenden die Wirkungsweise der Kopfsteuerung besser ver-
stehen und die Übungen so internalisieren können.
9.7 Individuelles Lerntempo zulassen
Begründung
Ein wichtiger Bestandteil von autonomieunterstützendem Unterricht ist, dass jeder Schü-
ler nach seinem individuellen Tempo lernen kann (Reeve, 2016). Im Anfängerschwim-
men unterscheiden sich die Fertigkeiten der Lernenden unter Umständen stark. Dieser
Heterogenität der Lerngruppen gerecht zu werden, ist eine Herausforderung. Die uner-
fahrenen Schüler dürfen nicht überfordert und die fortgeschrittenen nicht unterfordert
werden, um den Lernfortschritt jedes Einzelnen sicherzustellen.
Das ist nur zu gewährleisten, wenn die Lehrkräfte in der Lage sind, differenziert Aufga-
ben zu stellen und das individuelle Lerntempo der Lernenden zu berücksichtigen. Ein
geöffneter Schwimmunterricht, wie hier dargestellt, bietet gute Möglichkeiten, jedem
Kind die nötigen Herausforderungen zu ermöglichen und gleichzeitig den Freiraum für
eigenständige Lernprozesse in unterschiedlichen Lerntempi zuzulassen.
165
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 165 22.09.20 12:38Ohlendorf & Staub
Umsetzung
Strukturen schaffen, die Eins-zu-eins-Situationen von Lehrkräften zu Schülern er-
möglichen. So wird individuelle Diagnostik und Feedback möglich.
Für wichtige Teillernziele, wie das Untertauchen, in allen Unterrichtssituationen
Anreize schaffen.
Freiräume für implizites Lernen und exploratives Verhalten ermöglichen.
Praxisbeispiel
Untertauchen als zentrales Lernziel der schwimmerischen Grundbildung
Untertauchen gilt als das „Tor zum Schwimmen“ (Wilke, 1997, S. 16), es nimmt
also in Bezug auf das Schwimmenlernen eine Schlüsselrolle ein (s. Kap. 8.2). Für
Schwimmanfänger kann dieser wichtige Schritt aber eine große Hürde sein. Umso
wichtiger ist es, dass sie im Unterricht immer wieder ohne Zwang mit dem Tauchen
konfrontiert werden.
Aufgabe der Lehrenden ist es, eine Lernumgebung zu schaffen, in der Schüler immer
wieder mit dem Tauchen in einer Weise konfrontiert werden, die sie dessen Wert
erkennen lässt, sodass sie selbst tauchen wollen, denn dann haben sie das Tauchen
internalisiert. Im optimalen Fall ist das Tauchen Bestandteil jeder Phase und jedes
Spiels. Die Lernenden werden jedoch nicht gezwungen, zu tauchen und können
auch so am Unterricht teilnehmen.
Exemplarisch steht hierfür das Anfangsritual (s. Kap. 9.3). Dort dürfen die Schüler
selbst entscheiden, ob und wie weit sie untertauchen. Es ist also jedem Kind mög-
lich, zu Beginn der Stunde neu zu erleben, wozu es bereits in der Lage ist und was
ihm noch schwerfällt. Im Verlauf der Stunde erleben die unerfahrenen Schüler an-
dere Kinder, die durch das Tauchen den Bewegungsraum Wasser vielfältiger nutzen
und erkennen so schrittweise seinen Wert.
166
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 166 22.09.20 12:38Handlungsoptionen und Potenziale eines geöffneten Schwimmunterrichts
In der Übungsphase werden für Schüler, die noch nicht tauchen können, Lerngele-
genheiten geschaffen, die sie bestmöglich darauf vorbereiten (s. Kap. 8.2). Während
des freien Spiels mit den Mitschülern kommt es oft zu Situationen, in denen ganz
nebenbei Wasser ins Gesicht gelangt und untergetaucht wird (Abb. 9.4 und 9.5). So
kann jeder Lernende sein eigenes Lerntempo und seinen eigenen Lernweg wählen,
ohne von den Lehrenden unter Druck gesetzt zu werden.
Lernkasten
Geöffneter Anfängerschwimmunterricht bildet einen Rahmen, in dem Schüler
selbstbestimmt das Schwimmen lernen können. Er fördert so die intrinsische
Motivation und schafft Voraussetzungen für eine individuelle, vielseitige und
effektive schwimmerische Grundbildung.
Das psychologische Grundbedürfnis der Selbstbestimmung und das daraus re-
sultierende Motivationsspektrum ist in der Selbstbestimmungstheorie von Ryan
und Deci (2017) begründet.
Die OPTIMAL-Theorie von Wulf und Lewthwaite (2016) erklärt den positiven
Zusammenhang von intrinsischer Motivation durch Selbstbestimmung und
motorisches Lernen.
Ein geöffneter Anfängerschwimmunterricht ist in die drei organisatorischen Ein-
heiten gemeinsame Rituale, Übungsphasen (in Kleingruppen) sowie offene
Lernlandschaften unterteilt.
167
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 167 22.09.20 12:38Ohlendorf & Staub
Es ergeben sich folgende Handlungsempfehlungen:
Durch Rituale, gute Strukturierung und klare Zielformulierungen einen kla-
ren Rahmen für selbstbestimmtes Handeln schaffen.
Geleitete Übungsphasen erhalten durch Wahlmöglichkeiten z. B. der Wege
durch das Becken ein Element der Selbstbestimmung für die Schüler.
Durch geöffnete Lernlandschaften das implizite Lernen durch das Spielen
ermöglichen.
Autonomieunterstützend sprechen und Feedback geben, indem die Per-
spektive der Lernenden eingenommen und Anweisungen gut begründet
werden.
Individuelles Lerntempo zulassen, indem Eins-zu-eins-Situationen geschaf-
fen werden und exploratives Verhalten gefördert wird.
168
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 168 22.09.20 12:38Handlungsoptionen und Potenziale eines geöffneten Schwimmunterrichts
Literatur
Bund, A. (2004). Selbstbestimmtes Lernen im Sport: Eine Synopsis der sportpädagogischen
und bewegungswissenschaftlichen Problembehandlung. In M. Schierz & P. Frei (Hrsg.), Sport-
pädagogisches Wissen. Spezifik – Transfer – Transformationen. Schriften der Deutschen Verei-
nigung für Sportwissenschaft [dvs] (Bd. 141, S. 43-50). Hamburg: Czwalina.
Chang, Y.-K., Chen, S., Tu, K.-W. & Chi, L.-K. (2016). Effect of autonomy support on self-de-
termined motivation in elementary physical education. Journal of Sport Science and Medici-
ne, 15, 460-466.
Deci, E. L., Koestner, R. & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments exami-
ning the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125 (6),
627-668.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory. A macrotheory of human motiva-
tion, development, and health. Canadian Psychology, 49 (3), 182-185.
Meinel, K., Schnabel, G. & Krug, J. (2015). Bewegungslehre – Sportmotorik. Abriss einer Theorie
der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt (12. Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer.
Reeve, J. (2016). Autonomy-supportive teaching. What it is, how to do it. In W. C. Liu,
J. C. K. Wang, R. M. Richard (Eds.), Building autonomous learners. Perspectives from research
and practice using self-determination theory (1st ed., pp. 129-152). Singapore: Springer.
Rheker, U. (2010). Alle ins Wasser. Spiel und Spaß für Anfänger (3. Aufl.). Aachen: Meyer &
Meyer.
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory. Basic psychological needs in moti-
vation, development, and wellness. New York: Guilford Publications.
Sanli, E. A., Patterson, J. T., Bray, S. R. & Lee, T. D. (2012). Understanding self-controlled motor
learning protocols through the self-determination theory. Frontiers in Psychology, 3, 611.
Shen, B., McCaughtry, N., Martin, J. & Fahlman, M. (2009). Effects of teacher autonomy sup-
port and students’ autonomous motivation on learning in physical education. Research Quar-
terly for Exercise and Sport, 80 (1), 44-53.
169
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 169 22.09.20 12:38Ohlendorf & Staub
Wilke, K. (1997). Schwimmsport-Praxis: Schwimmen, Wasserspringen, Wasserball, Kunst-
schwimmen. Offizielles Lehrbuch des Deutschen Schwimm-Verbandes. Reinbeck bei Hamburg:
Rowohlt.
Wilke, K. & Daniel, K. (2007). Schwimmen. Lernen, üben, trainieren (6., überarb. und erw.
Aufl.). Wiebelsheim: Limpert (Praxisbücher Sport).
Wulf, G. & Lewthwaite, R. (2016). Optimizing performance through intrinsic motivation and
attention for learning. The OPTIMAL theory of motor learning. Psychonomic Bulletin & Re-
view, 23 (5), 1382-1414.
Zimmer, R. (2003). Sport und Spiel im Kindergarten (4. Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer.
170
20_09_21_Innenteil_Vermittlungskompetenzen_im_Sport.indd 170 22.09.20 12:38Sie können auch lesen