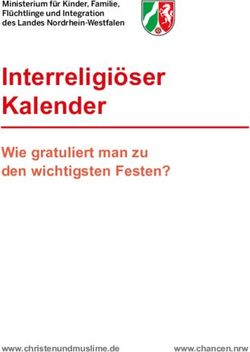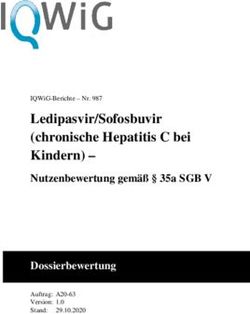Kinderschutz Eine Bestandsaufnahme für das Saarland
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kinderschutz
Eine Bestandsaufnahme
für das SaarlandEine Expertise für das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie im Saarland
Erstellt und herausgegeben über das Kompetenzzentrum
Kinderschutz in der Medizin
Baden-Württemberg (com.can)
Herausgegeben und bearbeitet von
Prof. Dr. Andreas Jud, Professur für Epidemiologie und
Verlaufsforschung im Kinderschutz in der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am
Universitätsklinikum Ulm, Kompetenzzentrums Kinder-
schutz in der Medizin
Prof. Dr. Jörg M. Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am
Universitätsklinikum Ulm, Leiter des Kompetenzzent-
rums Kinderschutz in der Medizin
Mit weiteren Beiträgen über das Kompetenzzentrum Kin-
derschutz in der Medizin von
Dr. Ulrike Hoffmann
Marion Jarczok
Prof. Dr. Miriam Rassenhofer
Dr. Cedric Sachser
Dr. Andreas Witt
23
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1 Methodisches Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Hauptergebnisse SWOT-Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.1 Strukturen und Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.2 Meldewege und Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.3 Stärkung präventiver Maßnahmen und Förderung der Früherkennung
von Missbrauch, Misshandlung und Vernachlässigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.4 Nachhaltige Konzepte zur Aus- und Fortbildung, zur Weiterqualifikation von Fachkräften . . . . . . 13
1.3 Überblick Expertise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2. Häufigkeit von Kindesmisshandlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1 Gefährdungseinschätzungen nach §8a SGB VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2 Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. Prävention und Schutzkonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1 Schutzkonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.1 Fortbildungsbedarf zu Schutzkonzepten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.1.2 Stand zur Umsetzung von Schutzkonzepten im Saarland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2 Fokus Prävention im schulischen Kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2.1 Übersicht zu Zugängen in der Prävention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2.2 Evidenz zu Prävention von Kindesmisshandlung im schulischen Kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.2.3 Übersicht zu wirksamer Prävention im Kontext Kinderschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4. Schutz und Hilfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.1 Rechtliche Rahmenbedienungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.1.1 Auszug aus Vorgehen bei einem Fall von Kindeswohlgefährdung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2 Überblick zur Evidenz der Wirksamkeit von Interventionen im Kinderschutz in Deutschland . . . . . . . . 50
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.3 Traumafokussierte Hilfen in Sozialpädagogik und Heilbehandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.3.1 Traumafokussierte Interventionen in der Heilbehandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.3.2 Traumafokussierte Hilfen in der Sozialpädagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5. „Good Practice“ im Kinderschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
5.1 Multidisizplinäre Abklärung und Hilfe unter einem Dach: Childhood-Häuser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.2 Mehr Beteiligung der Betroffenen bei der Lösungsfindung: Der Familienrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.3 Gestärkte Diagnostik im Kinderschutz: Die Kinderschutzambulanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.4 Täterprävention im sexuellen Missbrauch: „Kein Täter werden“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4Inhaltsverzeichnis
6. Strukturen des Kinderschutzes im Saarland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.1 Überblick über Organisationen im saarländischen Kinderschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.1.1 Strafverfolgung: Polizei und außerhalb der Polizei angesiedelte Unterstützungsstrukturen . . . . 69
6.1.2 Strafverfolgung: Staatsanwaltschaft und Strafgerichtsbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.1.3 Kinder- und Jugendhilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.1.4 Insoweit erfahrene Fachkräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6.1.5 Organisationen bei häuslicher Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.1.6 Medizinische Einrichtungen und Heilberufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.1.7 Schulen und schulnahe Dienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.2 Aus- und Weiterbildung von Fachkräften im Kinderschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.2.1 Kinder- und Jugendhilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.2.2 Medizinisch-therapeutischer Bereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.2.3 Pflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6.2.4 Juristischer Bereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6.2.5 Polizei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6.2.6 Pädagogischer Bereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
7. Empfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.1 Übergreifende Themen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.1.1 Orientierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.1.2 Qualifizierung von Profis und Laien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
7.1.3 Flächendeckende Umsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.1.4 Reziprozität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7.1.5 Zeitdimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7.2 Lösungsansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7.2.1 Verstärkte Vernetzung über Fachkonferenzen und Kinderschutzportal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.2.2 Landesweite Fortbildungsoffensive durch E-Learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.2.3 Verpflichtende Implementierung qualitätsgesicherter Schutzkonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.2.4 Kinderschutzbeauftragte*r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.2.5 Weitergehende mittelfristige Empfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.2.6 Langfristige Empfehlung und Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Zitierte und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
8. Anhänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
8.1 Algorithmisches Ablaufschema aus Text Fegert et al. (2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
56
Einleitung
7Einleitung
Die vorliegende Expertise bietet einen Überblick über aus- schutzfall, den Fall „Marry-Ellen“ in der zweiten Hälfte
gewählte aktuelle Erkenntnisse im Kinderschutz mit Fo- des 19. Jahrhunderts in New York bezogen (vgl. Fegert et
kus auf die Situation und Herausforderungen im Saarland al., 2010). Die öffentliche Debatte über solche Fälle, die
zum Ende des zweiten Jahrzehnts des neuen Jahrtausends. die staatliche Gemeinschaft oder wenigstens größere Be-
Nach der Einführung der gewaltfreien Erziehung ins BGB völkerungsgruppen und die Politik für die drängenden
zur Jahrtausendwende hat sich der Kinderschutz in Herausforderungen im Kinderschutz sensibilisiert, war
Deutschland zunächst durch die Debatte und spätere wiederholt der Ausgangspunkt für Verbesserungen im
Etablierung der Frühen Hilfen dann 2010 durch den so Kinderschutz. So war es auch beim Thema „sexueller
genannten „Missbrauchsskandal“ und den Runden Tisch Missbrauch“ der mutige Schritt von Pater Mertes, der am
sexueller Missbrauch erheblich weiterentwickelt. Auf 28. Januar 2010, als damals verantwortlicher Schulleiter
Bundesebene ist ein Unabhängiger Beauftragter sexueller des Berliner Canisius-Kolleg sich an die potentiell Betrof-
Kindesmissbrauch (UBSKM) mittlerweile dauerhaft etab- fenen wandte und für seine Institution die Verantwortung
liert worden. Ende des Jahres 2019 ist ein Nationaler Rat übernahm und die Betroffenen auffordert sich an ihn
gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu wenden.
gegründet worden, an dem die beteiligten Bundesministe-
rien und Fachministerkonferenzen vertreten sind. Auch Das Saarland möchte sich bei dieser Entscheidung über
einer der Autoren (Prof. Dr. Jörg M. Fegert ist als Vor die künftigen Strukturen und die Weiterentwicklung im
sitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Familien Kinderschutz, durch eine Expertenkommission beraten
fragen) ist Mitglied dieses Nationalen Rats. Der UBSKM, lassen. Die Expertenkommission ist am 23. August 2019
Herr Rörig, hat nach der definitiven Verstetigung der von berufen worden und hat an bisher drei Sitzungen getagt.
ihm geleiteten Institution und des Betroffenenrats, sowie Begleitend zur Expertenkommission sind Prof. Dr. Jörg M.
nach der Verlängerung des Mandats der Aufarbeitungs- Fegert und Prof. Dr. Andreas Jud, beide Kinder- und
kommission, die Bundesländer aufgefordert eigene, ähn- Jugendpsychiatrie / Psychotherapie am Universitätsklini-
liche Strukturen mit Beauftragten aufzubauen. kum Ulm und berufene Mitglieder der Expertenkommis-
sion, beauftragt worden eine Expertise und Bestands
Leider mit den Namen der betroffenen Kinder verbundene aufnahme zum Kinderschutz im Saarland zu schreiben.
„Skandalfälle“ wie „Kevin“ oder „Lea-Sophie“ haben die
politische und die fachliche Entwicklung im Kinderschutz
durch das damit verbundene große öffentliche Interesse 1.1 Methodisches Vorgehen
vorangebracht. Die Debatte im Saarland wird derzeit mit In die Expertise flossen unterschiedliche Formen der Wis-
geprägt durch den Missbrauchsverdacht gegen einen ver- sensgenerierung ein. Sie fasst einerseits aktuelle Evidenz
storbenen ehemals im Universitätsklinikum Homburg/ zu Kinderschutzmaßnahmen zusammen und bespricht
Saar tätigen Assistenzarzt in der Kinder- und Jugendpsy- Diskurse in der Fachliteratur. Um aktuelles Kontextwissen
chiatrie. In Bezug auf diesen Fall sind verschiedene recht- zum Saarland in breiter Form einzubringen, wurde die Ex-
liche Verfahren, u.a. Disziplinarverfahren anhängig und pertise um zwei weitere Zugänge der Wissensgenerierung
ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss hat seine ergänzt. Verschiedene mit Kinderschutz befassten Minis-
Arbeit dazu noch nicht abgeschlossen. Dieser Fall war terien im Saarland (Ministerium für Inneres, Bauen und
nicht Auslöser für die Einsetzung einer Expertenkommis- Sport; Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und
sion und auch nicht Gegenstand dieser Expertise, gleich- Familie; Ministerium für Bildung und Kultur; Ministerium
wohl muss dieser Fall erwähnt werden, da durch die poli- der Justiz) haben Berichte zu ihren kinderschutzspezifi-
tische Auseinandersetzung um diesen Fall generell die schen Strukturen und Programmen verfasst. Die Berichte
Frage der Schutzkonzepte in Institutionen und die Frage wurden durch gezielte Nachfragen in der Verwaltung und
der Kooperation einzelner Institutionen, gerade im Saar- bei Expert*innen ergänzt. Einen entscheidenden Teil
land 2019 eine besondere Aufmerksamkeit erhalten hat macht die Perspektive der Fachkräfte im Saarland aus.
und eine besondere Motivationslage besteht für die 20iger Über 100 Fachkräfte aus allen Regionen des Saarlands und
Jahre dieses Jahrtausends grundsätzliche Verbesserungen den unterschiedlichen Berufsgruppen, die mit Kinder-
anzustreben. Dies entspricht soziologisch dem seit länge- schutz beschäftigt sind, haben sich am 17. Oktober 2019
rer Zeit beschriebenen Phänomen des politischen Agenda- während eines Tages in verschiedenen Workshops zur
Settings durch mediale Kinderschutzskandale, welche Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
über den Einzelfall hinaus die gesellschaftliche Ver getroffen. Die Anfangsbuchstaben der entsprechenden
antwortung für Kinder und Jugendliche deutlich machen. englischen Begriffe (Strengths, Weaknesses, Opportuni-
Der britische Soziologe King hat dies folgendermaßen be- ties, Threats) bilden zusammen das Akronym SWOT, das
schrieben: “In this category of agenda it is not individuals, die Methode für die Workshops beschreibt, die in den 1960
but social systems which are being unjust to children” Jahren an der Harvard Business School entwickelt wurde.
(King, 1999). Er hat sich dabei auch historisch auf den ers- Die Methodik der SWOT-Analyse beinhaltet auf der
ten prominenten, in der Presse skandalisierten Kinder- einen Seite die Benennung von Stärken und Schwächen
8Einleitung
der eigenen Organisation, von deren Angebot, der Qualität ventiver Maßnahmen und Förderung der Früherkennung
der Leistungserbringung, deren Strukturen, Standards, von Missbrauch, Misshandlung und Vernachlässigung“
Abläufen und so weiter. Auf der anderen Seite werden die und „Nachhaltige Konzepte zur Aus- und Fortbildung, zur
Chancen und Risiken für die Organisation benannt, die Weiterqualifikation von Fachkräften“ gewidmet haben.
aufgrund von gesellschaftlichen, politischen und rechtli- Die Themen wurden vorgängig durch die Kommission
chen Entwicklungen für die Organisation bestehen bzw. Kinderschutz beschlossen. Am Nachmittag wurden in den-
sich ergeben könnten (Grafik 1). selben Gruppen zu denselben Themen Lösungsansätze und
Ideen für identifizierte Lücken diskutiert und im Plenum
positiv negativ vorgestellt. Von Prof. Fegert wurden erste übergreifende
Themen identifiziert (vgl. 7.1 Übergreifende Themen). Die
Stärken Schwächen SWOT-Analyse ist in einem anschließenden Kapitel zu
intern (strengths) (weaknesses) sammenfasst. Sie wurde umfangreich dokumentiert und
steht auch in den Anhängen der Expertise zur Verfügung.
Eindrücke sind in Abbildung zwei zusammengestellt.
Chancen Risiken
extern (opportunities) (threats) In dieser Zusammenschau nicht berücksichtigt ist eine
Perspektive der Betroffenen, die eine umfangreiche Da-
tenerhebung nötig gemacht hätte. Der vermehrte Einbe-
Grafik 1: SWOT-Analyse zug der Betroffenen in die weitere Entwicklung von Unter-
stützungsangeboten, ihre Partizipation im Prozess, kann
Nach einer Begrüßung durch Staatssekretär Stephan Kol- jedoch bereits jetzt als Anliegen für die weitere Entwick-
ling und einem Inputreferat durch Prof. Dr. Jörg M. Fegert lung des Kinderschutzes im Saarland benannt werden. Da
wurden die Teilnehmenden in acht extern moderierte keine Evaluation oder Studie zu Folgen oder Wirksamkeit
Gruppen unterteilt, wobei sich je zwei Gruppen einer von Kinderschutzmaßnahmen und Angeboten im Saar-
Bestandsaufnahme zu den Themen „Strukturen und Pro- land stattgefunden haben, kann auch zu diesen Bereichen
zesse“, „Meldewege und Kommunikation“, „Stärkung prä- keine Aussage getroffen werden.
Abbildung 1: Bildeindrücke von der SWOT-Analyse am 17.10.2019
9Einleitung
1.2 Hauptergebnisse SWOT-Analyse ner aktuell gehaltenen, einfach verfügbaren Liste an Ein-
richtungen und Organisationen im weiten Netz des Kin-
Die Ergebnisse der SWOT-Analyse in acht Gruppen zu vier
derschutzes. Mit dem Thema mangelnder Übersichtlichkeit
übergeordneten Leitfragen werden im Folgenden grafisch
verknüpft ist der vielfach kritisierte Mangel an gemeinsa-
und als Text zusammengefasst. Berücksichtigt werden da-
mer Sprache. Für den Einzelfall findet zwar ein Austausch
bei einerseits die häufigsten Aussagen für die jeweiligen
zwischen den Organisationen statt – der Dialog als Ge-
Leitfragen sowie zusätzlich einzelne Voten, die besonders
wohnheit wird entsprechend positiv hervorgehoben –,
aufgefallen sind und aus Sicht der Verfasser eine treffliche
allerdings fehlt weitgehend ein fachlichinhaltlicher Aus-
Analyse darstellen. Festzuhalten bleibt, dass die Sichtwei-
tausch, der über den intensiven Dialog im Einzelfall
se der im Feld tätigen Fachkräfte nicht immer mit tatsäch-
hinausgeht und ein gemeinsames Verständnis von Kon-
lich vorhandenen Angeboten, Prozessen oder Vorgaben
zepten und Prozessen fördern würde. Die Fachkräfte hiel-
übereinstimmen muss. Entsprechende Diskrepanzen sind
ten fest, dass der Diskurs über Begriffe und Konzepte vor
jedoch wichtige Hinweise auf eine potentiell unzureichende
allem innerhalb der eigenen Disziplin oder Profession
Information zu Programmen und Angeboten.
stattfände oder innerhalb des eigenen Versorgungsbe-
Die fruchtbaren Lösungsansätze, die von den Gruppen am
reich. Die kurzen Wege im Saarland, die Vernetzung die
Nachmittag der SWOT-Analyse ausgearbeitet wurden,
über die Einzelperson hinausgeht wurde von den Gruppen
sind weitgehend in den Lösungsansätzen unter 7.2 mitauf-
nicht primär als eigene Stärke, sondern als Chance wahr-
genommen und werden primär an dieser Stelle diskutiert.
genommen, die sich durch die geografische Kleinräumig-
keit ergibt und zum eigenen Vorteil genutzt werden kann.
1.2.1 Strukturen und Prozesse Als Chance wird dabei wahrgenommen, dass die enge Ver-
Unter den Leitfragen „Wie sind wir im Saarland aus ihrer netzung künftig auch leichter zu einem flächendeckenden
Sicht strukturell aufgestellt?“, „Wo sind Schnittstellen?“ Screening von im Kinderschutz führen könnte, so dass
und „Wie laufen Verfahrenswege?“ wurde als eigene Stär- Kinderschutzfälle bereits möglichst früh erkannt werden.
ke wiederholt das dichte Netz an Beratungsstellen festge- Weiter wurde die Umsetzung von Schutzkonzepten an
halten. Zwar wurde festgehalten, dass die verschiedenen Schulen als Stärke genannt. In der nachfolgenden Diskus-
Organisationen im Netzwerk durchaus bekannt, gleich- sion zu den Voten und in der Diskussionsrunde zu den Lö-
zeitig führte die Diskussion unter den Fachkräften aus sungsansätzen wurde die Umsetzung von Schutzkonzep-
unterschiedlichsten Einrichtungen und Disziplinen zur ten kritischer wahrgenommen. Es wurde gefordert, dass
Feststellung, dass das dichte Netz nicht unbedingt über- die Implementierung von Schutzkonzepten in Schulen
sichtlich und nicht durchgängig transparent ist (Grafik 2). und anderen mit Kinderschutz befassten Einrichtungen
Eine teilnehmende Person hielt anekdotisch zu Übersicht- nicht freiwillig, sondern verpflichtend sein sollte. Eine Be-
lichkeit und Transparenz fest: „Gab’s da nicht mal eine gleitung und Unterstützung in der Umsetzung der Schutz-
Clearing-Stelle?“. Es fehlt nach den Teilnehmenden an ei- konzepte soll zu deren Qualitätssicherung beitragen.
Mangel an Übersichtlichkeit und Transparenz
dichtes Netz an Beratungsstellen («gab‘s da mal eine Clearing-Stelle»)
Umsetzung von Schutzkonzepten an Schulen mangelnde Einbindung Sport («Autonomie
des Sports»; Einwirkung über Zuwendungen)
Dialog als Gewohnheit
Mangel an gemeinsamer Sprache
kurze Wege und Vernetzung, Kontakte
weitgehend rechtsfreier Raum Internet
sind nicht auf Einzelpersonen beschränkt
fehlender Informationsfluss durch
durch gute Vernetzung flächendeckendes
Länder- und Staatsgrenzen
Screening möglich
zunehmender Datenschutz als Gefahr
großes Innovationspotential: Ideen sind da,
für Kinderschutz
Mangel an Ressourcen für Umsetzung
Grafik 2: Zusammenfassung SWOT für Leitfragen Strukturen und Prozesse
10Einleitung
An einem der beiden Tische zu Strukturen und Prozessen nen adäquaten Kinderschutz erschwert hat. Hier wurde
wurde auch besonders intensiv und kritisch über die man- die Forderung formuliert, dass das Land auch auf Bundes-
gelnde Einbindung des Sports bei Kinderschutzthemen ebene darauf hinarbeiten soll, dass wechselseitige Mittei-
gesprochen, dass er sich bisweilen auch ungerechtfertigt lungen zwischen den zentralen Akteuren im Kinderschutz
auf die „Autonomie des Sports“ berufen würde. Schutz- situationsangemessen möglich sind.
konzepte und damit verbundene Maßnahmen hätten noch Abschließend bleibt zum Thema Strukturen und Prozesse
kaum Eingang in den Sportbereich gefunden. Um diesem festzuhalten, dass die Teilnehmenden viele Ideen zur Ver-
Mangel entgegenzuwirken wurde u.a. vorgeschlagen, dass besserung im Kinderschutz und ein großes Innovations-
verbesserter Kinderschutz im Sport auch über Zuwendun- potential im Saarland wahrnehmen. Es bräuchte vor allem
gen gesteuert werden könnte. Sportvereine und auch auch angemessene Ressourcen, um diese innovativen
andere Vereine im Freiwilligenbereich könnten sich mit Konzepte zur Umsetzung zu bringen.
einem Kinderschutz-Label zertifizieren, wobei die Zu-
wendungen an das Label geknüpft werden könnten. 1.2.2 Meldewege und Kommunikation
Als allgemeine Gefahren im Umfeld, die nicht saarland- Leitfragen für die zwei Tische zu Meldewegen und Kom-
spezifisch sind, das Saarland aber genauso betreffen, wur- munikation waren: „Wie klappt die Zusammenarbeit und
den die Gefahren im Internet benannt. Das Internet und die Kommunikation? Wer meldet wem? Und wann?“ Häu-
vor allem auch der als Darknet bezeichnete Teil davon fig genannte Antworten decken sich teilweise mit den Ant-
wurden von der Praxis als weitgehend rechtsfreier Raum worten zu den Strukturen und Prozessen im vorherigen
benannt, indem jedoch ein bedeutsamer Teil des Aufwach- Unterkapitel. So wurden als Stärken wiederholt auf die
sens von heutigen Kindern und Jugendlichen stattfindet, gute Kooperation im großen Netzwerk und die kurzen
wobei die Bedeutung wohl eher noch zunimmt. Die relative Wege zwischen den Organisationen im Saarland hinge-
Kleinräumigkeit des Saarlands wurde neben der Chance wiesen. Auch die verbreiteten und geschätzten Schutzkon-
der kurzen Wege auch als Gefahr wahrgenommen, da Lan- zepte wurden wiederholt positiv hervorgehoben. Auch
des- aber auch Staatsgrenzen stets nah sind. Diese würden hier wurde dann allerdings in der Diskussion zu Lösungs-
bei Wohnortswechseln von Familien den Informations- wegen noch Lücken mit Blick auf die flächendeckende Um-
fluss durch unterschiedliche Prozesse und Rechtsgrund- setzung herausgestrichen und die Forderung nach ver-
lagen, aber auch durch unterschiedliche Sprachen er- pflichtender Implementierung in allen von Kinderschutz
schweren. mitbetroffenen Bereichen geäußert (Grafik 3).
In fast einhelliger Übereinstimmung mit vielen Tischen
unabhängig von der Leitfrage wurde der Datenschutz im Erneut kritisch wurde die relative Kleinräumigkeit des
Kontext des Kinderschutzes als teilweise problematisch Saarlands mit stets nahen Grenzen benannt und die damit
benannt. Verschiedene Beispiele wurden benannt, wo der verbundene teilweise fehlende Übertragung von Daten bei
durch Datenschutz eingeschränkte Informationsfluss ei- Wohnortwechsel. Problematisch wurde außerdem von
mangelnde pers. Ressourcen/hohe Fluktuation
Schutzkonzepte sind verbreitet Forschung wird zu wenig in Praxis bekannt
und werden geschätzt
ungenügende Vernetzung mit Schule
gute Kooperation im großen Netzwerk und schulischen Diensten
und kurze Wege
fehlende Übertragung von Daten
bei Wohnortwechsel über Grenzen hinweg
im Konflikt zwischen Datenschutz
Thema Kinderschutz bekommt
und Mitteilungs(pflicht)
notwendigen Stellenwert
unterschiedliche Sprachen und
Implementierung von Beteiligungssystemen
unklare Zuständigkeiten führen zu
ist Vorgabe
Verantwortungsdiffusion
Grafik 3: Zusammenfassung SWOT für Leitfragen Meldewege und Kommunikation
11Einleitung
Vertreter*innen mehrerer Organisationen der Mangel an Erneut sind auch die Hürden im Datenschutz für den Kin-
personalen Ressourcen sowie die hohe Fluktuation unter derschutz ein Thema und die damit bisweilen verbunde-
Mitarbeitenden gesehen. Zu ergänzen ist, dass diese bei- nen ungenügenden Möglichkeiten zur Mitteilung zwi-
den Punkte keineswegs auf das Saarland beschränkt sind, schen den Akteuren. Lobend hervorgehoben wird, dass die
sondern besonders für den Bereich der Kinder- und Ju- Regierung im Saarland gerade auch mit der Errichtung
gendhilfe bundesweit regelmäßig als Schwäche gesehen der Kommission Kinderschutz und den Einbezug der
werden. Auch der Transfer zwischen Forschung und Pra- ganzen Bandbreite an Akteuren im Kinderschutz für die
xis, der mehrfach benannt wurde, ist eine Lücke, die nicht SWOT-Analyse dem Kinderschutz den notwendigen Stel-
nur das Saarland betrifft. Die Fachkräfte haben erwähnt, lenwert in der politischen Agenda einräumt.
dass sie immer wieder erstaunt seien, was schon beforscht
wurde, wovon sie jedoch kaum was mitbekämen. Zusam- 1.2.3 Stärkung präventiver Maßnahmen und
men mit den ebenfalls benannten unterschiedlichen Spra- Förderung der Früherkennung von Missbrauch,
chen zwischen den Disziplinen und Professionen führte Misshandlung und Vernachlässigung
das zu Lösungsideen, dass ein halbtätiger Austausch im Zwei weitere Tische haben intensiv zur Leitfrage „Wie
Saarland über die Professionsgrenzen hinweg, wie in der steht es um die Prävention und Früherkennung?“ und der
SWOT-Analyse gestartet, auch künftig in regelmäßigen unmittelbar anknüpfenden Frage „Wer ist involviert und
Abständen wiederholt werden sollte. Dabei sollten stets mit welchen Mitteln?“ diskutiert. Als Stärke wiederholte
auch aktuelle Themen aus der Forschung eingebaut wer- sich das große Netzwerk mit fallbezogen guter interdiszi-
den. plinärer Zusammenarbeit und kurzen Wegen im räumlich
kleinen Saarland (Grafik 4). Mehrfach besonders her
Die insgesamt als eng gesehene Verzahnung zwischen den vorgehoben wurde die engagierte Fachberatung der Ein
Akteuren im Netzwerk des Kinderschutzes wurde für den richtungen Nele und Phoenix. Dennoch wurde auch hier
Bereich der Schule als kritisch gesehen. Schulische Akteu- kritisch bemerkt, dass die gute Vernetzung meist am Ein-
re wären noch mangelhaft in die Netzwerke eingebunden, zelfall orientiert ist und darüber hinaus wenig fachlich-in-
nicht immer bestünden direkte Verknüpfungen zwischen haltlicher Austausch stattfindet, was sich in einem Mangel
Personen. Die als Gefahr ausgemachten unklaren Zustän- an gemeinsamer Sprache äußert. Verbindliche Verein
digkeiten und damit verbundene Verantwortungsdiffusi- barungen zwischen den Akteuren und ein regelmäßiger
on – wer soll als nächster handeln, wer ist für den Prozess fachlicher Austausch an Konferenzen böten hier die Chance
verantwortlich – knüpfen an den Mangel an Klarheit und für verbesserte Abläufe.
Transparenz an, der unter Strukturen und Prozessen be-
nannt wurde. Auch hier wurde die Forderung nach einer Nicht nur Staatssekretär Kolling in seinem Eingangsrefe-
einfach zugänglichen Liste an Einrichtungen in einem rat auch diverse Fachkräfte haben das starke Netzwerk
Portal als Lösungsansatz aufgeworfen. Frühe Hilfen hervorgehoben. Ebenso wurden die starken
Mangel an gemeinsamer Sprache
engagierte Fachberatung (Nele/Phoenix)
zu knappe Untersuchungszeiten
Netzwerk Frühe Hilfen
zu wenig Angebote für sexuell übergriffige
großes Netzwerk mit guter interdisziplinärer Jugendliche/«Opfer-Täter»
Zusammenarbeit und kurzen Wegen
...werden nicht in Fläche umgesetzt, sondern
starke Präventionsangebote... sind auf spezifische Beratungsstelle beschränkt,
fehlende Finanzierungsmöglichkeiten
funktionierende Konzepte «neu» entwickeln dünne Personaldecke und Personalfluktuation
bessere Abläufe durch verbindliche Vereinbarungen Datenschutz im Widerspruch zu Kinderschutz
zwischen Akteuren
Erstkontakt maßgeblich für Vertrauen ins System
anonymer Zugang
zu insoweit erfahrenen Fachkräften viele versuchen das Rad neu zu erfinden
Grafik 4: Zusammenfassung SWOT für Leitfragen Prävention und Früherkennung
12Einleitung
Präventionsangebote benannt, dabei aber kritisiert, dass Schließlich wird erneut auf den teilweisen Widerspruch
diese nicht durchgehend in der Fläche umgesetzt würden, zwischen Datenschutz und Kinderschutz hingewiesen,
sondern bisweilen auf spezifische Beratungsstellen be- der an vorangegangenen Stellen bereits ausführlicher auf-
schränkt blieben. Außerdem wurden fehlende Finanzie- genommen wurde. Als allgemeine Gefahr benannt, mit
rungsmöglichkeiten in der Prävention hervorgehoben. Als der man aber klarkommen müsse, wird der Punkt, dass
spezifische Lücke wurden fehlende Angebote für sexuell der erste Eindruck im Kinderschutz entscheidend sei.
übergriffe Jugendliche benannt. Oft seien Täter*innen in Wenn die Stelle, an die Betroffenen als erste hingelangen,
ihrer Kindheit auch bereits selbst gewaltbetroffen gewe- wenig glücklich agiere, sei nachher oft nur wenig zu retten.
sen. Vorhandene Interventionen berücksichtigten noch Als Chance wiederum, die bundesweit vorhanden ist, wird
ungenügend diese Verknüpfung im Gewaltzyklus von der anonyme Zugang zu insoweit erfahrenen Fachkräften
selbst betroffen und später gewaltausübend. benannt.
Auch hier an den Tischen zu Prävention und Früherken- 1.2.4 Nachhaltige Konzepte zur Aus- und Fort
nung wurde teils auf die ungenügende Kenntnis von An- bildung, zur Weiterqualifikation von Fachkräften
geboten verwiesen und den Lösungsansatz, dass Informa- Schließlich wurden an zwei weiteren Tischen Leitfragen
tionen zentral in einem Internetportal verfügbar sein zu Aus- und Fortbildung, zur Weiterqualifikation disku-
müssten. Bei besserer Bekanntheit von Angeboten ließe tiert: „Wie sind Fachkräfte im Saarland für den Kinder-
sich auch die Schwierigkeit verringern, dass viele versu- schutz qualifiziert? Welche Fortbildungen und Weiter-
chen würden, zu Problemen im Kinderschutz das Rad neu qualifikationen werden angeboten und genutzt?“ Als
zu erfinden. Diese Gefahr wird aber als übergreifend, Stärke hervorgehoben wurden die spezifischen Aus- und
nicht als saarländische Schwäche benannt. Damit verbun- Fortbildungsmöglichkeiten im Saarland, namentlich die
den ist auch die Chance, funktionierende Konzepte „neu“ Ausbildung zur Familienhebamme und das Allein
zu entwickeln. Gemeint ist damit eben nicht die „Neu“-Er- stellungsmerkmal „Opferschutz“ als Pflichtthema bei der
findung, sondern die adaptierte Umsetzung gelungener polizeilichen FH-Ausbildung (Grafik 5). Im erweiterten
vorhandener Konzepte in der Fläche. Kontext wurden die pädagogischen Tage in der Lehrer*
innenfortbildung herausgestrichen.
Für den medizinisch-heilberuflichen Bereich wurde auf
zu knappe Untersuchungszeiten verwiesen als Thema, das Wie in allen übrigen sechs Tischen wurden auch an den
primär auch mit Ressourcen verknüpft ist. Für unter- beiden Tischen zu Aus- und Weiterbildung die gute Ver-
schiedliche Berufsgruppen wurde auch an diesen Tischen netzung der Akteure im Saarland benannt, aber gleichzei-
die bereits andernorts mehrfach erwähnte dünne Perso- tig auch der Mangel an Transparenz und gemeinsamer
naldecke und hohe Personalfluktuation als problematisch Sprache hervorgehoben. Für den Weiterbildungsbereich
benannt. äußerte sich dieser darin, dass die Weiterbildung kaum je
Weiterbildung in disziplinären Silos
spezifische Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten
(mangelnde Transparenz,
im Saarland
fehlende gemeinsame Sprache)
Familienhebamme
Umsetzung von Schutzkonzepten wird
nicht begleitet/kontrolliert
Alleinstellungsmerkmal «Opferschutz»
als Pflicht bei FH-Ausbildung Polizei
wenig Möglichkeiten zur Fehleranalyse
dünne Personaldecke und starke Fluktuation
diverse E-Learning-Angebote zum Kinderschutz im Konflikt mit teils teuren Weiterbildungen
Pädagogische Tage in 4 Städten 2019 – 2020 höhere Sensibilität führt zu höheren Fallzahlen
gute Vernetzung ermöglicht Kennenlernen fehlende Angebote für «Systemsprenger»
von Arbeitsweisen
wir erreichen häufig nur die bereits «Konfirmierten»
Grafik 5: Zusammenfassung SWOT für Leitfragen Aus- und Fortbildung, Weiterqualifikation
13Einleitung
gemeinsam über professions- und disziplinengrenzen
1.3 Überblick Expertise
hinweg stattfände, sondern weitgehend in disziplinären
In den folgenden Kapiteln werden zunächst Evidenz und
„Silos“. Auch die dünne Personaldecke und die starke Per-
Fachliteratur dargestellt, die in weiten Teilen die Praxis
sonalfluktuation waren wiederum Thema. Für den Kon-
des Kinderschutzes in der Bundesrepublik Deutschland
text Weiterbildung steht diese Problematik in einem heik-
als Ganzes betreffen. Folgerungen daraus sind dennoch
len Teufelskreis. Durch die hohe Fluktuation müssen
auch für das Saarland abzuleiten. Entsprechend werden
wiederholt neue Personen weitergebildet werden, die Wei-
im Anschluss an jedes Kapitel zweierlei Empfehlungen
terbildungen sind aber oft auch eher teuer und machen die
formuliert, solche die bundesweit angebracht sind und sol-
Entscheidung für die Nutzung dieser Angebote bei knap-
che mit Fokus auf das Saarland. Anschließend an die Evi-
pen Ressourcen nicht einfacher. Die aus Sicht der Fach-
denz zu verschiedenen Themen im Kinderschutz werden
kräfte meist fehlende Verbindlichkeit von Weiterbildun-
die spezifischen Strukturen im Saarland besprochen und
gen im Kinderschutz führt dazu, dass oft nur „bereits
in den gesamtdeutschen Kontext eingeordnet, um daraus
Konfirmierte“ erreicht würden, also jene, die sich bereits
die abschließenden Empfehlungen abzuleiten.
mit hohem Engagement innerhalb ihrer Organisation dem
Als Einstieg wird die aktuelle Datenlage zur Häufigkeit
Kinderschutz widmen. Jene, die ohnehin ungenügend zum
von Kindesmisshandlung im Dunkelfeld besprochen
Kinderschutz eingebunden sind, würden kaum durch
sowie der Umfang an Fällen, die im Hellfeld bekannt und
Weiterbildung erreicht, was deren fachliche Mängel noch
betreut werden. Das Kapitel zu Prävention und Schutz-
bestärkt.
konzepten bespricht einerseits die für Deutschland zent-
rale Idee der Schutzkonzepte für Organisationen im Kin-
Als Schwäche wird angemahnt, dass Schutzkonzepte zwar
derschutz. Das Konzept wurde hier entwickelt und wird
umgesetzt, aber kaum begleitet und kontrolliert und auch
zunehmend breiter umgesetzt. Weiter greift das Kapitel
nicht aktualisiert würden. Dies mündete in der Empfeh-
die Prävention im schulischen Kontext auf, der mit sei-
lung, dass Schutzkonzepte qualitätsgesichert sein müssen.
ner großen Nähe zu schulpflichtigen Kindern ein entschei-
Sie sollen verbindlich sein. Die eingeforderte Verbindlich-
dender Multiplikator ist. Das nachfolgende Kapitel Schutz
keit müsse aber durch fachliche Begleitung ergänzt wer-
und Hilfen betrachtet die Interventionsseite. Es beginnt
den, damit vermieden werden kann, dass ein Schutzkon-
mit einem kurzen Überblick über wichtige rechtliche
zept, einmal erstellt, als Ordner im Schrank landet, dort
Rahmenbedingungen, die weitestgehend auf Bundes-
bleibt und nicht mehr aktualisiert wird.
ebene geregelt sind. An zweiter Stelle folgt ein Überblick
Schließlich wurde kritisiert, dass es kaum Möglichkeiten
über die Evidenz zu Interventionen im deutschen Kin-
zur Fehleranalyse gäbe und es wurde empfohlen, dass ver-
derschutz, um anschließend vertieft auf traumafokus-
mehrt Gefäße außerhalb der Fallarbeit geschaffen werden,
sierte Hilfen in Sozialpädagogik und Heilbehandlung
die eine Fehleranalyse ermöglichen. Damit verknüpft ist
einzugehen. Während Wirksamkeitsforschung in der Kin-
auch die Forderung nach Herabsetzung der Quote an Kin-
der- und Jugendhilfe noch kaum Fuß gefasst hat, sind ver-
derschutzfällen, die eine Fachkraft zu betreuen hat. Gleich-
schiedene therapeutische Hilfen bereits gut auf ihre Wirk-
zeitig herrschte bei diesen Voten oft auch etwas Ratlosig-
samkeit hin überprüft. Hier geht es also eher darum die
keit mit Blick auf die ohnehin bereits dünne Personaldecke.
Implementation solcher evidenzbasierter Ansätze in der
Für Deutschland allgemein wurde kritisch festgehalten,
Frühintervention nach Traumatisierung und in der Trau-
dass Angebote für sogenannte Systemsprenger fehlen
matherapie voranzutreiben. In einem separaten Kapitel zu
würden, jungen Personen, die durch alle Netze des vor-
„Good Practice“ werden aktuell breit diskutierte Pro-
handenen Versorgungssystems fallen. Hier gälte es bun-
gramme und Maßnahmen im Kinderschutz besprochen
desweit neue Ideen zu entwickeln. Kritisch wurde darauf
und eingeordnet.
hingewiesen, dass bei Bemühungen um den Kinderschutz,
Kapitel sechs widmet sich den organisationalen Struk-
bei Stärkung der Aus- und Weiterbildung und damit ein-
turen im saarländischen Kinderschutz mit besonde-
hergehender Sensibilisierung der Fachkräfte in der Konse-
rem Blick auf die misshandlungsspezifischen Programme
quenz auch höhere Fallzahlen zu erwarten sind: Wo ge-
und Einrichtungen, die von den Ministerien genannt wur-
nauer hingeschaut wird, fällt auch mehr auf. Die
den. Die Perspektive der Fachkräfte weist auf wichtige He-
Perspektive der politischen Akteure müsse hier zwingend
rausforderungen hin. Ein gesonderter Abschnitt bespricht
längerfristig sein, da sich die Stärkung der Aus- und Wei-
die Weiterbildung von Fachkräften im Kinderschutz.
terbildung erst auf die lange Frist hin in niedrigeren Fall-
Abschließend werden Empfehlungen für den Kinder-
zahlen bemerkbar machen dürfte. Positiv wurde schließ-
schutz im Saarland aus dem Besprochenen abgeleitet.
lich herausgestrichen, dass viele E-Learning-Angebote
vorhanden sind, die gerade für beruflich stark eingebun-
Zitierte und weiterführende Literatur
dene Personen im Kinderschutz eine ort- und zeitunab-
Fegert JM., Ziegenhain U. & Fangerau H. 2010, Problematische Kinderschutz-
hängige Weiterbildung ermöglichen. Die E-Learning-An- verläufe – Mediale Skandalisierung, fachliche Fehleranalyse und Strategien zur Ver-
gebote gälte es unbedingt, sich für das Saarland nutzbar zu besserung des Kinderschutzes. Weinheim: Beltz Juventa.
machen. King, M. 1999, Moral Agendas for children‘s welfare. London: Routledge.
1415
16
Häufigkeit von Kindesmisshandlungen
17Häufigkeit von Kindesmisshandlungen
Andreas Jud Aktuelle Zahlen zur Häufigkeit der verschiedenen Formen
Obschon zu den Definitionen im Kinderschutz nun bereits von Kindesmisshandlung in Deutschland legen eine hohe
seit einigen Jahrzehnten in Wissenschaft und Praxis Betroffenheit in der Bevölkerung nahe (Witt et al., 2017,
eine intensive Auseinandersetzung stattfindet, werden 2018). In einer 2016 erhobenen bundesweiten Stichprobe
Definitionen noch kaum über Professionen und Disziplinen von rund 2500 Personen gaben 13,9 % der Befragten an,
hinweg geteilt (z.B. Jud & Voll, 2020). Einen besonders dass sie irgendeine Form von sexueller Gewalt in der Kind-
gelungenen Zugang zu Definitionen, der zunehmend Ver- heit erlebt haben (Witt et al., 2017). Gar 41,9 % berichteten
breitung findet, bieten die US-amerikanischen Centers for von körperlicher Vernachlässigung in der Kindheit. Auch
Diseases Control (Leeb et al., 2008). Diese haben in einem wenn nur die schweren Formen berücksichtigt werden,
mehrstufigen Verfahren mit Beteiligten aus Medizin, berichten immer noch 2,3 % der Befragten von schwerem
Psychologie, Sozialer Arbeit, Soziologie uvw. sowohl eine sexuellem Missbrauch und 9,1 % von schwerer körperli-
übergreifende Definition zu Kindesmisshandlung als auch cher Vernachlässigung. Ein Überblick über die Häufigkeit
Definitionen zu ihren Unterformen entwickelt, die mit weiterer Formen von Kindesmisshandlung nach Schwere-
Operationalisierungen aller eingeschlossenen Begriffe graden in Deutschland finden sich in den Grafiken 7 und 8.
aufwarten. Diese multidisziplinär entwickelten Definitio- Kritisch anzumerken bleibt, dass aufgrund unterschiedli-
nen dienen für den weiteren Text als Grundlage, wobei die cher Definitionen, Instrumente und Studiendesigns die
zu besprechenden Datensätze teils mit eigenen Definitio- Häufigkeitsangaben zu Kindesmisshandlung sowohl nati-
nen basierend auf rechtlichen Grundlagen operieren. Eine onal, als auch international teils stark schwanken (aus-
eigene Übersetzung der übergreifenden Definition von führlich dazu Jud, Rassenhofer et al., 2016). Dennoch zeigt
Leeb et al. (2008) lautet: die epidemiologische Forschung klar, dass Kindesmiss-
Unter Kindesmisshandlung werden einzelne oder mehrere Hand- handlung nicht ein Phänomen ist, dass nur vereinzelte
lungen oder Unterlassungen durch Eltern oder andere Bezugsperso- trifft, sondern im Ausmaß mit Volkskrankheiten ver-
nen verstanden, die zu einer physischen oder psychischen Schädi- gleichbar ist. Für die am besten untersuchte Form des se-
gung des Kindes führen, das Potential einer Schädigung besitzen xuellen Missbrauchs legen auch europaweite Überblicks-
oder die Androhung einer Schädigung enthalten (Leeb et al., 2008; arbeiten nahe (Sethi et al., 2013), dass rund jede siebte oder
Übersetzung durch den Autor). jede achte Person Missbrauchserfahrungen machen muss-
te. Noch viel umfangreicher, aber auch schlechter unter-
Kindesmisshandlung schließt dabei sowohl aktive Ein- sucht ist die Betroffenheit von Vernachlässigung (Sethi et
wirkungen auf das Kind ein, aber auch Unterlassungen in al., 2013). Detaillierte Beiträge zur Häufigkeit von Kindes-
Form der ungenügenden Versorgung von Bedürfnissen misshandlung in Deutschland und im internationalen
und der mangelnden Aufsicht. Grafik sechs bietet einen Vergleich finden sich bspw. in den folgenden Arbeiten: Jud
Überblick. & Fegert, 2018; Jud, Rassenhofer et al, 2016.
DEFINITION VON FORMEN DER KINDESMISSHANDLUNG
Misshandlung (HANDLUNGEN) Vernachlässigung (UNTERLASSUNGEN)
Physische Psychische
Sexueller Unterlassene Unterlassene
(Körperliche) (Emotionale/Seelische)
Missbrauch Fürsorge Beaufsichtigung
Misshandlung Misshandlung
Die gezielte • Terrorisieren • Berührungsloser hysische
P • Unzureichende
Anwendung von • Isolieren sexueller Kontakt Vernachlässigung Beaufsichtigung
Gewalt gegen ein • Sexueller Kontakt (Ernährung, Hygiene, • Aussetzung einer
• Feindselige
Kind, die zu körper- Obdach, Kleidung) gewalttätigen
Ablehnung • Sexuelle
lichen Verletzungen Emotionale Umgebung
• Ausnutzen Handlungen
führt oder das Vernachlässigung
Potential dazu hat. • Verweigern
(Zahn-) Medizinische
emotionaler
Vernachlässigung
Responsivität
Erzieherische
Vernachlässigung
Grafik 6: Taxonomie der Formen von Kindesmisshandlung in Anlehnung an Leeb et al. (2008)
18Häufigkeit von Kindesmisshandlungen
Die bundesweite Stichprobe von 2.500 Personen bei Witt et Zwar ist in Deutschland die Erfassung von Kindesmiss-
al. (2017) lässt keine verlässliche Auswertung auf Ebene handlung auch im medizinischen Sektor seit 2013 zuläs-
der Bundesländer zu. Studien zum Ausmaß des Dunkel- sig, leider sind bisher jedoch bedauerlicherweise noch
felds von Kindesmisshandlung im Saarland fehlen. Ent- keine verlässlichen Angaben aus diesem Sektor publiziert
sprechend können keine Aussagen getroffen werden, ob (vgl. dazu Fegert et al., 2013). Entsprechend muss auch für
für das Saarland im Vergleich zu anderen Bundesländern das Saarland gefordert werden, dass die Dokumentation in
von einer geringeren oder höheren Betroffenheit von Krankenhäusern bei (Verdacht auf) Misshandlung flä-
Kindesmisshandlung ausgegangen werden muss. Jedoch chendeckend umgesetzt werden soll – begleitet durch ent-
existieren auf Länderebene Daten zur Häufigkeit von sprechende Schulungen und regelmäßige Evaluation über
Kindesmisshandlung im Hellfeld. Dazu gehören einerseits das InEK Institut, welches die Krankenhausdatensätze
die Gefährdungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII, sammelt. Der Schulungsbedarf umfasst auch die Umstel-
andererseits die Angaben zu Anzeigen in der Polizeilichen lung der geltenden Klassifikation im Kontext des SGB V,
Kriminalstatistik. In nachfolgenden Abschnitten werden die auf dem Klassifikationsschema der WHO ICD-10
sowohl für die Gefährdungseinschätzungen als auch zu beruht (Tabelle 1), auf die aktualisierte Fassung ICD-11, die
Strafanzeigen die Kennwerte des Saarlands im gesamt- leicht modifiziert Kodes berücksichtigt. Parallele Aktivi-
deutschen Kontext eingeordnet und mit dem Nachbarland täten müssten über die Landesärztekammer und Landes-
Rheinland-Pfalz verglichen. Als weiterer Vergleichswert psychotherapeutenkammer auch für den ambulanten Be-
wird das ebenfalls nahe gelegene und finanzstarke Land reich unternommen werden.
Baden-Württemberg beigezogen. Da Schwankungen in-
nerhalb zweier Jahre keine zuverlässigen Aussagen zu Tabelle 1: Kodes zu Misshandlung und Missbrauch in der ICD-10
Trends erlauben, werden die Daten über die vergangenen
T74 Missbrauch von Personen
fünf Jahre zusammengetragen
T74.0 Vernachlässigen oder Imstichlassen
Grafik 7: Häufigkeit von sexuellem Missbrauch, emotionaler und
körperlicher Misshandlung für die Jahre 2010 und 2016 in Deutsch-
T74.1 Körperlicher Missbrauch
land nach Schweregraden
Ehegattenmisshandlung o. n. A.
20 18,6%
18
Kindesmisshandlung o. n. A.
16 15%
13,9% T74.2 Sexueller Missbrauch
14 12,3% 12,6%
12,1 12,1%
12
6,3 T74.3 Psychischer Missbrauch
10 10,4 6,3
%
6,5 5,8
8
T74.8 Sonstige Formen des Missbrauchs
6
4 3,9 2,8 3,1 4,4 5,3 von Personen; Mischformen
3 4,6 6,5 5,6 6,5 6,3 7,6
2 3,4
1,6 2,6 2,8 1,9 2,3 T74.9 Missbrauch von Personen, nicht näher
0
2010 2016 2010 2016 2010 2016
bezeichnet; Schäden durch Missbrauch:
emotionale körperliche sexueller
Misshandlung Misshandlung Missbrauch – eines Erwachsenen o. n. A.
– eines Kindes o. n. A.
Schwer – extrem Mäßig – schwer Gering – mäßig
Y05 Sexueller Missbrauch mittels
Anmerkungen: Die Daten wurden mit dem standardisierten Fragebogen
Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) erhoben und den Studien von
körperlicher Gewalt
Häuser et al. (2011) für 2010 und Witt et al. (2017) für 2016 entnommen.
Y07.X Sonstige Misshandlungssyndrome,
einschließlich seelische Grausamkeit,
körperliche Misshandlung, sexueller
Grafik 8: Häufigkeit von Vernachlässigung für die Jahre 2010 und
2016 in Deutschland nach Schweregraden Missbrauch, Folterung
60 Z61.4 Probleme bei sexuellem Missbrauch in
49,6% 48,5%
der Kindheit durch eine Person innerhalb
50
41,9% der engeren Familie
40,5%
40 19,7 Z61.5 Probleme bei sexuellem Missbrauch in
35,6 19,3
30 der Kindheit durch eine Person außerhalb
27,2
%
20 18
der engeren Familie
28,8% 13,5
10 7,4 6,2 22,6%
14% 13,3% 10,8
6,6 7,1 9,1
0
2010 2016 2010 2016
emotionale körperliche
Vernachlässigung Vernachlässigung
Schwer – extrem Mäßig – schwer Gering – mäßig
Anmerkungen: Die Daten wurden mit dem standardisierten Fragebogen
Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) erhoben und sind den Studien
von Häuser et al. (2011) für 2010 und Witt et al. (2017) für 2016 entnommen.
19Häufigkeit von Kindesmisshandlungen
2.1 Gefährdungseinschätzungen Sowohl in Baden-Württemberg als auch im Saarland wur-
de ein dichtes Netz an niederschwelligen Beratungsein-
nach §8a SGB VIII richtungen in der Hoffnung aufgebaut, problematische
Absatz 1 von §8a SGB VIII hält fest, dass das Jugendamt bei Familiensituationen bereits in der Entstehung auffangen,
gewichtigen Anhaltspunkten für die Gefährdung des bevor sie Thema für den Kinderschutz werden. Einen ent-
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen, das Gefährdungs- sprechenden Zusammenhäng gelte es allerdings zu prüfen.
risiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzu-
schätzen hat. Die Fachkräfte halten als Ergebnis fest, ob 18 % der Verfahren im Saarland wurden als Kindeswohl-
eine Kindeswohlgefährdung vorhanden und/oder Hilfebe- gefährdung eingeschätzt, in weiteren 31% der Verfahren
darf vorhanden ist. So werden als drei Hauptkategorien wurde ein Hilfebedarf ohne akute oder latente Kindes-
festgehalten: wohlgefährdung festgestellt und in 50 % der Verfahren
- Kindeswohlgefährdung wurden weder eine Kindeswohlgefährdung noch ein wei-
- Keine Kindeswohlgefährdung, aber Hilfebedarf terer Hilfebedarf festgestellt (Tabelle 2). In Baden-Würt-
- Keine Kindeswohlgefährdung, kein (weiterer) Hilfebedarf temberg und auch in Deutschland insgesamt sind die ver-
Bei Kindeswohlgefährdung wird weiter in akute und la- schiedenen Gruppen der Gefährdungseinschätzung
tente Kindeswohlgefährdung unterschieden. Diese Unter- annähernd gleich groß. Im benachbarten Rheinland-Pfalz
scheidung ist jedoch ungenügend operationalisiert und wiederum wird bei vergleichbar vielen Verfahren im Ver-
vermutlich stark von der jeweiligen Fachkraft oder (impli- hältnis zur Bevölkerung bei mehr als doppelt so vielen
ziten) Vorgaben des jeweiligen Jugendamts abhängig. Auch Kindern eine Kindeswohlgefährdung festgestellt (Tabelle
die internationale Literatur legt nahe, dass sich vergleich- 2). Die Gruppe ohne weiteren Hilfebedarf ist dort mit 28 %
bare legislativ begründete Unterscheidungen zwischen am geringsten. Während im Saarland für etwa die Hälfte
belegter und drohender Kindeswohlgefährdung kaum in der abgeklärten Fälle ein weiterer Hilfebedarf gesehen
unterschiedlichen psychosozialen Belastungen der jewei- wird, wird im benachbarten Rheinland-Pfalz bei einer
ligen Gruppen niederschlagen und die Unterscheidung da- deutlichen Mehrheit von 70 % der Verfahren fachlich ein
mit auch kaum empirisch begründbar ist (Fallon et al., Hilfebedarf wahrgenommen.
2011). Entsprechend wird in dieser Expertise auf eine wei-
tere Unterteilung der Kindeswohlgefährdung in akut und Vergleicht man die Häufigkeiten der Verfahren über die
latent verzichtet. Die Unterteilung in die Gefährdungsfor- vergangenen fünf Jahre zeigt sich für Deutschland sowohl
men der Vernachlässigung, des sexuellen Missbrauchs, bei der Gesamtzahl an Verfahren, als auch bei denjenigen
der körperlichen und psychischen Misshandlung hinge- Verfahren, die davon als akute oder latente Kindeswohlge-
gen ist konzeptuell und empirisch gut abgesichert. fährdung eingeschätzt wurden ein ansteigender Trend
Von insgesamt 157.271 Verfahren zur Gefährdungsein- (Grafik 9). Mit zunehmender Etablierung des Verfahrens
schätzung 2018 in Deutschland wurden 1.712 im Saarland nach dessen Einführung anfangs des Jahrzehnts scheint es
durchgeführt. Bei einer Bevölkerung von rund 145.000 etwas häufiger zu werden. Im Saarland ist bei den jährli-
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren entspricht das chen Schwankungen keine kontinuierliche Zunahme (oder
11,8 Verfahren pro 1.000 Kinder/Jugendliche im Saarland Abnahme) ersichtlich. Im Verhältnis zur Bevölkerung wer-
(Tabelle 2). Damit ist die Quote vergleichbar mit dem be- den zwar im Saarland im gesamtdeutschen Vergleich über
nachbarten Bundesland Rheinland-Pfalz (12,6 Verfahren die letzten fünf Jahre leicht mehr Verfahren durchgeführt,
pro 1.000 Kinder/ Jugendliche) und liegt im deutschen der Anteil an Fällen für die eine Kindeswohlgefährdung
Durchschnitt (12,0 Verfahren pro 1.000 Kinder/Jugendli- eingeschätzt wurde, liegt jedoch über alle fünf Jahre durch-
che). Auffällig ist die deutliche tiefere Quote in Baden- gängig tiefer als im deutschen Schnitt (Grafik 9). Die Abwei-
Württemberg (7,4 Verfahren pro 1.000 Kinder/Jugendli- chungen 2014 vom allgemeinen Trend dürfte in unvollstän-
che). Der Unterschied kann nur ungenügend erklärt werden. digen Daten für dieses Jahr begründet liegen.
Tabelle 2: Gefährdungseinschätzungen nach §8a SGB VIII 2018
Verfahren Kindeswohlgefährdung keine Kindeswohlgef., keine Kindeswohlgef.,
aber Hilfebedarf kein (weiterer)
Hilfebedarf
total pro total pro total pro total pro
1.000 Ki. 1.000 Ki. 1.000 Ki. 1.000 Ki.
DE 157.271 12,0 50.412 3,8 52.995 4,0 53.864 4,1
SL 1.712 11,8 322 2,2 535 3,7 855 5,9
RP 8.292 12,6 3.030 4,6 2.959 4,5 2.303 3,5
BW 13.781 7,4 4.535 2,4 4.906 2,6 4.340 2,3
Anmerkungen: DE=Deutschland; SL=Saarland; RP=Rheinland-Pfalz; BW=Baden-Württemberg. Die Zahlen für die Bevölkerung unter 18 Jahren wurde auf
Basis der jeweiligen statistischen Ämter errechnet.
20Sie können auch lesen