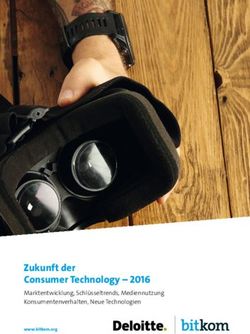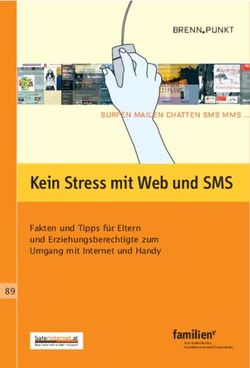Kinderrechte aus Kinder- und Jugendsicht - Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021 - unicef.ch
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kinderrechte aus Kinder- und Jugendsicht Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021 Bettina Brüschweiler, Gianluca Cavelti, Mandy Falkenreck, Sybille Gloor, Nicole Hinder, Tobias Kindler, Désirée Zaugg
C H
L I
AU
R
Impressum
T
Die Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021 wurde von
Bettina Brüschweiler (Dozentin, IFSAR), Gianluca Cavelti (Wissenschaftlicher
Assistent, IFSAR), Mandy Falkenreck (Dozentin, IFSAR), Sybille Gloor
R
(Child Rights Advocacy, UNICEF), Nicole Hinder (Bereichsleiterin Child Rights
Advocacy, UNICEF), Tobias Kindler (Wissenschaftlicher Mitarbeiter, IFSAR)
und Désirée Zaugg (Child Rights Advocacy, UNICEF) verfasst.
E
Herausgegeben wurde sie gemeinsam von UNICEF Schweiz und Liechtenstein
und dem Institut für Soziale Arbeit und Räume (IFSAR) des Departements der
Sozialen Arbeit der OST – Ostschweizer Fachhochschule.
V
© Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein / OST – Ostschweizer Fachhochschule
Originalsprache: Deutsch
Übersetzt: Französisch, Italienisch
Konzept und Gestaltung: Büro Haeberli, Zürich
Lektorat: Andrea Kippe
Konzept und Gestaltung Fragebogen: Superdot – visualizing complexity, Basel
Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich
+41 44 317 22 66
info@unicef.ch
IFSAR Institut für Soziale Arbeit und Räume
Departement Soziale Arbeit, OST – Ostschweizer Fachhochschule
Rosenbergstrasse 59, 9001 St.Gallen
+41 58 257 18 80
ifsar@ost.ch
Zitationsvorschlag
Brüschweiler, Bettina; Cavelti, Gianluca; Falkenreck, Mandy; Gloor, Sybille; Hinder, Nicole;
Kindler, Tobias; Zaugg, Désirée (2021): Kinderrechte aus Kinder- und Jugendsicht.
Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021. Herausgegeben von UNICEF
Schweiz und Liechtenstein und dem Institut für Soziale Arbeit und Räume, Departe-
ment Soziale Arbeit der OST – Ostschweizer Fachhochschule. Zürich und St. Gallen.Kinderrechte
C
aus Kinder- und H
L
Jugendsicht
I
AU
R
Kinderrechte-Studie Schweiz
T
und Liechtenstein 2021
E R
Bettina Brüschweiler, Gianluca Cavelti,
Mandy Falkenreck, Sybille Gloor, Nicole Hinder,
Tobias Kindler, Désirée Zaugg
VVorwort 1715 Kinder und Jugendliche aus der Schweiz und
Liechtenstein teilgenommen. Realisiert wurde die
Studie durch die konstruktive Zusammenarbeit von
UNICEF Schweiz und Liechtenstein und dem Institut
für Soziale Arbeit und Räume (IFSAR) des Departe-
ments der Sozialen Arbeit der OST – Ostschweizer
Fachhochschule. Damit wurde eine wichtige Koali-
tion aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft gebildet,
mit dem Ziel, sich gemeinsam für die Interessen und
Anliegen von Kindern und Jugendlichen sowie die
H
Umsetzung der Kinderrechte einzusetzen.
Der vorliegende Bericht präsentiert die Resultate der
Kinderrechte-Studie. Sie sind aufschlussreich und
C
besorgniserregend zugleich. Kinder und Jugendliche
K
weisen darauf hin, dass sie zu wenig Freizeit und Er-
I
holung haben, dass sie Gewalt- und Diskriminie-
inder und Jugendliche sind Expertinnen rungserfahrungen machen und ihre Möglichkeiten
und Experten in allen Angelegenheiten, der Mitsprache als zu gering einschätzen. Es zeigt
L
die ihr eigenes Leben betreffen: Sie sich zudem, dass in der Schweiz und in Liechten-
nehmen die Welt um sich herum wahr, stein Kinderarmut nach wie vor ein zentrales gesell-
finden sich darin auf ihre Weise zurecht schaftliches Thema ist. In allen Themenbereichen
U
und gestalten diese aktiv mit. Kinder und Jugendli- wurde deutlich, dass sozioökonomisch benachteilig-
che bringen eigene Bedürfnisse und Herausforde- te Kinder und Jugendliche weniger Möglichkeiten
rungen mit. Sie haben eigene Ideen, eine eigene haben, ihre Rechte wahrzunehmen. Sie können we-
A
Meinung und eine eigene Stimme. Und sie haben niger partizipieren, erleben häufiger Diskriminierung
Rechte. Diese Rechte sind unteilbar und müssen um- und machen mehr Gewalterfahrungen.
fassend und gesamtgesellschaftlich respektiert wer- Wir sollten uns als Gesellschaft zum Ziel setzen, die
den. Es ist an uns Erwachsenen, den Kindern und Kinderrechtskonvention umfassend umzusetzen und
R
Jugendlichen zuzuhören, sie mit ihren Themen, Sor- dabei vor allem vulnerable Kinder und Jugendliche in
gen und Ängsten und mit ihren Ideen und ihrem Ge- den Fokus zu nehmen. Ein Schlüssel — aus unserer
T
staltungswillen ernst zu nehmen und sie in Prozesse Sicht der zentralste — ist der konsequente Einbezug
aktiv und selbstverständlich mit einzubeziehen. von Kindern und Jugendlichen in alle Entscheidun-
Blickt man in der Schweiz und in Liechtenstein auf den gen, die sie betreffen. Wir haben mit der hier vorlie-
R
Stand der Umsetzung der UN-Konvention über die genden Studie den Anfang gemacht und die Kinder
Rechte des Kindes, fehlt es der Mehrheit der Kinder und Jugendlichen direkt nach ihrer Einschätzung
und Jugendlichen zwar nicht an überlebenswichtigen und ihrem Erleben gefragt. Nun gilt es, die von ihnen
E
Dingen. Lücken in der Umsetzung der Kinderrechte thematisierten Defizite durch uns Erwachsene zu
führen aber sehr wohl dazu, dass sich das der Gesell- beheben. Kinder und Jugendliche sollten dabei wie-
schaft innewohnende Potenzial nicht gänzlich entfal- derum eine Schlüsselrolle einnehmen und bei der
V
ten kann. Wir stehen in der Pflicht, unsere Möglich- Gestaltung ihrer Lebensbereiche, bei der Mas
keiten und Ressourcen so zu nutzen, dass Kindern und snahmenplanung und -umsetzung und bei allen
Jugendlichen die bestmögliche Entwicklung gewährt Angelegenheiten, die sie betreffen, als Expertinnen
werden kann. Denn die Kinder und Jugendlichen sind und Experten einbezogen werden. Gemeinsam
Gradmesser einer Gesellschaft: Geht es ihnen gut, hat können wir eine Welt schaffen, in der Gewalt, Aus-
das positive Auswirkungen auf uns alle. Dass die grenzung und Armut keinen Platz haben.
Schweiz und Liechtenstein diesbezüglich noch Luft Ein besonderer Dank geht an alle Kinder und Jugend-
nach oben haben, zeigt die vorliegende Kinderrechte- lichen, die an der Umfrage teilgenommen haben.
Studie eindrücklich. Eure Antworten, liebe Kinder und liebe Jugendliche,
Die Studie beschäftigt sich mit der übergeordneten helfen uns Erwachsenen, besser zu verstehen, wie ihr
Frage, wie die Kinderrechtskonvention in den Le- lebt, wie es euch geht und was getan werden muss,
bensbereichen Familie, Schule, Freizeit und Wohnort damit die Kinderrechte in der Schweiz und in Liech-
aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen umge- tenstein in Zukunft in allen Lebensbereichen einen
setzt ist. An der Online-Umfrage haben insgesamt festen und selbstverständlichen Platz haben.
Bettina Junker, Geschäftsleiterin Christian Reutlinger, Co-Leiter Institut
UNICEF Schweiz und Liechtenstein für Soziale Arbeit und Räume (IFSAR)
des Departements Soziale Arbeit der
OST – Ostschweizer Fachhochschule
4 — Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021L a voix des enfants et des jeunes est claire :
la route est longue ! La présente étude met
en exergue que des pays comme la Suisse
ont encore de nombreux défis à relever et
des lacunes à combler en matière de mise
en œuvre de la Convention relative aux droits de l’en-
fant, et ce de manière urgente. Cette étude a l’avan-
tage de dresser un tableau complet, et parfois préoc-
cupant, sur le bien-être des enfants et des jeunes
ainsi que sur la garantie de leurs droits. Elle doit indé-
D H
niablement nous interpeller comme société. L’univers
des enfants et des jeunes interrogés montrent claire-
ment que l’accès à un monde dans lequel ils bénéfi- ie UNO-Kinderrechtskonvention sieht vor,
C
cient pleinement de leurs droits dépend largement de dass der Stimme von Kindern und Jugend-
la vision et de l’action des adultes. Leurs voix, leurs lichen mehr Gewicht verliehen wird. Kinder
I
interrogations, leurs suggestions doivent être enten- und Jugendliche müssen als relevante ge-
dues et prises comme sources d’inspiration tout en sellschaftliche Bevölkerungsgruppe aner-
acculturant l’avancée de notre société. kannt und einbezogen werden. Die vorliegende Kinder
L
rechte-Studie setzt hierzu ein Zeichen. Ich erachte die
darin erfolgte Konsultation von Kindern und Jugendlichen
Foto: studioregard.ch
als wichtigen Schritt in eine Richtung, in die Liechtenstein
U
und die Schweiz konsequent weitergehen müssen. Aus
der Kinder- und Jugendperspektive auf die Umsetzung
der Kinderrechtskonvention im eigenen Land zu blicken,
A
eröffnet eine ganz neue Perspektive und ist für unsere Ge-
sellschaft von grosser Bedeutung. Die Herangehensweise
in der Studie gibt den Daten entsprechend grosses Ge-
Flávio Borda D’Água, Historien
wicht. Wir müssen die neu gewonnenen Erkenntnisse
R
et Délégué UNICEF Suisse
et Liechtenstein ernst nehmen und zusammen mit Kindern und Jugendli-
chen nach Lösungen suchen.
T
D ER obbiamo imparare a riconoscere il di-
ritto dei bambini alla propria opinione, Claudia Fritsche, Ehemalige UNO-
V
ascoltarla e prendere sul serio le loro Botschafterin, Delegierte bei UNICEF
necessità. Perché lo richiede Conven- Schweiz und Liechtenstein
zione per i diritti dell’infanzia. E soprat-
tutto, perché lavorare con bambini e giovani schiude
nuovi mondi. Dare forma al presente e al futuro insie-
me a loro stimola ed è nel contempo fonte di ispira-
zione. Quello di consultare bambini e giovani è un
approccio che va attuato con coerenza, a tutti i livel-
li e in tutte le situazioni che li riguardano. Il presente
studio sui diritti dell’infanzia svolge un contributo
decisivo in tal senso.
Flavia Marone, Presidente,
Castellinaria festival del cinema
giovane
Vorwort — 5Inhalt
H
Hintergrund und konzeptioneller Rahmen der Studie 8
Methodischer Aufbau der Studie 10
C
Methodisches Vorgehen 10
I
Beschreibung der Stichprobe 10
Kinderrechte in der Familie
U
Wie Kinder und Jugendliche in Familien leben
L 12
14
A
Recht auf Förderung und Wohlbefinden in der Familie 15
Recht auf Schutz und gewaltfreies Aufwachsen in der Familie 16
R
Recht auf Mitsprache und Beteiligung in der Familie 17
T
Kinderrechte in der Schule 18
R
Recht auf Förderung und Wohlbefinden in der Schule 20
E
Recht auf Schutz und gewaltfreies Aufwachsen in der Schule 20
Recht auf Mitsprache und Beteiligung in der Schule 22
V Kinderrechte in der Freizeit
Recht auf Förderung und Wohlbefinden in der Freizeit
Recht auf Schutz und gewaltfreies Aufwachsen in der Freizeit
Recht auf Mitsprache und Beteiligung in der Freizeit
24
26
27
29
6 — Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021Kinderrechte am Wohnort 30
H
Recht auf Förderung und Wohlbefinden am Wohnort 32
C
Recht auf Schutz und gewaltfreies Aufwachsen am Wohnort 33
I
Recht auf Mitsprache und Beteiligung am Wohnort 34
Familie, Schule, Freizeit, Wohnort:
So sind die Kinderrechte umgesetzt
U L36
A
Recht auf Förderung und Wohlbefinden 37
Recht auf Schutz und gewaltfreies Aufwachsen 38
R
Recht auf Mitsprache und Beteiligung 40
T
Empfehlungen 45
R
Recht auf Förderung und Wohlbefinden:
Weniger Leistungsdruck, mehr Freiräume! 46
E
Recht auf Schutz und gewaltfreies Aufwachsen:
Gewalt, Mobbing und Diskriminierung entgegenwirken! 48
V
Recht auf Mitsprache und Beteiligung:
Schule und Wohnort haben Nachholbedarf! 50
Vulnerable Kinder und Jugendliche: Für gleiche Chancen sorgen! 52
Literaturverzeichnis 54
Inhalt — 7Hintergrund und
konzeptioneller Rahmen
H
Mit der vorliegenden Studie liegt für die Schweiz und einen angemessenen Lebensstandard, Zugang zu
Gesundheitsversorgung und Bildung, aber auch
C
Liechtenstein erstmals eine umfassende Einschät-
zung der Umsetzung der Kinderrechte aus Kinder- immaterielle Ressourcen wie Liebe und Freund-
I
und Jugendsicht vor. Damit schliesst die Studie an schaft, Handlungs- und Entscheidungsmöglichkei-
die neuere soziologische und erziehungswissen- ten, mentale wie physische Räume zur Entwick-
schaftliche Kindheitsforschung an, die in den letzten lung oder Förderung des Selbstwertgefühls.
L
Jahren eine fundierte wissenschaftliche Basis zur
• Mit den Schutzrechten ist das Ziel verbunden, der
Beurteilung der Lebenssituation von Kindern und Ju-
besonderen Schutzbedürftigkeit von Kindern und
gendlichen aus Kinder- und Jugendsicht geschaffen
Jugendlichen Rechnung zu tragen. So sollen sie
U
und etabliert hat (für Deutschland Andresen und
umfassend vor physischer und psychischer Ge-
Neumann 2018; für die Schweiz u. a. Tausendfreund
walt, Missbrauch, Ausbeutung und Misshandlung
et al. 2020). Kindersicht heisst: Kinder und Jugend-
jeglicher Art geschützt werden.
A
liche wurden im Rahmen der Studie direkt nach ihrer
Einschätzung gefragt und werden somit als Exper- • Die sogenannten Beteiligungsrechte anerkennen
tinnen und Experten ihres Lebens angesprochen und Kinder und Jugendliche als eigenständige Akteu-
ernst genommen. rinnen und Akteure, die ein Recht auf Partizipation
R
Zentraler konzeptioneller Bezugspunkt der Studie ist haben. In der Kinderrechtskonvention ist festge-
die UN-Konvention über die Rechte des Kindes (Kin- halten, dass den Kindern und Jugendlichen das
T
derrechtskonvention, KRK), die im Jahre 1989 von den Recht auf Information, Beteiligung, Mitsprache
Vereinten Nationen einstimmig verabschiedet wurde. und Mitbestimmung in allen sie direkt oder indi-
Bis heute wurde dieses Abkommen von 196 Staaten rekt betreffenden Belangen zusteht.
R
unterzeichnet und gilt damit als der meistratifizierte
internationale Völkerrechtsvertrag. Liechtenstein hat Durch die Ratifizierung der Kinderrechtskonvention
das Übereinkommen 1995 und die Schweiz 1997 rati- verpflichten sich die Schweiz und Liechtenstein
E
fiziert. Beide Staaten haben später auch die drei Fakul- dazu, ein regelmässiges Monitoring zum Stand der
tativprotokolle unterzeichnet. Somit wurden die Kon- Umsetzung der Kinderrechte zu betreiben. Eine fun-
vention und die dazugehörenden Fakultativprotokolle dierte Beurteilung der Umsetzung der Kinderrechte
V
jeweils zu innerstaatlichem Gesetz. Durch die Kinder- in der Schweiz und Liechtenstein stellt jedoch nach
rechtskonvention werden Kinder (von 0 bis 18 Jahren) wie vor eine grosse Herausforderung dar. Auch
erstmals universell als eigenständige Rechtssubjekte Jahrzehnte nach der Verabschiedung der KRK gibt
anerkannt, das heisst, die Rechte können beziehungs- es in der Schweiz und Liechtenstein kein umfassen-
weise müssen nicht von Kindern und Jugendlichen des Indikatoren-Set, das ein umfängliches Monito-
erworben oder verdient werden, sondern sie stehen ring zu allen Rechten und Lebensbereichen der Kin-
ihnen zu. Die Kinderrechte sind in 54 Artikeln festge- der und Jugendlichen gewährleisten würde. Dies
halten und berücksichtigen die spezifischen Bedürf- führt dazu, dass Informations- und Datenlücken be-
nisse von Kindern und Jugendlichen. Sie gelten für stehen und kein ganzheitliches Bild darüber zur Ver-
jedes einzelne Kind und jeden einzelnen Jugendlichen fügung steht, wie es den Kindern und Jugendlichen
über alle Lebensbereiche hinweg. in der Schweiz und in Liechtenstein geht. Dies wäre
Als Orientierungsrahmen wird häufig auf das «Ge- jedoch Voraussetzung dafür, nachhaltige Verbesse-
bäude der Kinderrechte» (Maywald 2012) mit einer rungen anstreben und die Entwicklungen auch be-
Unterteilung in Förder-, Schutz- und Partizipations- gleiten und überwachen zu können. Des Weiteren
rechte verwiesen. Dieses Konzept der drei Säulen, in stammen vorhandene wissenschaftliche Daten über
Englisch die «3 Ps» – Provision, Protection, Participa- die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen
tion – genannt (Hammarberg 1990), ermöglicht es, zumeist von Erwachsenen. Anzustreben ist es da-
die vielfältigen und facettenreichen Rechte in einem her, Kinder und Jugendliche konsequent in solche
Raster zu erfassen und die Komplexität herunterzu- sie unmittelbar betreffenden Prozesse einzubezie-
brechen: hen und sie zum Beispiel auch in Forschungsprojek-
ten als Expertinnen und Experten in eigener Sache
• Als Förderrechte werden jene Rechte bezeich- wahr- und ernst zu nehmen und damit die in der Kin-
net, die der Förderung der bestmöglichen Ent- derrechtskonvention verankerten Partizipations-
wicklung und des Wohlbefindens eines Kindes rechte auch auf diesem Wege umzusetzen. Bisher
bzw. Jugendichen Rechnung tragen. Darunter gibt es also kaum Daten dazu, wie Kinder aus der
fällt ein sehr breites Spektrum an Rechten wie Schweiz und Liechtenstein die Umsetzung ihrer
zum Beispiel ausreichend finanzielle Mittel für Rechte aus eigener subjektiver Perspektive wahr-
8 — Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021nehmen und wo sie sich diesbezüglich Veränderun- centi 2007) zurückgegriffen, verbunden mit dem Ziel,
gen respektive Verbesserungen wünschen. In Hin- die Förder-, Schutz- und Beteiligungsrechte im Fra-
blick auf das 5. und 6. Staatenberichtsverfahren der gebogen operationalisieren zu können. Der Child
Schweiz hat die UNICEF Schweiz und Liechtenstein Well-Being Approach beziehungsweise das Konzept
in Zusammenarbeit mit dem Institut für Soziale Ar- des Wohlbefindens (Andresen und Neumann 2018)
beit und Räume (IFSAR) des Departements der orientiert sich an der Kinderrechtskonvention und
Sozialen Arbeit der OST – Ostschweizer Fachhoch- versteht sich als multidimensionales Konzept, wel-
schule beschlossen, Ansichten und Meinungen von ches folgende sechs Dimensionen umfasst: materiel-
Kindern und Jugendlichen aus der Schweiz und les Wohlbefinden, Gesundheit und Sicherheit, Bil-
Liechtenstein hinsichtlich der Umsetzung der Kin- dung, Beziehungen zu Familie sowie Freundinnen
H
derrechte einzuholen. Dadurch sollen sie vor allem und Freunden, Verhaltensweisen und Risiken, wor-
auch auf politischer Ebene Gehör finden und Ver- unter beispielsweise gesundes Essverhalten oder Ge-
änderungen anstossen können. walterfahrungen fallen, sowie das subjektive Wohl-
C
Ziel der Studie ist es also, aus der Perspektive von befinden respektive die subjektive Einschätzung
Kindern und Jugendlichen zu erfahren, wie es um die diesbezüglich. Vor allem Letzterem – der subjektiven
I
Umsetzung der Kinderrechte in der Schweiz und Einschätzung des eigenen Wohlbefindens – wurde in
Liechtenstein steht. Um ein möglichst breites und der vorliegenden Studie Rechnung getragen. Das
umfassendes Bild darüber zu erhalten, wurden die Konzept des Wohlbefindens verdeutlicht, wie wichtig
L
Förder-, Schutz- und Beteiligungsrechte als zentraler es ist, alle Bereiche zu betrachten, entlang derer Kin-
Ausgangspunkt der Befragung gewählt und um wei- der und Jugendliche leben. Dementsprechend wur-
tere Rechte wie zum Beispiel das Recht auf Nicht- den in der Studie, jeweils bezogen auf die von Kin-
U
Diskriminierung und Aspekte materiellen Wohlerge- dern und Jugendlichen wichtigsten Lebensbereiche
hens angereichert. Konzeptionell wurde bei der Familie, Schule, Freizeit und Wohnort, die zentralen
Erarbeitung der Studie zudem auf den UNICEF-An- Kinderrechte aus Sicht der Kinder und Jugendlichen
A
satz zum Wohlbefinden von Kindern (UNICEF Inno- auf ihre Umsetzung hin erfragt.
R
Daraus ergibt sich folgende leitende Fragestellung für die Studie:
Wie steht es aus der Sicht von
T
Kindern und Jugendlichen um
die Umsetzung ihres Rechtes auf …
R
Schutz und
gewaltfreies
E
Aufwachsen
V Förderung und
Wohlbefinden
in der
Familie?
am
Wohnort?
in der in der
Schule? Freizeit?
Mitsprache und
Beteiligung
Hintergrund und konzeptioneller Rahmen — 9Methodischer Aufbau
H
Methodisches Vorgehen (3 Prozent), Portugiesisch (2,4 Prozent), Spanisch
C
(1,9 Prozent), Türkisch (1,9 Prozent), Englisch (1,4
Zwischen dem 20. November 2019 und dem 1. Juni Prozent), Serbisch (1,0 Prozent), Tamilisch (1,0 Pro-
I
2020 wurden Kinder und Jugendliche im Alter von zent), Bosnisch (0,7 Prozent) und Tigrinja (0,6 Pro-
9 bis 17 Jahren aus der Schweiz und Liechtenstein zent).
zur Teilnahme an einer schriftlichen Befragung ein- Die allererste inhaltsbezogene Frage, die an die Kin-
L
geladen.* Der entsprechende Onlinefragebogen der und Jugendlichen im Fragebogen gestellt wurde,
stand unter www.kidsunited.ch bereit und richtete lautete: «Hast du schon mal von den Kinderrechten
sich in seiner Formulierung und Gestaltung explizit gehört oder gelesen?» 91,1 Prozent der teilnehmen-
U
an die benannte Altersgruppe, das heisst, eine stell- den Kinder und Jugendlichen geben an, schon einmal
vertretende Teilnahme durch Erwachsene war nicht von den Kinderrechten gehört zu haben. Dabei scheint
vorgesehen. die Schule bei der Vermittlung der Kinderrechte eine
A
Die Zusammenstellung des Samples erfolgte als besondere Rolle zu spielen: 78,5 Prozent der Kinder
Gelegenheitsstichprobe, die Verteilung und Bewer- und Jugendlichen geben an, dass sie in der Schule in
bung des Fragebogens fand über Fachverbände und Berührung mit den Kinderrechten gekommen sind, in
Netzwerke im Bereich Kindheit und Jugend sowie der Familie sind es 37,4 Prozent und über digitale Me-
R
über Schulen in der ganzen Schweiz und Liechten- dien 34,3 Prozent. Als weitere zentrale Quellen nen-
stein statt. nen sie zudem Zeitschriften und Zeitungen, das Fern-
T
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte mittels uni- sehen, Freunde, Kinderparlamente und Kinderräte
variater und bivariater Methoden der quantitativen und die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
Sozialforschung. Dazu wurden die erhobenen Daten
R
im Rahmen der Datenbereinigung vollständig anony-
misiert und im Programm SPSS analysiert. Die im
Fragebogen eingesetzten offenen Fragen wurden in
E
Anlehnung an Philipp Mayring (2015) inhaltsanalytisch
zusammengefasst und zu Kategorien verdichtet.
V
Beschreibung der Stichprobe
An der Befragung haben insgesamt 1826 Personen
teilgenommen. Davon wurden im Rahmen der Da-
tenbereinigung 111 Teilnehmende ausgeschlossen,
da sie entweder nicht der fokussierten Altersgruppe
entsprachen, nicht in der Schweiz oder in Liechten-
stein wohnhaft sind oder durchgängig unplausible
Antworten gegeben haben. Somit stützt sich die vor-
liegende Ergebnisdarstellung auf die Antworten von
1715 Kindern und Jugendlichen. Davon leben 287
(16,7 Prozent) in Liechtenstein und 1428 (83,3 Pro-
zent) in der Schweiz. 1533 Teilnehmende (89,4 Pro-
zent) haben den Fragebogen auf Deutsch, 113 (6,6
Prozent) auf Italienisch und 69 (4,0 Prozent) auf Fran-
zösisch ausgefüllt. 55,6 Prozent der Befragten geben
ein weibliches, 44,2 Prozent ein männliches und 0,2
Prozent ein diverses Geschlecht an. 22,6 Prozent der
Teilnehmenden sind neun bis elf Jahre alt, 49,1 Pro-
zent sind 12 bis 14 Jahre alt und 28,3 Prozent sind 15
* Während der Fragebogen freigeschaltet war, befanden sich
bis 17 Jahre alt. 83,7 Prozent der Befragten verfügen die Schweiz und Liechtenstein zwischen März und Mai
über die Schweizer oder Liechtensteiner Nationalität. 2020 wegen der Covid-19-Pandemie im (Teil-)Lockdown
(bspw. Schulschliessungen, Schliessung Freizeitangebote
Die meistgesprochenen Sprachen zu Hause sind die
wie Jugendarbeit, Einschränkungen von Personenanzahl
Liechtensteiner und Schweizer Landessprachen – im öffentlichen Raum). Etwas mehr als die Hälfte der
Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch ausgefüllten Fragebogen wurde von den Kindern und
Jugendlichen während des Lockdowns ausgefüllt. Inwieweit
(insgesamt 80,3 Prozent) –, gefolgt von Albanisch die Massnahmen und die Erfahrungen der Kinder und
Jugendlichen Einfluss auf die Beantwortung der Fragen
hatten und das Ergebnis der Befragung beeinflusst haben,
wurde nicht systematisch ausgewertet.
10 — Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021Stichprobe N =1715
Sprachregionen
Deutsch
89,4% H
Französisch
C I
L
4,0%
AU 6,6%
R
Italienisch
Sprachen
RT
68,8%
V EItalienisch
7,4%
Französisch
3,4%
Albanisch
3%
Portugiesisch
2,4%
Spanisch
1,9%
Türkisch
1,9%
Englisch Serbisch Tamilisch Rätoromanisch Bosnisch Tigrinja
Deutsch 1,4% 1% 1% 0,7% 0,7% 0,6%
Geschlecht Altersgruppen Nationalität
9–11 12–14 15–17
55,6% 44,2% 0,2% 22,6% 49,1% 28,3% 16,3% 83,7%
Ohne Schweizer oder Mit Schweizer oder
Liechtensteiner Pass Liechtensteiner Pass
Methodischer Aufbau — 11C H
Kinderrechte L I
U
in der Familie
A
T R
E R
V
Kinderrechte in der Familie — 13C H
L I
AU
T R
E R
VDie Familie gilt nach wie vor als einer der zentralsten Sozialisations- und
Lebensbereiche für Kinder. Hier bekommen Kinder und Jugendliche
neben der alltäglichen Versorgung vor allem emotionale Sicherheit und
Rückzugsmöglichkeiten. In Familien interagieren Kinder und Jugend
liche mit Erwachsenen und allenfalls Geschwistern in inter- und intra
generationalen persönlichen Beziehungen (Pupeter und Schneekloth
2018). Während die klassische Kernfamilie lange Zeit als wichtigste
Instanz der Primärsozialisation angesehen wurde (Mollenhauer et al.1978,
S.188), bewegen sich heutige Erziehungs- und Bildungsaktivitäten
H
vermehrt aus engen Familienbeziehungen hinaus (Hurrelmann 2006,
S. 190) und sowohl andere Familienformen als auch weitere Lebensbe
C
reiche werden als zentrale Sozialisationsinstanzen anerkannt und
I
gestärkt (Biermann et al. 2013, S. 81).
U L
A
Wie Kinder und Jugendliche Elternteilen in einem Haushalt. Rund 51 Prozent der
in Familien leben befragten Kinder und Jugendlichen, die angaben,
R
mit beiden Eltern zusammen zu wohnen, leben in
Schaut man sich an, in welchen Familienformen Kin- einem solchen Vier-Personen-Haushalt. Der Anteil
T
der und Jugendliche in der Schweiz und Liechten- geschwisterloser Kinder, die in einer Kernfamilie le-
stein leben, kann man zunächst feststellen, dass die ben, liegt dagegen bei etwa 9 Prozent. In Drei-Kind-
überproportionale Mehrheit von etwa 79 Prozent* in Kernfamilien leben 27 Prozent und in Kernfamilien
R
sogenannten Kernfamilien (Pupeter und Schnee- mit vier und mehr Kindern leben 13 Prozent. Etwas
kloth 2018; Schweizerische Eidgenossenschaft anders stellt sich das Bild bei den Ein-Eltern-Familien
2017) aufwachsen, das heisst, sie wohnen mit bei- dar. In dieser Familienform leben zwar auch mehr-
E
den Elternteilen zusammen. In Ein-Eltern-Familien heitlich zwei und mehr Kinder, der Anteil der Kinder
beziehungsweise Familien mit einem alleinerziehen- ohne Geschwister ist jedoch mit etwa 20 Prozent
den Elternteil leben mit etwa 18 Prozent fast ein höher und der mit einem weiteren Geschwister mit
V
Fünftel der für diese Studie befragten Kinder und 37 Prozent niedriger als bei der Kernfamilie.
Jugendlichen. In der vorliegenden Studie wurde zu- Um nicht nur Aussagen über die Familienform ma-
sätzlich unterschieden, ob ein Kind oder Jugendli- chen zu können, sondern auch zur sozioökonomi-
cher in einer Pflegefamilie (1,3 Prozent) oder in ei- schen Lage, in der Kinder und Jugendliche mit ihren
nem Kinder- und Jugendheim (0,6 Prozent) wohnt. Familien in der Schweiz und Liechtenstein leben,
wurde das Thema Kinderarmut in die Studie aufge-
nommen. Fast 10 Prozent aller in der Schweiz und
Mit wem wohnst du zusammen? N=1671 in Liechtenstein lebenden Kinder und Jugendlichen
bis 18 Jahre sind von Armut betroffen (Amt für So-
78,8%
ziale Dienste 2008; Bundeamt für Statistik BFS
2021). Als besonders armutsgefährdet gelten Ein-
Eltern-Familien und Familien mit mehr als zwei Kin-
dern. Damit ist Kinderarmut auch in der Schweiz
und Liechtenstein ein wichtiges gesellschaftliches
und politisches Thema.
18,0%
Um Daten zur Kinderarmut erheben zu können, kom-
0,6% 1,3% 1,3% men in der Forschung verschiedene Konzepte zur
mit beiden mit Mutter im Kinder- und in der Pflege- andere Anwendung (Pupeter et al. 2018). Da die vorliegende
Eltern oder Vater Jugendheim familie Wohnsituation Studie von den Erfahrungen und Perspektiven der
Kinder und Jugendlichen ausgeht, haben wir vor al-
lem nach Variablen gefragt, die Auskunft über die
Zieht man die Anzahl der Geschwister hinzu, konkre- finanzielle Situation, aber auch über Teilhabechan-
tisiert sich das Bild: Die häufigste Familienform, in cen am sozialen Leben geben. Dabei ist uns be-
der Kinder und Jugendliche in der Schweiz und wusst, dass damit nur ein Ausschnitt der gesamten
Liechtenstein leben, ist die Zwei-Kind-Kernfamilie, Lebenssituation erfasst wird. Demzufolge erhebt die
das heisst, zwei Kinder leben gemeinsam mit beiden Studie keinen Anspruch darauf, das Thema materiel-
* Zur besseren Lesbarkeit werden die Prozentzahlen
im weiteren Text gerundet dargestellt.
14 — Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021le Entbehrung vollständig abzubilden. Um die mate- 13 Prozent an, «selten» oder «nie» immerhin noch
rielle Armut einschätzen zu können, haben wir den rund 3 Prozent. Auf die nachfolgende Frage, ob sie
Kindern und Jugendlichen in Bezug auf folgende sich wünschen, dass ihnen die Eltern öfter zuhören,
fünf Dimensionen Fragen gestellt: geben 72 Prozent an, dass sie zufrieden sind, wäh-
rend 19 Prozent sich wünschen, dass ihnen die El-
• Ich esse zu Hause regelmässig Gemüse und Früch- tern mehr zuhören.
te.
• Meine Familie hat nicht genug Geld, damit ich in
Hören dir deine Eltern zu? N=1673
dem Verein mitmachen kann, in den ich möchte,
oder das Instrument spielen kann, das ich möchte.
H
42,1% 42,0%
• Weil unser Zuhause zu klein oder zu laut ist, kann
ich nicht in Ruhe Hausaufgaben machen oder
12,7%
C
habe nicht genug Platz zum Spielen oder Entspan-
0,6% 2,6%
nen.
I
nie selten manchmal oft immer
• Weil meine Familie nicht genug Geld hat, bekom-
me ich Kleider, die schon andere Kinder oder Ju-
L
gendliche getragen haben.
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Frage nach der
• Weil meine Familie nicht genug Geld hat, fahren Zeit, die Eltern mit ihren Kindern verbringen. Auch
oder fliegen wir nicht in die Ferien. hier geben mehr als drei Viertel der befragten Kinder
U
und Jugendlichen (86 Prozent) an, dass ihre Eltern
«ganz viel» oder «viel» Zeit für sie haben. Etwa vier
Während also die Merkmale Alter und Geschlecht Prozent geben aber auch an, dass ihre Eltern «keine»
A
unverändert Eingang in die Analyse fanden, wurde oder «wenig» Zeit für sie hätten. Auf die anschliessen-
die Variable «materielle Armut» nicht direkt im Fra- de Frage, ob sie sich wünschen, dass ihre Eltern mehr
gebogen abgefragt, sondern als Index aus den fünf Zeit für sie hätten, antworteten entsprechend 78 Pro-
Dimensionen berechnet und drei Unterteilungen zent, dass sie damit zufrieden sind, während 14 Pro-
R
vorgenommen: Kinder und Jugendliche mit null zent sich wünschen, dass die Eltern mehr Zeit mit ih-
Nennungen wurden als «nicht von materieller Armut nen verbringen. 8 Prozent antworteten «ist mir egal».
T
betroffen», mit einer Nennung als «teilweise von
materieller Armut betroffen» und mit zwei oder mehr
Nennungen als «stark von materieller Armut betrof- Haben deine Eltern Zeit für dich? N=1682
R
fen» eingeordnet. Darauf basierend ergibt sich für
die Kinderrechte-Studie folgendes Bild: Etwa 77
Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen sind 51,8%
E
nicht von materieller Armut betroffen, von teilwei-
33,8%
ser etwa 20 Prozent und von starker materieller Ar-
mut 3 Prozent (N=1638).
V
10,8%
0,6% 3,0%
keine wenig mittel viel ganz viel
Recht auf Förderung und
Wohlbefinden in der Familie
Um einen noch genaueren Einblick in die Bedürfnis-
Um zu erfahren, wie das Recht auf Förderung und se und Wünsche von Kindern bezüglich ihres Wohl-
Wohlbefinden in der Familie umgesetzt ist, wurden befindens in der Familie zu erhalten, wurde ihnen die
den Kindern und Jugendlichen folgende Leitfragen offene Frage «Was sollte sich verändern, damit du
gestellt: «Hören dir deine Eltern zu?» und «Haben dei- dich noch wohler/besser fühlst zu Hause?» gestellt.
ne Eltern Zeit für dich?» Die 1549 Antworten zeigen auf, dass sich für etwas
Mehr als drei Viertel der befragten Kinder und Jugend mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen
lichen (84 Prozent) geben an, dass ihre Eltern ihnen «nichts» verändern sollte. In den inhaltsbezogenen
«immer
«immer» oder «oft» zuhören. «Manchmal» geben Antworten geben die Kinder und Jugendlichen an,
Meine Eltern bevorzugen
ich will, dass das aufhört.»
meine Geschwister;
Jugendlicher, 13, Kanton Bern
Kinderrechte in der Familie — 15dass es ihnen vor allem wichtig ist, selbstbestimmter Weiter wurden die Kinder und Jugendlichen gebe-
leben und entscheiden zu können («Ich würde gerne ten, Angaben über die Erfahrung von Strafe, physi-
selber Entscheidungen treffen, z. B., wie lange ich scher und psychischer Gewalt in der Familie zu ma-
rausdarf und so»), dass die Familie weniger Streit hat chen. Dabei gibt rund ein Viertel an, dass ihre Eltern
(«Dass meine Eltern nicht so viel streiten»), die Fami- ihnen schon einmal wehgetan hätten (29 Prozent)
lie anders wohnt («Ein eigenes Zimmer») und das oder dass sie schon einmal von ihren Eltern ausge-
Verhalten der Eltern und/oder Geschwister sich än- lacht, nachgemacht, beschimpft oder beleidigt wor-
dern soll («Meine Eltern bevorzugen immer meine den seien (24 Prozent). Strafe, hier abgefragt als Haus-
Geschwister; ich will, dass das aufhört»). arrest, Fernseh-, Handy- oder Gameverbot, haben
schon rund 65 Prozent erlebt. Nur etwa 23 Prozent
H
geben dagegen an, bisher nichts von allem erfahren
zu haben. Somit gehört die Erfahrung von Strafe, phy-
Recht auf Schutz und gewaltfreies sischer und/oder psychischer Gewalt in den meisten
C
Aufwachsen in der Familie Fällen zum Alltagserleben von Kindern und Jugendli-
chen in der Schweiz und Liechtenstein dazu.
I
Um etwas darüber zu erfahren, wie das Recht auf Interessant ist zudem ein Blick auf zwei Differenzie-
Schutz und gewaltfreies Aufwachsen in der Familie rungen: Zum einen zeigt sich bei der Altersvertei-
umgesetzt ist, wurden den Kindern und Jugendli- lung, dass je älter ein Kind ist, es desto eher physi-
L
chen folgende Leitfragen gestellt: «Wie sicher fühlst sche Gewalt erfahren hat. Während 23 Prozent der
du dich in deiner Familie?», «Hast du schon mal Stra- Neun- bis Elfjährigen die Frage nach der physischen
fe, physische oder psychische Gewalt in der Familie Gewalterfahrung mit «Ja» beantworten, sind es bei
U
erfahren?» den Zwölf- bis Vierzehnjährigen bereits 28 Prozent
Etwa 94 Prozent der befragten Kinder und Jugend- und bei den Fünfzehn- bis Siebzehnjährigen 34 Pro-
lichen geben an, sich in ihrer Familie «eher sicher» zent und damit sogar gut ein Drittel der Kinder und
A
oder «total sicher» zu fühlen. Die etwa 6 Prozent, die Jugendlichen in diesem Alter. Zum anderen erleben
sich «mittel», «eher nicht» oder «gar nicht» sicher diejenigen Kinder und Jugendlichen physische Ge-
fühlen, wurden gebeten, anzugeben, was passieren walt am häufigsten, die teilweise (36 Prozent) oder
müsste, damit sie sich sicherer fühlten. Die Kinder stark (39 Prozent) von materieller Armut betroffen
«Mehr R
und Jugendlichen formulierten auf diese offene Fra- sind (im Vergleich sind etwa 26 Prozent Kinder und
ge Antworten wie: weniger Streit («Die Eltern sollten Jugendliche betroffen, die nicht von materieller Ar-
sprechen.»T
mut betroffen sind). Ein ähnliches Bild zeigt sich auch
miteinander
bei psychischer Gewalt. Während fast drei Viertel der
Kinder und Jugendlichen unabhängig von Alter oder
R
Armut Strafe in der Familie erleben, zeigen sich bei
«auslachen, beschimpfen, beleidigen» und «ignorie-
ren» deutliche Unterschiede: Rund 14 Prozent der
E
Neun- bis Elfjährigen beantworteten die Fragen, ob
sie schon mal von ihren Eltern ausgelacht, beschimpft
oder beleidigt wurden, mit «Ja». Bei den Zwölf- bis
V
Vierzehnjährigen sind es 22 Prozent und bei den Fünf-
zehn- bis Siebzehnjährigen bereits 34 Prozent. Diese
sich nicht mehr streiten»), keine physische und psy- Form der psychischen Gewalt erleben etwa 22 Pro-
chische Gewalt («Dass meine Mutter mich nicht zent der Kinder und Jugendlichen, die nicht von ma-
schlägt») sowie weniger Leistungsdruck («Ein wenig terieller Armut betroffen sind, dagegen 29 Prozent,
mehr Freizeit»), mehr Vertrauen und Freiheit («Mir die teilweise, und rund 37 Prozent, die stark von ma-
mehr Vertrauen schenken und mich machen las- terieller Armut betroffen sind.
sen»), bessere Kommunikation («Mehr miteinander
sprechen») und mehr finanzielle Mittel («Mehr Geld»)
formuliert. Meine Eltern haben mir/mich schon mal ... N=1660
(Mehrfachnennungen möglich)
64,8%
Wie sicher fühlst du dich N=1681
in deiner Familie?
76,4% 28,6%
23,7%
19,0%
Hausarrest usw. wehgetan. ausgelacht usw. ignoriert usw.
gegeben.
17,1%
1,4% 3,9%
1,2%
gar nicht eher nicht mittel eher total sicher
16 — Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021Recht auf Mitsprache und milie («Liebt ihr mich nur, wenn ich erfolgreich
Beteiligung in der Familie bin?»), Zukunftspläne, Ängste und Sorgen («Wie ich
mich wirklich fühle und was mir grosse Sorgen be-
Um etwas darüber zu erfahren, wie das Recht auf reitet»), aber auch Gesellschaft und Gerechtigkeit
Mitsprache und Beteiligung in der Familie umgesetzt («Die Probleme der Welt», «politische Inkorrektheit»)
ist, wurden den Kindern und Jugendlichen folgende und Umwelt («Klimawandel, Ernährung, Flüchtlings-
Leitfragen gestellt: «Fragen dich deine Eltern nach krisen, Tierschutz»). Die von den Kindern und Ju-
deiner Meinung?», «Wer in deiner Familie entscheidet gendlichen eingebrachten Themen zeigen auf, dass
zu zentralen Fragen des Zusammenlebens?» sie sich nebst mit Aspekten des Aufwachsens und
Fast drei Viertel der befragten Kinder und Jugendli- Erwachsenwerdens und den damit verbundenen
H
chen geben an, «oft» oder «immer» von ihren Eltern Identitätsfragen auch sehr differenziert mit gesell-
nach ihrer Meinung gefragt zu werden (74 Prozent). schaftspolitischen Fragen auseinandersetzen und
«Manchmal» geben etwa 17 Prozent an, und rund 9 diese innerhalb der Familie verhandeln möchten.
C
Prozent sagen, dass sie «selten» oder «nie» nach ihrer Geht es um die konkreten Entscheidungsprozesse
Meinung gefragt werden. innerhalb der Familie, zeigt die Studie, dass die Kin-
I
der und Jugendlichen zu einem grossen Teil mit- oder
sogar selbstständig entscheiden können. Über ihre
Fragen dich deine Eltern Privatsphäre (Zugang zum Kinderzimmer, 74 Prozent)
L
N=1681
nach deiner Meinung? und die Beziehungsgestaltung (Auswahl der Freunde
und Freundinnen, 78 Prozent) kann ein hoher Anteil
41,4% der Kinder und Jugendlichen selbst bestimmen. Bei
U
32,2% der Frage nach dem Entscheid über das Ferienziel
17,1% geben rund 75 Prozent an, dass die Familienmitglie-
6,6% der gemeinsam entscheiden. Bei der Mediennutzung
2,7%
A
(Zeitdauer der Nutzung von Handy, Computer und
nie selten manchmal oft immer Tablet) können rund 36 Prozent selbst über die Zeit-
dauer der Nutzung entscheiden, 29 Prozent entschei-
den dies gemeinsam innerhalb der Familie. Aller-
R
Auf die offen gestellte Frage «Welche Themen fin- dings gibt es bei allen vier Themen auch Kinder und
dest du wichtig und möchtest du gerne mit deinen Jugendliche, bei denen ausschliesslich die Eltern
T
Eltern besprechen?» gaben 385 der befragten Kinder entscheiden, und zwar: etwa 8 Prozent beim Zugang
und Jugendlichen eine Antwort. Die Antworten, die zum Kinderzimmer, 7 Prozent bei der Auswahl der
hier exemplarisch dargestellt werden, zeigen auf, Freunde und Freundinnen, 20 Prozent bei der Wahl
R
welche Themen Kindern und Jugendlichen beson- des Ferienziels und sogar 32 Prozent bei der Zeitdau-
ders wichtig sind: Schule und Beruf (zum Beispiel: er der Mediennutzung. So wundert es trotz der mehr-
«Was in der Schule passiert»), Erwachsenwerden heitlich positiven Ergebnisse zur Mitentscheidungs-
E
(«Das Erwachsenwerden … Wie mache ich was rich- möglichkeit in der Familie nicht, dass sich rund 17
tig, was ist gesund?»), Beziehung und Sexualität Prozent der Kinder und Jugendlichen wünschen, in
(«Liebe und Vertrauen»), Zusammenleben in der Fa- der Familie mehr mitbestimmen zu können.
V
Wer entscheidet, …
wie viel Zeit du am Handy, Computer oder Tablet
verbringst? (N=1616)
wer in dein Zimmer darf? (N=1671)
wohin du in die Ferien fährst oder fliegst?
(N=1675)
mit welchen Freunden und Freundinnen du
dich triffst? (N=1681)
0% 25% 50% 75% 100%
meine Eltern wir gemeinsam als Familie ich selbst weiss nicht
Kinderrechte in der Familie — 17C H
Kinderrechte L I
U
in der Schule
A
T R
E R
V
Kinderrechte in der Schule — 19C H
L I
AU
T R
E R
VDie Schule ist in vielerlei Hinsicht ein weiterer zentraler Sozialisations
bereich und damit Lern- und Erfahrungsraum für Kinder und Jugend-
liche. Nicht nur, weil dieser als zentraler Ort der Wissensvermittlung gilt,
sondern auch, weil Kinder und Jugendliche dort Kontakte zu
Gleichaltrigen pflegen können und Schule einen Ort darstellt, der Parti
zipation fördern kann und soll (Pupeter und Wolfert 2018). Kinder
und Jugendliche erwerben in der Schule in personell und strukturell
eingebetteten Interaktionsprozessen also auch wichtige soziale
Kompetenzen, die im besten Fall über den reinen Wissenserwerb hin-
H
ausgehen (Hurrelmann 2006).
I C
Recht auf Förderung und
Wohlbefinden in der Schule
U L
Haben deine Lehrerinnen und
Lehrer Zeit für dich?
N=1665
A
Um etwas darüber zu erfahren, wie das Recht auf
Förderung und Wohlbefinden in der Schule umgesetzt 41,1%
ist, wurden den Kindern und Jugendlichen folgende 29,4%
Leitfragen gestellt: «Hören dir deine Lehrerinnen und
R
20,3%
Lehrer zu?» und «Haben deine Lehrerinnen und Leh- 5,7%
3,5%
rer Zeit für dich?»
T
Die Ergebnisse zeigen, dass sich ein Grossteil der keine wenig mittel viel ganz viel
Kinder und Jugendlichen in der Schule grundsätzlich
wohlfühlt. Die Lehrerinnen und Lehrer sind für die
R
Mehrheit der befragten Kinder und Jugendlichen Be- Auf die offen gestellte Frage «Was sollte sich verän-
zugspersonen, die ihnen ausreichend zuhören und dern, damit du dich noch wohler/besser fühlst in der
genügend Zeit haben. So geben gut 79 Prozent an, Schule?» antworteten 1461 Kinder und Jugendliche.
E
dass die Lehrerinnen und Lehrer ihnen «oft» oder Fast die Hälfte gibt an, dass sich «nichts» verändern
«immer» zuhören. Dennoch wünscht sich aber mit sollte. Für die Kinder und Jugendlichen, die sich Ver-
18 Prozent fast jedes fünfte Kind, dass die Lehrper- änderungen wünschen, stehen insbesondere folgen-
V
son ihm öfter zuhören würde. de Themenbereiche im Vordergrund: weniger Streit,
Konflikte, Gewalt, Mobbing oder Rassismus («Weni-
ger Ausgrenzung und Vorurteile»), weniger Stress
Hören dir deine Lehrerinnen N=1658 und Leistungsdruck und mehr Freizeit («Nicht so viele
und Lehrer zu? Hausaufgaben»), Anpassungen der räumlichen Ge-
gebenheiten («Es sollte einen Raum geben, in dem
38,5% 40,9% man mit Freunden sein kann, da die Gruppenräume
auch für schulische Lektionen gebraucht werden»),
mehr Mitbestimmung und ernst genommen werden
14,2%
(«Ein Lehrer in der Primarschule war sehr gemein zu
3,1% 3,3%
uns – wir haben uns auch beim Schulleiter beschwert,
nie selten manchmal oft immer aber alle haben einfach weggehört und nichts unter-
nommen. Sie haben uns gar nicht geglaubt»).
Auf die Frage, wie viel Zeit ihre Lehrerin oder ihr Leh-
rer für sie hätten, antworteten fast 71 Prozent mit
«viel» oder «ganz viel». Das heisst aber gleichzeitig, Recht auf Schutz und gewaltfreies
dass mehr als ein Viertel der Kinder der Ansicht sind, Aufwachsen in der Schule
ihre Lehrperson hätte nicht viel Zeit für sie: Sie be-
antworteten diese Frage auf einer Skala von eins bis Um zu erfahren, wie das Recht auf Schutz und ge-
fünf mit eins, zwei oder drei. Die anschliessende Fra- waltfreies Aufwachsen in der Schule umgesetzt ist,
ge, ob sie sich wünschen, dass ihre Lehrerin oder ihr wurden die Kinder und Jugendlichen gefragt, wie
Lehrer mehr Zeit hätte, beantworteten 76 Prozent sicher sie sich in der Schule fühlen und ob sie bereits
der Kinder und Jugendlichen mit «Nein» und 14 Pro- Strafen, physische oder psychische Gewalt in der
zent geben an, dass es ihnen unwichtig ist. Nur 10 Schule erfahren haben.
Prozent würden sich effektiv mehr Zeit von ihrer Mit gut 85 Prozent gibt die grosse Mehrheit der Kin-
Lehrperson wünschen. der und Jugendlichen an, sich in der Schule «eher
20 — Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021«…weniger Stress
und Druck … »CH
I L
Jugendliche, 15, Liechtenstein
sicher» oder «total sicher» zu fühlen. Die von den Kin-
AU
Die Kinder und Jugendlichen wurden zudem nach
R
dern und Jugendlichen genannten Veränderungs- Straf- und Gewalterfahrungen in der Schule befragt.
wünsche, um sich in der Schule sicherer zu fühlen, Mit gut 35 Prozent kamen bei mehr als jedem dritten
T
zeigen eine grosse Diversität. Die knapp 15 Prozent, Kind Strafen wie Nachsitzen, Vor-die-Tür-Gehen oder
die sich «mittel», «eher nicht» oder «gar nicht» sicher Zusatzaufgaben vor. Dass Lehrerinnen und Lehrer
fühlen, wurden gebeten, anzugeben, was passieren ihnen zur Strafe private Dinge wie zum Beispiel das
R
müsste, damit sie sich sicherer fühlen. Die Kinder Handy wegnehmen, hat 15 Prozent der Kinder und
und Jugendlichen formulierten auf diese offene Fra- Jugendlichen erlebt. 12 Prozent bestätigen, dass sie
ge Antworten wie weniger physische und psychi- schon einmal von ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer
E
sche Gewalt («Dass mich weniger Kinder mobben»), ausgelacht, nachgemacht, beschimpft oder beleidigt
das Handeln der Lehrpersonen sollte sich ändern worden sind, und sogar 3 Prozent der befragten Kin-
(«Die Lehrer sollen auch mal auf die Schüler hören der und Jugendlichen geben an, dass ihre Lehrper-
V
und nicht immer die Mädchen bevorzugen»), das son ihnen schon einmal wehgetan hat. Mit gut 52 Pro-
Schulsystem sollte sich verändern («mehr Zeit/we- zent geben aber auch etwas mehr als die Hälfte der
niger Stress und Druck») und es benötigt einen bes- Kinder und Jugendlichen an, weder Strafen noch Ge-
seren Zusammenhalt in der Klasse («Einige Klassen- walt durch ihre Lehrperson erfahren zu haben. Bei den
kameraden sollten mehr Respekt zeigen»). Straf- und Gewalterfahrungen in der Schule zeigt sich
ein signifikanter Unterschied hinsichtlich Alter und
Geschlecht. Der Mittelwert steigt mit zunehmendem
Wie sicher fühlst du dich N=1667 Alter. Zudem erleben Schüler signifikant häufiger Ge-
in deiner Schule? walt als ihre Mitschülerinnen. Mit 4 Prozent sind im
Durchschnitt mehr als doppelt so viele Jungen von
52,6% physischen Gewalterfahrungen durch die Lehrperson
betroffen als Mädchen (2 Prozent). Aber auch psychi-
32,6%
scher Gewalt und Strafen sind Schüler markant häufi-
ger ausgesetzt als Schülerinnen.
10,4%
2,1% 2,3%
gar nicht eher nicht mittel eher total sicher Meine Lehrerin oder mein Lehrer N=1701
hat mich/mir schon mal ...
(Mehrfachnennungen möglich)
35,2%
15,0% 12,1%
2,9%
bestraft Sachen wegge- ausgelacht usw. wehgetan.
(nachsitzen usw.). nommen.
Kinderrechte in der Schule — 21Unter Kindern und Jugendlichen kommt es häufig zu Politik, Rassismus oder Coronavirus («Ich will manch-
Gewalt und Mobbing. Etwas mehr als 43 Prozent wur- mal ein bisschen mehr über die Politik sprechen»),
den von anderen Schülerinnen und Schülern schon Schulsystem («Überlastung, Überforderung in der
ausgelacht, beleidigt, beschimpft oder nachgeahmt. Schule»), Mobbing, Streit, Probleme und persönliches
Physische Gewalt durch andere Schülerinnen und Wohlbefinden («Über Mobbing, denn es gibt viele Kin-
Schüler erlebte knapp eins von drei Kindern (32 Pro- der, die Selbstmord machen wegen dem»). Die von
zent). 23 Prozent geben an, von anderen Schülerin- den Kindern und Jugendlichen eingebrachten und
nen und Schülern schon ausgegrenzt und gemobbt hier exemplarisch dargestellten Themen zeigen, dass
worden zu sein, und fast 16 Prozent wurden private die konkreten Gestaltungsfragen von Unterrichtsin-
Sachen, wie zum Beispiel das Handy, weggenom- halten und die grundsätzlichen Anforderungen, die
H
men. Zwischen den Geschlechtern zeigt sich auch das Schulsystem stellt, wichtig sind. Auch in diesem
hier ein Unterschied. Mädchen machen signifikant Lebensbereich wird deutlich, dass sich Kinder und
weniger Gewalterfahrungen durch andere Kinder und Jugendliche sehr differenziert mit gesellschaftlichen
C
Jugendliche als Jungen. Fragen auseinandersetzen. Ausserdem möchten sie
mit den Erwachsenen über Themen wie Ausgren-
I
zung und deren Auswirkungen diskutieren. Geht es
Andere Schüler und Schülerinnen haben N=1643 um die Entscheidungsprozesse in der Schule, zeigt
mich/mir schon mal … sich, dass Lehrerinnen und Lehrer häufig selbst ent-
L
(Mehrfachnennungen möglich) scheiden. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugend-
43,3% lichen geben an, bei strukturellen Richtlinien wie
32,3%
Klassenregeln (62 Prozent), bei schulischen Aktivitä-
U
22,7% ten (62 Prozent) und bei der Gestaltung von Schul-
15,7% räumen (55 Prozent) keine Mitsprache zu haben. Nur
bei der Entscheidung, neben wem man sitzt, gibt
A
eine Mehrheit der Kinder und Jugendlichen an, die
ausgelacht etc. wehgetan. ausgegrenzt/ Sachen wegge-
gemobbt. nommen.
Entscheidung selbst oder gemeinsam mit der Lehr-
person treffen zu können.
R
Wer entscheidet in der Schule, ...
T
Recht auf Mitsprache und Beteiligung
in der Schule welche Klassenregeln gelten?
(N=1654)
R
Um etwas darüber zu erfahren, wie das Recht auf
wohin ihr auf Ausflüge geht?
Mitsprache und Beteiligung in der Schule umgesetzt (N=1653)
ist, wurden den Kindern und Jugendlichen folgende
E
wie Schulzimmer/Pausenplatz
Leitfragen gestellt: «Fragen dich deine Lehrerinnen aussehen? (N=1651)
und Lehrer nach deiner Meinung?», «Wer in der Schu-
le entscheidet zu zentralen Fragen des Zusammen neben wem du sitzt? (N=1657)
V
lebens?»
0% 25% 50% 75% 100%
63 Prozent der Kinder und Jugendlichen geben an,
oft oder immer von ihren Lehrerinnen und Lehrern Lehrer/-innen Schüler/-innen gemeinsam mit Lehrer/-innen
nach ihrer Meinung gefragt zu werden. 37 Prozent Schüler/-innen weiss nicht
dagegen bekunden, nie, selten oder nur manchmal
nach der eigenen Meinung gefragt zu werden.
Dabei zeigt sich insbesondere bei der Frage, wer die
Klassenregeln bestimmt, ein interessanter Zusam-
Fragen dich deine Lehrerinnen und N=1664 menhang zum Alter der Befragten. Je älter die Kinder
Lehrer nach deiner Meinung? und Jugendlichen sind, desto weniger werden sie von
39,1% ihren Lehrerinnen und Lehrern in diesen Entschei-
dungsprozess miteinbezogen. So vermag es dann
23,0% 23,8%
auch kaum zu erstaunen, dass sich mit 27 Prozent
5,9% 8,2% mehr als jedes vierte Kind mehr Mitbestimmungs-
möglichkeiten wünscht. 60 Prozent finden ihre Mit-
nie selten manchmal oft immer bestimmungsrechte in Ordnung so, wie sie sind, und
13 Prozent der Teilnehmenden geben an, dass es ih-
nen egal sei, ob sie mehr mitbestimmen können.
Auf die offen gestellte Frage «Welche Themen fin-
dest du wichtig und möchtest du gerne mit deinen
Lehrerinnen und Lehrern besprechen?» gaben 504
der befragten Kinder und Jugendlichen eine Antwort.
Die Antworten zeigen für die Kinder und Jugendli-
chen besonders wichtige Themen auf: Unterrichts-
gestaltung (zum Beispiel: «Im Unterricht mehr auf
unsere Fragen eingehen und sich mehr Zeit neh-
men»), gesellschaftspolitische Themen wie Umwelt,
22 — Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021« Im UnterrichtCH
mehr auf unsere
L I
AU
Fragen Reingehen
undR T
sich mehr
E
Zeit nehmen …»
V
Jugendliche, 17, Kanton St. Gallen
Kinderrechte in der Schule — 23C H
Kinderrechte L I
U
in der Freizeit
A
T R
E R
V
Kinderrechte in der Freizeit — 25C H
L I
AU
T R
E R
VDer Lebensbereich Freizeit umfasst unter anderem Vereinstätigkeiten,
den Besuch von Kinder- und Jugendtreffs, aber auch die Nutzung
digitaler Medien usw. Er stellt neben Familie und Schule einen dritten
zentralen Sozialisationsbereich von Kindern und Jugendlichen dar.
Ausserschulische Angebote wie auch die Möglichkeit, Freizeitaktivitä-
ten ergänzend zu Familie und Schule zu erleben und sich dabei zu
erholen und zu entspannen, eigenen Interessen und (Freundes-)Bezie-
hungen nachzugehen, sind dabei wichtige Aspekte (bspw. Dach
verband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz DOJ/AFAJ 2018;
H
Wolfert und Pupeter 2018). Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung
wird in der Kinderrechtskonvention in Artikel 31 festgehalten.
I C
Recht auf Förderung und
Wohlbefinden in der Freizeit
Um etwas darüber zu erfahren, wie das Recht auf
U L
Auf die Frage, ob ihnen die Erwachsenen im Freizeit-
bereich – wie Trainerinnen und Trainer oder Jugend-
arbeiterinnen und Jugendarbeiter – zuhören, antwor-
teten rund 82 Prozent der Kinder und Jugendlichen
A
Förderung und Wohlbefinden in der Freizeit umge- mit «oft» oder «immer». Weitere 13 Prozent der Kinder
setzt ist, wurden den Kindern und Jugendlichen fol- und Jugendlichen erleben, dass ihnen die Erwach
gende Leitfragen gestellt: «Hast du unter der Woche senen im Freizeitbereich «manchmal» zuhören. Je-
genug Zeit, um dich zu erholen und zu entspan- doch etwa 4 Prozent geben auch an, dass sie «nie»
R
nen?», «Hören dir die Erwachsenen (zum Beispiel oder «selten» erfahren, dass Erwachsene ihnen zu-
Trainerinnen und Trainer; Jugendarbeiterinnen und hören. Auf die Frage, ob sie sich wünschen, dass ih-
T
Jugendarbeiter) zu?» und «Haben die Erwachsenen nen die Erwachsenen in der Freizeit öfter zuhören,
(Trainerinnen und Trainer; Jugendarbeiterinnen und antworten 10 Prozent mit «Ja».
Jugendarbeiter) Zeit für dich?»
R
Rund zwei Drittel, nämlich 64 Prozent geben an, dass
sie unter der Woche «ganz viel» beziehungsweise Hören dir die Erwachsenen N=1630
«viel Zeit» haben, um sich zu erholen und zu entspan- (z.B. Trainerinnen und Jugendarbeiter) zu?
E
nen. Jedes fünfte Kind oder jeder fünfte Jugendliche
44,2%
gibt einen Wert im mittleren Bereich an und rund 16 38,2%
Prozent der Kinder und Jugendlichen hat «wenig» bis
V
«keine Zeit», sich unter der Woche zu erholen oder zu
13,2%
entspannen. Lohnen tut sich hier ein differenzierter
Blick auf die Altersverteilung, denn es zeigt sich, dass 2,1% 2,3%
die älteren Kinder und Jugendlichen eher weniger Zeit nie selten manchmal oft immer
für Erholung unter der Woche haben als die jüngeren
Kinder und Jugendlichen: Während rund 74 Prozent
der Neun- bis Elfjährigen angeben, «ganz viel» bzw. In einem etwas geringeren Umfang, aber dennoch
«viel Zeit» unter der Woche zu haben, sind es bei den positiv erleben die Kinder und Jugendlichen die Zeit,
Zwölf- bis Vierzehnjährigen noch 66 Prozent und bei die Erwachsene im Freizeitbereich für sie haben. Drei
den Fünfzehn- bis Siebzehnjährigen 53 Prozent. Viertel bewerten die erhaltene Zeit positiv und antwor-
ten mit «viel» oder «ganz viel» (75 Prozent) und rund
19 Prozent mit «mittel». Dass die Erwachsenen «kei-
Hast du unter der Woche Zeit, um dich N=1639 ne» oder «wenig Zeit» für sie haben, findet 6 Prozent
zu erholen und zu entspannen? der befragten Kinder und Jugendlichen. Rund 7 Pro-
zent wünscht sich explizit, dass die Erwachsenen
9 –11 Jahre mehr Zeit für sie haben.
12–14 Jahre
15 –17 Jahre
Haben die Erwachsenen N=1629
(z. B. Trainerinnen und Jugendarbeiter)
0% 25% 50% 75% 100%
Zeit für dich?
keine wenig ganz viel
39,7%
mittel viel 35,3%
18,8%
2,8% 3,4%
keine wenig mittel viel ganz viel
26 — Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021Sie können auch lesen