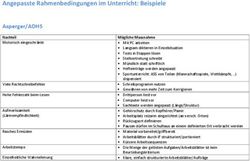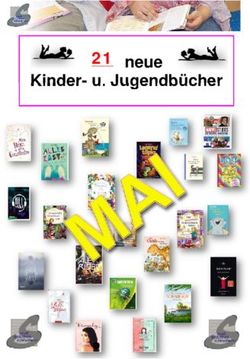Kleider in der Literatur - Lehrerinformation
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Deutsch 01 / Kleider machen Schule
Kleider in der Literatur
Lehrerinformation
1/7
Arbeitsauftrag
Die Sch’ analysieren verschiedene Texte. Sie sollen erkennen, nach welchen Kriterien die
Selektion der Kleidung in den Textbeispielen vorgenommen wird.
Ziel
Die Sch’ erkennen, dass im Alltag Kleider verschiedene Funktionen übernehmen: Schutz
vor Witterung, kulturelle Identität, Gruppenidentität, Berufskleidung (Uniform,
Schutzanzug), Selbstdarstellung, Erotik etc.
Material
Arbeitsblatt mit Texten
Lösungen mit Erläuterungen
Sozialform
GA
Zeit
30’
Zusätzliche Autor: Prof. Dr. M. Andermatt
Informationen:
www.t-schoolproject.comDeutsch 01 / Kleider machen Schule
Kleider in der Literatur
Arbeitsblatt
2/7
Lies die beiden Texte – es sind Auszüge aus bekannten Büchern berühmter Autoren –
durch und bestimme anschliessend die Selektionskriterien der Kleiderwahl in den Texten.
Streiche die entsprechenden Textstellen an und notiere deine Ergebnisse in den
Tabellen.
Aufgabe:
Hinweis: Im Unterschied zur Lebenswelt (welche Rolle spielen Kleider im Alltag?) ist
Kleidung in der Literatur nur versatzstückartig, als vom Autor bewusstes Element
vorhanden.
Text 1, Figurencharakterisierung: Vor Sonnenaufgang
Text von Gerhart Hauptmann (1889)
Erster Akt
Das Zimmer ist niedrig; der Fußboden mit gutem Teppich belegt. Moderner Luxus auf bäuerische Dürftigkeit
gepfropft. An der Wand hinter dem Esstisch ein Gemälde, darstellend einen vierspännigen Frachtwagen, von einem
Fuhrknecht in blauer Bluse geleitet.
Miele, eine robuste Bauernmagd mit rotem, etwas stumpfsinnigen Gesicht; sie öffnet die Mitteltür und lässt Alfred
Loth eintreten. Loth ist mittelgroß, breitschultrig, untersetzt, in seinen Bewegungen bestimmt, doch ein wenig
ungelenk; er hat blondes Haar, blaue Augen und ein dünnes lichtblondes Schnurrbärtchen, sein ganzes Gesicht ist
knochig und hat einen gleichmäßig ernsten Ausdruck. Er ist ordentlich, jedoch nichts weniger als modern gekleidet.
Miele: Bitte! Ich werden Herrn Inschinnär glei ruffen. Wollen Sie nich Platz nehmen?!
[...] Die Tür rechts wird aufgemacht. Hoffmann steckt den Kopf heraus. [...] Hoffmann ist etwa dreiundreißig Jahre
alt, schlank, groß, hager. Er kleidet sich nach der neuesten Mode, ist elegant frisiert, trägt kostbare Ringe und
Brillantknöpfe. Kopfhaar und Schnurrbart schwarz, der Letztere sehr üppig, äußerst sorgfältig gepflegt. Gesicht spitz,
vogelartig. Ausdruck verschwommen, Augen schwarz, lebhaft, zuweilen unruhig.
Loth Hoffmann
www.t-schoolproject.comDeutsch 01 / Kleider machen Schule
Kleider in der Literatur
Arbeitsblatt
3/7
Text 2, multiperspektivische Charakterisierung: Effi Briest
Text von Theodor Fontane (1894/95)
[...] Beide, Mutter und Tochter, waren fleißig bei der Arbeit [...]. Rasch und sicher ging die Wollnadel der Damen hin
und her, aber während die Mutter kein Auge von der Arbeit ließ, legte die Tochter, die den Rufnamen Effi führte,
von Zeit zu Zeit die Nadel nieder und erhob sich, um unter allerlei kunstgerechten Beugungen und Streckungen den
ganzen Kursus der Heil- und Zimmergymnastik durchzumachen. Es war ersichtlich, daß sie sich diesen absichtlich ein
wenig ins Komische gezogenen Übungen mit ganz besonderer Liebe hingab, und wenn sie dann so dastand und,
langsam die Arme hebend, die Handflächen hoch über dem Kopf zusammenlegte, so sah auch wohl die Mama von
ihrer Handarbeit auf, aber immer nur flüchtig und verstohlen, weil sie nicht zeigen wollte, wie entzückend sie ihr
eigenes Kind finde, zu welcher Regung mütterlichen Stolzes sie voll berechtigt war. Effi trug ein blau und weiß
gestreiftes, halb kittelartiges Leinwandkleid, dem erst ein fest zusammengezogener, bronzefarbener Ledergürtel die
Taille gab; der Hals war frei, und über Schulter und Nacken fiel ein breiter Matrosenkragen. In allem, was sie tat,
paarten sich Übermut und Grazie, während ihre lachenden braunen Augen eine große, natürliche Klugheit und viel
Lebenslust und Herzensgüte verrieten. Man nannte sie die »Kleine«, was sie sich nur gefallen lassen mußte, weil die
schöne, schlanke Mama noch um eine Handbreit höher war.
[...] [Effis Freundin] Hulda sagte mit einem Male: »Nun aber ist es höchste Zeit, Effi; du siehst ja aus, ja, wie sag ich
nur, du siehst ja aus, wie wenn du vom Kirschenpflücken kämst, alles zerknittert und zerknautscht; das Leinenzeug
macht immer so viele Falten, und der große weiße Klappkragen ... ja, wahrhaftig, jetzt hab ich es, du siehst aus wie
ein Schiffsjunge.«
»Midshipman, wenn ich bitten darf. Etwas muß ich doch von meinem Adel haben. Übrigens, Midshipman oder
Schiffsjunge, Papa hat mir erst neulich wieder einen Mastbaum versprochen, hier dicht neben der Schaukel, mit
Rahmen und einer Strickleiter. Wahrhaftig, das sollte mir gefallen, und den Wimpel oben selbst anzumachen, das
ließ' ich mir nicht nehmen. Und du, Hulda, du kämst dann von der anderen Seite her herauf, und oben in der Luft
wollten wir hurra rufen und uns einen Kuß geben. Alle Wetter, das sollte schmecken. «[...]$
»Nun bist du doch noch in deinem Kittel, und der Besuch ist da. Nie hältst du Zeit.« [...] Frau von Briest aber, die
unter Umständen auch unkonventionell sein konnte, hielt plötzlich die schon forteilende Effi zurück, warf einen
Blick auf das jugendlich reizende Geschöpf, das, noch erhitzt von der Aufregung des Spiels, wie ein Bild frischesten
Lebens vor ihr stand, und sagte beinahe vertraulich: »Es ist am Ende das beste, du bleibst, wie du bist. Ja, bleibe so.
Du siehst gerade sehr gut aus. Und wenn es auch nicht wäre, du siehst so unvorbereitet aus, so gar nicht zurecht-
gemacht, und darauf kommt es in diesem Augenblick an. Ich muß dir nämlich sagen, meine süße Effi ...«, und sie
nahm ihres Kindes beide Hände, »... ich muß dir nämlich sagen ...« »Aber Mama, was hast du nur? Mir wird ja ganz
angst und bange. »... Ich muß dir nämlich sagen, Effi, dass Baron Innstetten eben um deine Hand angehalten hat.«
Effi 1 (Sicht des Erzählers) Effi 2 (Sicht Huldas/Effis)
Effi 3 (Sicht der Mutter)
www.t-schoolproject.comDeutsch 01 / Kleider machen Schule
Kleider in der Literatur
Arbeitsblatt
4/7
Text 3, subjektive Charakterisierung: Der goldne Topf
Text von E.T.A. Hoffmann (1819)
[...] [Es] stand plötzlich ein langer hagerer Mann, in einen weiten lichtgrauen Überrock gehüllt, vor ihm und rief,
indem er ihn mit seinen großen feurigen Augen anblitzte: »Hei hei – was klagt und winselt denn da? – Hei, hei, das
ist ja Herr Anselmus, der meine Manuskripte kopieren will.« [...] – Der Archivarius [...] schritt rasch von dannen, so,
dass er in der tiefen Dämmerung, die unterdessen eingebrochen, mehr in das Tal hinabzuschweben als zu gehen
schien. Schon war er in der Nähe des Koselschen Gartens, da setzte sich der Wind in den weiten Überrock und trieb
die Schöße auseinander, dass sie wie ein Paar große Flügel in den Lüften flatterten, und es dem Studenten
Anselmus, der verwunderungsvoll dem Archivarius nachsah, vorkam, als breite ein großer Vogel die Fittige aus zum
raschen Fluge. – Wie der Student nun so in die Dämmerung hineinstarrte, da erhob sich mit krächzendem Geschrei
ein weißgrauer Geier hoch in die Lüfte, und er merkte nun wohl, dass das weiße Geflatter, was er noch immer für
den davonschreitenden Archivarius gehalten, schon eben der Geier gewesen sein müsse, unerachtet er nicht
begreifen konnte, wo denn der Archivarius mit einemmal hingeschwunden. [...]
Text 4, Kleidersymbolik: Die Leiden des jungen Werthers
Text von Johann Wolfgang Goethe (1774)
[...] Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen einfachen Frack, in dem ich mit Lotten zum
erstenmale tanzte, abzulegen, er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen ganz
wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu. Ganz will es doch die
Wirkung nicht tun. Ich weiß nicht – ich denke, mit der Zeit soll mir der auch lieber werden.
[…]
Aus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtische die Tat
vollbracht, dann ist er heruntergesunken, hat sich konvulsivisch um den Stuhl herumgewälzt. Er lag gegen das
Fenster entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste.
www.t-schoolproject.comDeutsch 01 / Kleider machen Schule
Kleider in der Literatur
Lösung
5/7
Lösung:
Lebenswelt: Welche Rolle spielen Kleider im Alltag?
Einstiegsgespräch mit den Schülern: Es soll deutlich werden, dass im Alltag Kleider verschiedene Funktionen
übernehmen: Schutz vor Witterung, kulturelle Identität, Gruppenidentität, Berufskleidung (Uniform, Schutzanzug),
Selbstdarstellung, Erotik etc.
Textwelt: Das Prinzip der Selektion
Überleitung zu den Textanalysen: Im Unterschied zur Lebenswelt ist Kleidung in der Literatur nur versatzstückartig,
als vom Autor, der Autorein bewusst gesetztes Element vorhanden. Wer erinnert sich, was für Kleider der Student
Anselmus (Der goldne Topf), Walter Faber (Homo faber), Effi Briest etc. trägt? – Bei den folgenden Textbeispielen soll
es darum gehen, zu erkennen, nach welchen Kriterien die Selektion der Kleidung vorgenommen wird. Kleidung dient
der Figurencharakterisierung; es wird mittels Kleidung Spezifisches zu einer Figur ausgesagt.
Text 1, Figurencharakterisierung: Vor Sonnenaufgang
Text von Gerhart Hauptmann (1889)
Erster Akt
Das Zimmer ist niedrig; der Fußboden mit gutem Teppich belegt. Moderner Luxus auf bäuerische Dürftigkeit
gepfropft. An der Wand hinter dem Esstisch ein Gemälde, darstellend einen vierspännigen Frachtwagen, von einem
Fuhrknecht in blauer Bluse geleitet.
Miele, eine robuste Bauernmagd mit rotem, etwas stumpfsinnigen Gesicht; sie öffnet die Mitteltür und lässt Alfred
Loth eintreten. Loth ist mittelgroß, breitschultrig, untersetzt, in seinen Bewegungen bestimmt, doch ein wenig
ungelenk; er hat blondes Haar, blaue Augen und ein dünnes lichtblondes Schnurrbärtchen, sein ganzes Gesicht ist
knochig und hat einen gleichmäßig ernsten Ausdruck. Er ist ordentlich, jedoch nichts weniger als modern gekleidet.
Miele: Bitte! Ich werden Herrn Inschinnär glei ruffen. Wollen Sie nich Platz nehmen?!
[...] Die Tür rechts wird aufgemacht. Hoffmann steckt den Kopf heraus. [...] Hoffmann ist etwa dreiundreißig Jahre
alt, schlank, groß, hager. Er kleidet sich nach der neuesten Mode, ist elegant frisiert, trägt kostbare Ringe und
Brillantknöpfe. Kopfhaar und Schnurrbart schwarz, der Letztere sehr üppig, äußerst sorgfältig gepflegt. Gesicht
spitz, vogelartig. Ausdruck verschwommen, Augen schwarz, lebhaft, zuweilen unruhig.
Loth Hoffmann
nicht weniger als modern kleidet sich nach der
altmodisch modisch
gekleidet neusten Mode
trägt kostbare Ringe und
ordentlich zurückhaltend, korrekt Reichtum, Angeberei
Brillantknöpfe
- Materialismus + Materialismus
www.t-schoolproject.comDeutsch 01 / Kleider machen Schule
Kleider in der Literatur
Lösung
6/7
Text 2, multiperspektivische Charakterisierung: Effi Briest
Text von Theodor Fontane (1894/95)
[...] Beide, Mutter und Tochter, waren fleißig bei der Arbeit [...]. Rasch und sicher ging die Wollnadel der Damen hin
und her, aber während die Mutter kein Auge von der Arbeit ließ, legte die Tochter, die den Rufnamen Effi führte,
von Zeit zu Zeit die Nadel nieder und erhob sich, um unter allerlei kunstgerechten Beugungen und Streckungen den
ganzen Kursus der Heil- und Zimmergymnastik durchzumachen. Es war ersichtlich, daß sie sich diesen absichtlich ein
wenig ins Komische gezogenen Übungen mit ganz besonderer Liebe hingab, und wenn sie dann so dastand und,
langsam die Arme hebend, die Handflächen hoch über dem Kopf zusammenlegte, so sah auch wohl die Mama von
ihrer Handarbeit auf, aber immer nur flüchtig und verstohlen, weil sie nicht zeigen wollte, wie entzückend sie ihr
eigenes Kind finde, zu welcher Regung mütterlichen Stolzes sie voll berechtigt war. Effi trug ein blau und weiß
gestreiftes, halb kittelartiges Leinwandkleid, dem erst ein fest zusammengezogener, bronzefarbener Ledergürtel
die Taille gab; der Hals war frei, und über Schulter und Nacken fiel ein breiter Matrosenkragen. In allem, was sie
tat, paarten sich Übermut und Grazie, während ihre lachenden braunen Augen eine große, natürliche Klugheit und
viel Lebenslust und Herzensgüte verrieten. Man nannte sie die »Kleine«, was sie sich nur gefallen lassen mußte, weil
die schöne, schlanke Mama noch um eine Handbreit höher war.
[...] [Effis Freundin] Hulda sagte mit einem Male: »Nun aber ist es höchste Zeit, Effi; du siehst ja aus, ja, wie sag ich
nur, du siehst ja aus, wie wenn du vom Kirschenpflücken kämst, alles zerknittert und zerknautscht; das
Leinenzeug macht immer so viele Falten, und der große weiße Klappkragen ... ja, wahrhaftig, jetzt hab ich es, du
siehst aus wie ein Schiffsjunge.«
»Midshipman, wenn ich bitten darf. Etwas muß ich doch von meinem Adel haben. Übrigens, Midshipman oder
Schiffsjunge, Papa hat mir erst neulich wieder einen Mastbaum versprochen, hier dicht neben der Schaukel, mit
Rahmen und einer Strickleiter. Wahrhaftig, das sollte mir gefallen, und den Wimpel oben selbst anzumachen, das
ließ' ich mir nicht nehmen. Und du, Hulda, du kämst dann von der anderen Seite her herauf, und oben in der Luft
wollten wir hurra rufen und uns einen Kuß geben. Alle Wetter, das sollte schmecken. «[...]$
»Nun bist du doch noch in deinem Kittel, und der Besuch ist da. Nie hältst du Zeit.« [...] Frau von Briest aber, die
unter Umständen auch unkonventionell sein konnte, hielt plötzlich die schon forteilende Effi zurück, warf einen
Blick auf das jugendlich reizende Geschöpf, das, noch erhitzt von der Aufregung des Spiels, wie ein Bild frischesten
Lebens vor ihr stand, und sagte beinahe vertraulich: »Es ist am Ende das beste, du bleibst, wie du bist. Ja, bleibe so.
Du siehst gerade sehr gut aus. Und wenn es auch nicht wäre, du siehst so unvorbereitet aus, so gar nicht zurecht-
gemacht, und darauf kommt es in diesem Augenblick an. Ich muß dir nämlich sagen, meine süße Effi ...«, und sie
nahm ihres Kindes beide Hände, »... ich muß dir nämlich sagen ...« »Aber Mama, was hast du nur? Mir wird ja ganz
angst und bange. »... Ich muß dir nämlich sagen, Effi, dass Baron Innstetten eben um deine Hand angehalten hat.«
Effi 1 (Sicht des Erzählers) Effi 2 (Sicht Huldas/Effis)
Matrosenkleid Kind zerknittert Knabe
Ledergürtel Frau junger Mann
+/– Erotik wild
Effi 3 (Sicht der Mutter)
Kittel – Konvention
+ Jugend
+ Vitalität
natürlich
www.t-schoolproject.comDeutsch 01 / Kleider machen Schule
Kleider in der Literatur
Lösung
7/7
Text 3, subjektive Charakterisierung: Der goldne Topf
Text von E.T.A. Hoffmann (1819)
[...] [Es] stand plötzlich ein langer hagerer Mann, in einen weiten lichtgrauen Überrock gehüllt, vor ihm und rief,
indem er ihn mit seinen großen feurigen Augen anblitzte: »Hei hei – was klagt und winselt denn da? – Hei, hei, das
ist ja Herr Anselmus, der meine Manuskripte kopieren will.« [...] – Der Archivarius [...] schritt rasch von dannen, so,
dass er in der tiefen Dämmerung, die unterdessen eingebrochen, mehr in das Tal hinabzuschweben als zu gehen
schien. Schon war er in der Nähe des Koselschen Gartens, da setzte sich der Wind in den weiten Überrock und
trieb die Schöße auseinander, dass sie wie ein Paar große Flügel in den Lüften flatterten, und es dem Studenten
Anselmus, der verwunderungsvoll dem Archivarius nachsah, vorkam, als breite ein großer Vogel die Fittige aus
zum raschen Fluge. – Wie der Student nun so in die Dämmerung hineinstarrte, da erhob sich mit krächzendem
Geschrei ein weißgrauer Geier hoch in die Lüfte, und er merkte nun wohl, dass das weiße Geflatter, was er noch
immer für den davonschreitenden Archivarius gehalten, schon eben der Geier gewesen sein müsse, unerachtet er
nicht begreifen konnte, wo denn der Archivarius mit einemmal hingeschwunden. [...]
Die Doppelexistenz von Archivarius Lindhorst wird an dieser Stelle wesentlich über die Kleider thematisiert. Die Stelle
zeigt zudem exemplarisch, wie Hoffmanns Phantastik über die Figurensicht vermittelt ist.
Text 4, Kleidersymbolik: Die Leiden des jungen Werthers
Text von Johann Wolfgang Goethe (1774)
[...] Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen einfachen Frack, in dem ich mit Lotten zum
erstenmale tanzte, abzulegen, er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen ganz
wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu. Ganz will es doch
die Wirkung nicht tun. Ich weiß nicht – ich denke, mit der Zeit soll mir der auch lieber werden.
[…]
Aus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtische die Tat
vollbracht, dann ist er heruntergesunken, hat sich konvulsivisch um den Stuhl herumgewälzt. Er lag gegen das
Fenster entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste.
Erläuterungen zu Werthers Kleidung: Das damalige Bürgertum übte Kritik an der höfischen Mode und kleidete sich
im Gegensatz zu Hof und Adel betont schlicht. Die englische Mode hatte sich bereits im 17. Jahrhundert nach der
bürgerlichen Revolution in England vom Hof emanzipiert. Sie griff in den 1770er-Jahren auf den Kontinent über und
wurde auch in Deutschland zum Zeichen bürgerlicher Freiheitsbestrebungen.
Nach Erscheinen des Romans "Die Leiden des jungen Werthers" von Johann Wolfgang Goethe 1774 wurde die darin
beschriebene, nach englischem Vorbild gestaltete Kleidung des jungen Werther zur Tracht fortschrittlich gesinnter
Bürger. Mit dem Anlegen der Werther-Tracht, deren gelblederne Kniehosen und Stulpenstiefel markantes Zeichen
war, demonstrierte man den Anspruch auf persönliche Freiheit, damit auch den Widerstand gegen die höfischen
Sitten.
www.t-schoolproject.comSie können auch lesen