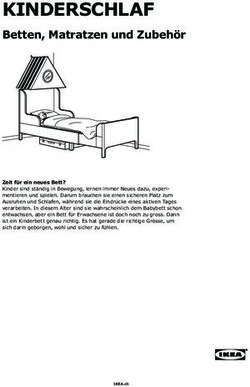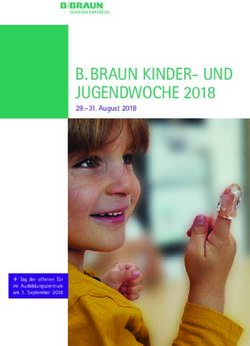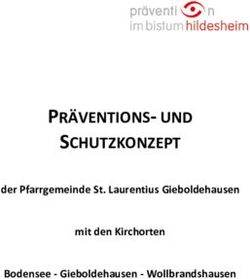Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen - Leuphana ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen
Prof. Dr. Peter Paulus
Institut für Psychologie
Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften
Leuphana Universität Lüneburg
8. September 2010, 13.30 – 14.30 Uhr
Überblick
• Generelle Trends
• Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
• Was brauchen Kinder und Jugendliche zum Aufwachsen, zum
guten gesunden Aufwachsen?
• Gute gesunde Schule
• ResümeeLebenswelt
• Mit dem Begriff der Lebenswelt bezeichne dich hier :
(1) die menschliche Welt in ihrer vorwissenschaftlichen
Selbstverständlichkeit und Erfahrbarkeit in Abgrenzung
zur theoretisch bestimmten wissenschaftlichen Weltsicht
(2) die umfassende historisch gegebene sozio-kulturelle
Umwelt
Gesellschaftliche Trends mit ihren direkten und
indirekten Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche
• Globalisierung der Wirtschaft verändert die ökonomischen
Ausgangsbedingungen grundlegend (Deregulation)
• Die Integrationskraft bestehender sozialer Strukturen (z.B.
Familie, Nachbarschaften) schwindet und Erosionsprozesse in den
sozialen Milieus nehmen scheinbar unaufhaltsam zu
• Verbindliche Orientierungen (Werte, Normen) sind kaum noch
gegeben bzw. schwerer erreichbar; Freisetzung kindlicher und
jugendlicher Lebensverläufe und Beziehungsmuster
(s. u.a. Maykus 2009; Deinet et al. 2009)Gesellschaftliche Trends mit ihren direkten und
indirekten Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche
• Individualisierung, Pluralisierung, Enttraditionalisierung, und
Standardisierung („Risikogesellschaft“, Beck)
• Bastelbiographie; „Mach Dein Ding“
• Balance von Lebensfreude und Sicherheit hat sich verschoben
(„Erlebnisgesellschaft“, Schulz)
Emanzipation
Wandel des Bildes vom Kind (und Jugendlichen)
• Veränderte Rolle des Kindes: Subjekt
• Kind im Zentrum statt die Institutionen
• Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind
zu erziehen. Kinder brauchen aber auch
ein ganzes Dorf, um gut und gesund
aufwachsen zu können
• Partizipation: „Give children a voice“
• Aktiver Lernprozess: Ko-KonstruktionLebenswelten von Kindern und Jugendlichen
Die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen werden
heute maßgeblich bestimmt durch
Familie,
Schule,
Peers und
Medien.
Sie sind gekennzeichnet durch beständigen Wandel,,
Vielschichtigkeit und Komplexität
Lebenswelt FamilieKennzeichen der Lebenswelt Familie der
Kinder und Jugendlichen
• kleinere Familien
• Pluralisierung der Familienformen
• veränderte Erziehungshaltungen
• Allgegenwärtigkeit von Medien
• große Verfügbarkeit von vorgefertigtem Spielzeug
• vielfältige Freizeitangebote und zunehmende Zeitknappheit
• Verfügbarkeit von (Taschen)Geld
Kinder, Jugendliche und das liebe Geld
• Kinder und Jugendliche (6-19 J.) in Deutschland verfügten
2008 über 23.1 Mrd. € ein (zwei Milliarden oder 9% mehr als
2006). Damit steht der jungen Generation so viel Geld wie
noch nie zur Verfügung (Ausgaben: 22.6 Md. €).
• Kinder und Teens geben ihr Geld vor allem aus für:
• Kleidung (4.4 Mrd.)
• Ausgehen (2.7 Mrd.)
• Handy (2.2 Mrd.)
• Eintrittskarten (1.5 Mrd.)
• Schnellverpflegung (1.2 Mrd.)Familienformen
Form Zitat Mögliche Krise
Gleichgesinnte „Jeder spielt sein Je integrierter die
Instrument und oft Kinder, desto inniger der
spielen alle zusammen“ Zusammenhalt; Krise
möglicherweise in der
Pubertät
Tradierte Ordnung „Es war von Anfang an Eltern mit
klar, dass ich für die entschiedener Meinung,
Kinder da sein sollte“ aber auch Freiraum der
Kinder; Mit dem Alter
wächst die
Störanfälligkeit
Schmelztiegel „Das ist bei uns absolut Kritisch, wenn Kinder
demokratisch, jeder hat auch die Sorgen der
die gleichen Rechte“ (Ein-)Eltern mittragen
müssen
Familienformen
Form Zitat Mögliche Krise
Räderwerk „Von 15:00 bis 15:30 ist Müssen Kinder nur
Entspannung“ mitlaufen, produzieren
sie Betriebstörungen
Zufallsgemeinschaft „Die nehmen sich selbst, Verwahrlosung; Kinder
wenn sie Hunger haben“ suchen Ersazbindungen
Verwaiste „Ich weiß nicht, warum Fühlen sich verlassen,
ich sitzen geblieben bin“ verstehen die Welt nicht
mehr; Leiden an der
BindungslosigkeitErziehung - Wie ist sie zu leisten?
Verunsicherung nicht nur bei den Eltern
Verunsicherung bei Eltern (Erziehungsgutachten des wiss.
Beirats für Familienfragen 2005)
Shell Studie: 50% der befragten Eltern wissen nicht, woran sie
sich in der Erziehung halten sollen (Deutsche Shell, 2000)
Verunsicherung bei Erzieherinnen? Lehrkräften?
Gesellschaft?
Sorgenvoller Blick auf die Welt und die Lebenswelt von
Heranwachsenden ?
Eltern : fürsorglich und verunsichertModernisierung der Schule
Zeit Schule Themen Strategie Lehrkräfte
Beginn Einzelschule Schulautonomie; Ermöglichung: Lehrkräfte als
der Dezentralisierung, Entwicklung treibende
1990er Deregulierung Akteure der
jahre Gestaltung
Zweite Steuerung Autonomie; Anforderung: Akteure:
Hälfte der der „Orchestrierung Schulprogramm, Beteiligte /
1990er Einzelschule der Vielfalt“ Evaluation Betroffene
Jahre
Anfang Steuerung Leistungsfähigkeit Entwicklungs- Transformation
2000 der Einzel- , Effizienz, steuerung: des Berufs-
(u.a. schule im Ökonomie des Bildungsstandar bewußt-seins
TIMSS, Kontext der Schulwesens ds; System- und der Berufs-
PISA) Steuerung monitoring qualifikation
von Schul-
systemen
Selbstverständnis der Schule als Lebenswelt
• Schule für Schüler nicht nur ein Lernort, sondern auch ein
Lebensort (Bildungskommission NRW 1995)
• Schule als Ort des Sozialen; „sozialer Anker“ in der Kommune
• "innere und äußere Öffnung der Schule" gegenüber der
Lebenswelt der Schüler und ihren sozialräumlichen Umwelt-
bedingungen:
• „gemeinwesenorientierte Schule“ (Holtappels)Schule als Lebenswelt
• Schüler nicht allein als "Lernende“ in ihrer Schülerrolle
• Schüler sind immer auch Kinder und Jugendliche mit
vielfältigen Bedürfnissen und Interessen, mit unterschied-
lichen sozialen Bezügen und konfrontiert mit vielschichtigen
Entwicklungsaufgaben und Problemen der
Lebensbewältigung
Schule als Lebenswelt:
Schule ist nicht gleich Bildung und
Bildung ist nicht gleich Schule
• Schulen - besonders wenn sie auf dem Weg von der Halbtags-
zur Ganztagsschule sind - interessieren sich zunehmend für
diese Seite des schulischen Lebens von Kindern und
Jugendlichen
• Sie versuchen durch die Gestaltung von Räumen,
Außengeländen etc. das soziale Miteinander von Kindern und
Jugendlichen zu unterstützen.
• Diese Entwicklungen im Schulsystem eröffnen neue Chancen
einer Annäherung von Jugendhilfe und Schule und lassen eine
Zusammenarbeit sinnvoll und notwendig erscheinen.Wie Schülerinnen und Schüler die Schule erleben:
Belastungen und Ressourcen
• Schulleistung
Transparenz und Gerechtigkeit hinsichtlich der
Leistungsanforderung und der Leistungsrück-
meldung vs. Intransparenz, Ungerechtigkeit,
Leistungsdruck
• Lehrer-Schüler-Verhältnis
Gegenseitige Akzeptanz, Wertschätzung, Offenheit und
Respekt voreinander vs. Nichtbeachtung, Zurückweisung,
Erniedrigung
Wie Schülerinnen und Schüler die Schule erleben:
Belastungen und Ressourcen
• Klassenklima
Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung vs.
Ausgrenzung von Schülerinnen und Schülern oder
Gewalt
• Schulklima
Gerechtigkeit im sozialen Miteinander und
Zugehörigkeitsgefühl zur Schule unter der
Mehrheit der Mitglieder der Schule
vs. Fremdheitsgefühl, Ausgeschlossensein,
UnverbundenheitWie Schülerinnen und Schüler die Schule erleben:
Belastungen und Ressourcen
• Mitbestimmung
Beteiligung an der Ausformulierung und Umsetzung von
Regeln, die das Schulleben bestimmen vs.
Pseudopartizipation
• Räumlichkeiten
Bewegungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, verfügbare
Räumlichkeiten und Sauberkeit vs.
wenig kind- und jugendgerechte
Gestaltung, verwahrloste
Räumlichkeiten
Wie Schülerinnen und Schüler die Schule erleben:
Belastungen und Ressourcen
• Perspektiven, Sinnerfahrungen
Einhergehen schulischer Leistung mit beruflichen
Ausbildungschancen und Lebensperspektiven sowie Bezügen
zum eigenen Leben vs. mangelnde Perspektiverfahrungen,
SinnlosigkeitserlebenLebenswelten der Kinder und Jugendlichen:
Ein Zwischenresümee
• Entwicklungs- und Gestaltungsräume
• Verunsicherungs- und Bedrohungsszenarien
• Dynamik der Anpassung und des Aushandelns
• Herausforderung und Überforderung
• „Der großen Mehrzahl (ca. 75%) der Angehörigen der jungen
Generation geht es in der wohlhabenden Bundesrepublik
Deutschland sehr gut oder gut. Die Lebenssituation der Kinder
und Jugendlichen wird vor allem durch die wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Lage ihres Elternhauses bestimmt.“
(Hurrelmann u.a. 2006; 2007)
Lebenschancen sind unterschiedlich verteilt:
Kinder- und Jugendarmut
• 18% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland leiden unter
relativer Armut, sie haben also weniger als 60% des
Medianeinkommens des Landes zum Leben zu Verfügung.
• Die 19- 25 jährigen sind die Gruppe mit der höchsten
Armutsquote in Deutschland.
• Kinder und Jugendliche sind häufig von Armut betroffen, weil
sie in Haushalten von Alleinerziehenden leben.Lebenschancen sind unterschiedlich verteilt:
Kinder- und Jugendarmut
• Jugendliche in prekärer Beschäftigung, durch die unter
anderem kein Einkommen erzielt wird, das die Armutsgrenze
übertrifft.
• Kinderarmut findet steigende gesellschaftliche Beachtung,
Jugendarmut wird als eigenständiges Problem kaum
wahrgenommen.
• Bei der Jugendarmut handelt es sich um ein Phänomen in einer
Lebensphase von großer Wichtigkeit mit entscheidenden
Umbrüchen.
Nicht jede/r hat auch die gleichen
Gesundheits- und Bildungschancen
• Ungleiche Lebensbedingungen beeinflussen die körperliche,
psychische und soziale Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen.
• Alle verfügbaren Daten zeigen auf, dass soziale Benachteili-
gung und Armut (nicht nur finanzielle) – besonders, wenn sie
Heranwachsende mit Migrationshintergrund betrifft – in
hohem Maße mit gesundheitlichen Belastungen und
Bildungseinbußen verbunden sind.Gesundheitliche Problemlagen bei Kindern aus sozial
benachteiligten Familien (KiGG 2006)
Lebenschancen sind unterschiedlich verteilt:
Kinder- und Jugendarmut
• Aber auch Kinder und Jugendliche aus anderen gesellschaftlichen
Schichten haben ihre Bildungs- und Gesundheitspotenziale nicht
so entfalten können, wie es ihnen unter optimaleren
Bedingungen möglich gewesen wäre (s. internationale Vergleiche
z.B. bei PISA)Beispiel: Psychische Gesundheit in der
Sekundarschule
Eine „durchschnittliche“ Sekundarschule in Deutschland
• 608 Schülern und 35 Lehrkräfte
Schüler
• 133 leiden an einer Essstörung (21,9%; Hölling & Schlack, 2007)
• 137 zeigen psychische Auffälligkeiten (22,5%; Raven-Sieberer et al., 2007)
€ 58 davon haben ernsthafte psychische Probleme in Form
von Angst, Störungen des Sozialverhaltens, Depression,
ADHS (9,6%, ebd.)
• 164 haben psychosomatische Beschwerden (27%; Ravens-Sieberer,
2003)
• 54 sind Opfer von Bullying (9% bez. auf die letzte Woche, Melzer et al., 2008)
• 90 sind einmal oder häufiger Täter von Gewalthandlungen
(14,9%; Schlack & Hölling, 2007)
Beispiel: Psychische Gesundheit in der Schule
Lehrkräfte
• 11 überfordern sich permanent selbst (31%; Schaarschmidt, 2005)
• 10 sind burnout gefährdet (28,5%; Schaarschmidt, 2005)
• 12 haben psychosomatische Beschwerden (34%; Harazd et al., 2009)
• 8 werden aus krankheitsbedingten Gründen frühpensioniert
(23%; Stat. Bundesamt, 2009)
€ 5 davon aus Gründen der psychischen Gesundheit (Weber et
al., 2004)Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen -
International
Ein neuer Ansatz ist notwendig:
Gutes gesundes AufwachsenNoch einmal: Vom Kind aus gedacht
Ökologie der kindlichen Entwicklung
Gutes gesundes Aufwachsen:
Was brauchen Kinder und Jugendliche?
• Befähigungsgerechtigkeit erleben: Capability-Ansatz
• Entwicklung selbst regulieren: Positive Jugendentwicklung
• Lebenszuversicht erfahren: Kohärenzgefühl der Salutogense
• um gute Bildungsabschlüsse zu erreichenKonzepte für ein gutes gesundes Aufwachsen
Das Kohärenzgefühl der Salutogenese
(A. Antonovsky)
• Anforderungen aus der inneren und äußeren Erfahrungswelt
im Verlauf des Lebens sind strukturiert, vorhersagbar und
erklärbar („Gefühl der Verstehbarkeit“ – „Ich blick durch“),
• Ressourcen stehen zur Verfügung, die nötig sind, um den
Anforderungen gerecht zu werden („Gefühl der
Machbarkeit“ – „Ich kann´s packen“)
• diese Anforderungen sind Herausforderungen, die
Investitionen und Engagement verdienen („Gefühl der
Sinnhaftigkeit“ – „Es lohnt sich“)5 C´s der Positiven Jugendentwicklung (R.M. Lerner)
Sechstes C Contribution (Beitrag)Befähigungsgerechtigkeit
• Befähigungsgerechtigkeit bedeutet zweierlei:
• Heranwachsende werden befähigt, selber Entscheidungen zu
fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände
auszuüben und
• Gesellschaft eröffnet ihnen Chancen, Zugang zu den
Ressourcen zu gewinnen, die sie zu einer souveränen
Handlungsbefähigung benötigen.
Gutes gesundes Aufwachsen ermöglichen:
Gesamtgesellschaftliche Aufgabe
• Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nur durch
gemeinsame und aufeinander abgestimmte Anstrengungen
der Sozial-, Familien-, Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Umwelt- und
Gesundheitspolitik und unter Einbeziehung der auf den
verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen relevanten Akteure
einschließlich der Kinder und Jugendlichen selbst, erscheint
ein sozialer Ausgleich der gesellschaftlichen Chancen von
Kindern und Jugendlichen möglich.Kommunale Entwicklung – Chancen für Kinder
(KECK Bertelsmann-Stiftung 2009)
Strategiezyklus von kommunalen
Kooperationsverbünden (KECK 2009)Grundstruktur eines interorganisationalen
kommunalen Netzwerks (KECK 2009)
Funktionale Versäulung in der Kommune
(n. Tibussek 2010, DKJS)Verantwortungsebenen in der Kommune
(n. Tibussek 2010, DKJS)
Wie kann Schule hier wirksam werden?Merkmale positiver Entwicklungskontexte
(Larson et al., 2004)
1. Körperliche und psychische Sicherheit
2. Klare und konsistente Strukturen und angemessene Betreuung
3. Unterstützende Beziehungen
4. Positive soziale Normen
5. Möglichkeiten für Zugehörigkeit und Partizipation
6. Unterstützung für Selbstwertgefühl
7. Optionen für die Erweiterung von Kompetenzen
8. Kooperation von Schule, Familie und Gemeinde
Bedeutung von Schule
• Wenn Schule nicht mehr nur reine Lehr- und Lernanstalt ist,
sondern ein aktives Zentrum im Gesamtzusammenhang der
kindlichen und jugendlichen Lebenswelten
Kind und Jugendliche/r im Zentrum seiner Welt
• Wenn sie eine gute Schule ist, die ihren Bildungs- und
Erziehungsauftrag erfüllt
Ausgleich bildungsbezogener Benachteiligung
• Wenn Sie eine gute gesunde Schule ist
Ausgleich gesundheitlicher Benachteiligung:
Mit Gesundheit gute Schule entwickelnEine Ressource für die Sekundarstufe I
Die ersten Materialien
Freunde
Freunde finden
finden
behalten
behalten undund
SchoolMatters
SchoolMatters –– Mit
Mit dazugehören
dazugehören ––
psychischer
psychischer Förderung
Förderung von von
Gesundheit
Gesundheit gute
gute Resilienz
Resilienz in in der
der
Schule
Schule machen
machen Schule
Schule
(5.
(5. -- 6-
6- Klasse)
Klasse)
Mit
Mit Stress
Stress umgehen
umgehen –– Mobbing?
Mobbing? Nicht
Nicht in
in
im
im Gleichgewicht
Gleichgewicht unserer
unserer Schule
Schule ––
bleiben
bleiben –– Förderung
Förderung Prävention
Prävention undund
von
von Resilienz
Resilienz in
in der
der Handlungsstrategien
Handlungsstrategien
Schule
Schule
(5.
(5. -- 8.
8. Klasse)
Klasse)
(7.
(7. -- 10.
10. Klasse)
Klasse)Die neuen Materialien
Umgang
Umgang mit mit Verlust
Verlust
Die
Die Schule
Schule €ffnen
€ffnen und
und und
und Trauer
Trauer in
in der
der
vom
vom Umfeld
Umfeld Schule
Schule
profitieren
profitieren
(5.
(5. ‚‚ 10.
10. Klasse)
Klasse)
Leitfaden
Leitfaden zur
zur Psychische
Psychische
Pr•vention
Pr•vention von
von St€rungen
St€rungen in in der
der
Selbstverletzungen
Selbstverletzungen Schule
Schule verstehen
verstehen
und
und Suizid
Suizid in
in der
der lernen
lernen (7.
(7. ‚‚ 10.
10.
Schule
Schule Klasse)
Klasse)
Qualitätsrahmen der Schule
Voraussetzungen Prozess Schule Prozess Unterricht Ergebnisse/ Wirkungen
1. Rahmen- 2. Schulkultur 6. Lehren und 7. Erfolge der Schule
bedingungen Lernen
kurzfristig langfristig
1.1. Bedingungen:
Bildungs- Weiterer
(Schuleigenes
(Strukturell, 3. Schulführung + ziele Bildungs-
Curriculum;
finanziell, (Fach-, Sozial-, weg
materiell,
-management Unterrichts-
Methoden-
klima;Unterrichts-
personell, sozial) kompetenz,
gestaltung;
ƒ„
Persönlich-
ƒ„ Leistungsan-
ƒ„ forderungen; ƒ„ keitsbildung,
Individuelle Schul-
Förderung) abschlüsse)
1.2. Intentionen: 4. Kooperation +
Außenbeziehungen
(Bildungsziele, Schulzu- Zufrieden-
Lehrpläne, nationale
friedenheit heit
Bildungsstandards,
gesellschaftliche.
Erwartungen, 5. Personal
Einstellungen, - entwicklung
Haltungen)
ƒ„
ƒ„
ƒ„
8. Evaluation/ Qualitätsmanagement
Modell nach DITTON (2003)Resümee
• Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen unterliegen
großen Veränderungen
• Lebenswelten bieten Entwicklungschancen aber auch
Einschränkungen / Bedrohungen
• Chancen sind ungleich verteilt
• Insgesamt sind die Potenziale der Kinder und Jugendlichen
nicht ausgeschöpft; Kinder und Jugendliche sind beansprucht
• Ein neuer Weg muss beschritten werden: gutes gesundes
Aufwachsen
• Gute gesunde Schule – Beitrag der Schule
• MindMatters – mit psychischer Gesundheit gute Schule
entwickeln
Mit Achtsamkeit gute Schule entwickelnVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
paulus@leuphana.deSie können auch lesen