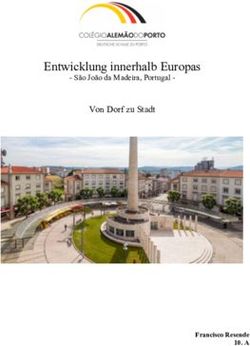Neue Wege im Hamburger Umweltinformationssystem (HUIS) auf Basis von OpenGIS-Standards
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Neue Wege im Hamburger Umweltinformationssystem
(HUIS) auf Basis von OpenGIS-Standards
Markus U. MÜLLER, Birgit AUGSTEIN, Mathias BOCK,
Reiner GLOWINSKI und Andreas POTH
Dieser Beitrag wurde nach Begutachtung durch das Programmkomitee als „reviewed paper“
angenommen.
Zusammenfassung
Das Hamburger Umweltinformationssystem (HUIS) der Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt (BSU) der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH), das bisher aus weitgehend
isoliert existierenden Teilkomponenten bestand, wurde in den letzten beiden Jahren um eine
dienstebasierte Kommunikationskomponente erweitert. Im Mittelpunkt der neuen Kompo-
nente, die den Namen UmweltInfo.online trägt, stehen georeferenzierte Daten. Web Ser-
vices und OpenGIS-Standards stellen die technologischen Rahmenbedingungen dieser
Neuentwicklung dar. Auf Basis von verteilten OGC1 Web Services wurden bereits vor-
handene Komponenten wie der Hamburger Metadatenkatalog (HMDK) in eine Gesamtar-
chitektur integriert und zusätzliche, integrative Funktionalitäten zur Verfügung gestellt. Die
Integration des Systems in eine übergreifende Geodateninfrastruktur ist ein weiteres Vorha-
ben.
1 Motivation
1.1 Entstehung des HUIS
Das HUIS stellt Informationen über Zustand, Veränderungen und Gefährdungen der Um-
welt zur Verfügung. Zugriff haben sowohl Beschäftigte der Hamburger Behörden als auch
in Zukunft Bürger und Gewerbetreibende.
Die Entwicklung des HUIS begann Mitte der 90er-Jahre (PAGE, HÄUSLEIN, & GREVE
1993). Kennzeichnend für die erste Phase war der schrittweise Aufbau von Teilkomponen-
ten, die jedoch nur indirekt untereinander kommunikationsfähig waren. Darüber hinaus
waren in der Konzeption des Projektes während der laufenden Umsetzung aktuelle Ent-
wicklungen in der Informationstechnik wie Serviceorientierung miteinzubeziehen (BOCK &
GLOWINSKI 2001).
Ausgangspunkt der Neuausrichtung des HUIS war ein Workshop im Jahr 2001, der mehrere
Anforderungen an die Weiterentwicklung des HUIS definierte. Insbesondere sollte die Me-
1
Open GIS Consortium, siehe http://www.opengis.org.Neue Wege im Hamburger Umweltinformationssystem (HUIS) 475 tadatenverarbeitung stärker integriert werden, um den bis dahin weitgehend isoliert betrie- benen HMDK für HUIS nutzen zu können. Hierzu war ein möglichst modulares und erwei- terbares Systemkonzept unter Berücksichtigung der Konzepte und Spezifikationen des OGC zu entwickeln. Als weitere wichtige Rahmenbedingung für UmweltInfo.online wurde die Nutzung von Web Services definiert. Für die Einführung von Web Services sprechen mehrere Gründe. Im Intranet der Freien und Hansestadt Hamburg (FHHIntranet) sind Web Services als die zukünftige Standard- Kommunikationstechnologie festgelegt worden. Zusätzlich soll diese Technologie im Zuge der hamburgischen E-Government-Initiative (BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSE- STADT HAMBURG 2002) die Voraussetzungen für einen Zugriff über das Internet schaffen. Durch den Einsatz von OpenGIS-Standards soll der Vorteil genutzt werden, von Lösungen einzelner Hersteller weitgehend unabhängige Anwendungen und Komponenten entwickeln zu können. Die Komponenten eines derartig aufgebauten Systems sollen austauschbar und durch Produkte anderer Hersteller ersetzt bzw. ergänzt werden können, die ebenfalls diese Standards unterstützen. Ziel ist es, die Investitionssicherheit im Rahmen des Projektes und während der zukünftigen Betriebsphase deutlich zu erhöhen. Obwohl sich der Einsatz von OpenGIS-Standards in den letzten Jahren stark verbreitet hat, ist zumindest im deutsch- sprachigen Raum kein System bekannt, das konsequent auf einer standardisierten und kom- ponentenbasierte Architektur aufsetzt. 1.2 Neukonzeption auf Basis von OGC Web Services Die bislang klassischerweise vorgenommene Unterteilung des HUIS in die Teilkomponen- ten Umweltberichtssystem, Metainformationssystem, Hintergrundinformationssysteme, Fachinformationssysteme und Kommunikationskomponente wird ersetzt durch ein Netz von Diensten, das auf die verschiedenen Teilkomponenten aufsetzt und für unterschiedliche Nutzergruppen angepasste Sichten auf Informationsbestände bereitstellt (Abb. 1). Vor allem im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Nutzern im Intra- und Internet ist eine an deren Bedürfnisse angepasste Steuerung von Datensichten wichtig. Nutzer, deren Zugriff über das Internet erfolgt, benötigen meist eine stärker aufbereitete, an vorgegebene Frage- stellungen orientierte Sicht auf Informationen im Vergleich zu Fachnutzern aus dem Intra- net. Insbesondere die für eine Unterstützung durchgängiger Arbeitsprozesse notwendigen Informationen und Services müssen dem Nutzer in einfacher und verständlicher Form, aber auch mit einem hohen Grad an Verfügbarkeit bereitgestellt werden, um den Ansprüchen eines bürgernahen E-Governments zu entsprechen.
476 M. U. Müller, B. Augstein, M. Bock, R. Glowinski und A. Poth
Abb. 1: Dienstearchitektur des Hamburger Umweltinformationssystems
2 Integrations- und Kommunikationskomponente
UmweltInfo.online
Konzeptionell besteht UmweltInfo.online aus einem System verteilter Dienste, die beliebig
erweiterbar sind. Im Zentrum von UmweltInfo.online steht ein Katalogdienst für Geodaten
und ^-dienste, der auf dem UDK2-Metadatenmodell aufbaut. Der Zugriff auf die verschie-
denen Dienste erfolgt unter Kontrolle eines detaillierten Rechteverwaltungssystems, das in
die vorhandenen Strukturen zur Rechte- und Gruppenverwaltung integriert ist.
2
Umweltdatenkatalog; siehe http://www.udk-gein.de.Neue Wege im Hamburger Umweltinformationssystem (HUIS) 477
Abb. 2: Architektur von UmweltInfo.online
Der gesamte Funktionsumfang von UmweltInfo.online umfasst die folgenden (standardi-
sierten) Komponenten (siehe Abb. 2):
• Einen oder mehrere Web Map Services (WMS, DE LA BEAUJARDIERE 2002) im Intranet
(diese stellen Kartenansichten von zentral vorgehaltenen Geobasisdaten und Fachdaten
aus verschiedenen Abteilungen zur Verfügung).
• Einen oder mehrere Web Feature Services (WFS, VRETANOS 2002a) zur Abgabe von
Vektor-Geodaten und GIS-Analysefunktionen, die über reine Map Services hinausge-
hen.
• Einen Web-basierten Catalog Service (CS-W, OGC 2002, REICH 2001) im Intranet, der
im Rahmen einer möglichen Anbindung an GeoMis.Bund oder andere Geodatenportale
(FITZKE, GREVE & MÜLLER 2002) auch im Internet sichtbar gemacht werden soll (ein
Catalog Service erlaubt die Recherche in Metadatenbeständen, im Falle von UmweltIn-
fo.online ist dies der HMDK).
• Einen Styled Layer Descriptor-WMS, (SLD-WMS, LALONDE 2002) der die WMS-
Layer vorhandener Server zusammenführt und durch WFS zur Verfügung gestellte
Daten visualisiert.
• Einen Catalog Client, der neben einer Rechercheoberfläche Clients für die Dienste von
UmweltInfo.online wie WMS, WFS und WFS-G integriert und eine einheitliche Benut-
zerschnittstelle im Intranet zur Verfügung stellt.478 M. U. Müller, B. Augstein, M. Bock, R. Glowinski und A. Poth
• Einen hochgradig konfigurierbaren Map Client, der in verschiedenen Ausprägungen
bzw. Konfigurationen Fachschalen implementiert.
• Einen Administration Client zur Service- und Benutzerverwaltung.
• Einen Map Application Service, der die Anfragen aus dem Intranet und dem Internet
entgegennimmt, diese an die registrierten Services weiterleitet und zur Erzeugung von
GUI3-Elementen die Ergebnisse wieder aufnimmt. Diese Komponente fungiert als Web
Map Service Client.
• Einen Gazetteer Service (WFS-G, ATKINSON & FITZKE 2002) zur Abbildung indirekter
auf direkte Georeferenzen.
2.1 Integration vorhandener Komponenten
Die bereits vorhandenen Komponenten des HUIS wurden in das neue System integriert.
Diese Forderung bezog sich insbesondere auf den HMDK, die vorhandenen Web-Map-
Dienste auf der Basis von ArcIMS (ESRI), die bestehende zentrale Geodatenbank auf der
Basis von ArcSDE (ESRI) und eine Oracle Datenbank, in der mit der Spatial-Erweiterung
ebenfalls zentral Geodaten vorgehalten werden.
Im Folgenden wird der Einsatz dieser Komponenten näher spezifiziert.
2.1.1 Hamburger Metadatenkatalog
Zur Recherche der Metainformationen wird innerhalb der gesamten Hamburger Verwaltung
der HMDK4 eingesetzt, welcher auf dem HTML-WWW-Client und der Serverkomponente
des Programmsystems UDK basiert. Es existiert eine zentrale Metadatenbank, die vom
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung verwaltet wird.
Der in der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt erfasste Teil dieses Datenbestandes
dient als Grundlage des UmweltInfo.online-Katalogdienstes. Zusätzliche Metadaten, die vor
allem zur Verwaltung von Diensten benötigt werden, werden separat gespeichert und mit
den HMDK-Metadaten verknüpft. Zur Eingabe von Daten-beschreibenden Metadaten soll
zunächst weiterhin der PC-basierte Windows-Client des Programmsystems UDK genutzt
werden. Dienste-beschreibende Metadaten werden weitgehend automatisiert über einen
Harvesting-Mechanismus aus den GetCapabilities-Dokumenten der Web Services ausgele-
sen.
2.1.2 Web Map Services
Das Produkt Arc Internet Map Server (ArcIMS) der Firma ESRI wird bereits seit längerem
eingesetzt, um Map Services innerhalb der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt zu
veröffentlichen. Als Datenquellen dienen hierbei Geobasisdaten des Geschäftsbereiches
Vermessung und Geofachdaten des Geschäftsbereiches Umwelt, die als ArcSDE Layer oder
3
Graphical User Interface.
4
Da der HMDK direkt auf der UDK-Software und insbesondere dem UDK-Datenmodell aufbaut,
wird im Weiteren terminologisch keine Unterscheidung zwischen HDMK und UDK mehr getrof-
fen. Mit UDK-Metadaten sind somit Metadaten im UDK-Schema gemeint, auch wenn diese inner-
halb des HMDK verwendet werden.Neue Wege im Hamburger Umweltinformationssystem (HUIS) 479 Shapefiles vorgehalten werden. Mittels des integrierten WMS-Connectors ist ArcIMS in der Lage, WMS-Requests entgegenzunehmen und zu beantworten. Diese WMS-Dienste wurden in den UmweltInfo.online-Katalogdienst integriert. 2.1.3 Zentrale Geodatenbank Die Arc Spatial Database Engine (ArcSDE) in Verbindung mit Oracle als Datenbank- Plattform wird seit einigen Jahren im Geschäftsbereich Umwelt eingesetzt, um Geodaten zur Verfügung zu stellen. Der Zugriff auf die ArcSDE Layer erfolgt über ArcView (ESRI) oder über einen mit ArcIMS erstellten Map Service. Der deegree Web Feature Service von UmweltInfo.online benutzt die ArcSDE-Datenbank ebenfalls direkt als Datenquelle. Ergänzend wird die Oracle-Datenbank für die Verwaltung von zusätzlichen Metadaten, beispielsweise für Dienstebeschreibungen, raumbezogene Metadaten (Bounding Bo- xes/Umgebende Polygone) oder für Informationen zur Zugriffsrechteverwaltung genutzt. 3 Umsetzung auf Basis von deegree deegree ist ein Open Source-GIS-Projekt (FITZKE et al. 2004), das von der Universität Bonn und der Firma lat/lon ins Leben gerufen wurde. Inzwischen hat das Projekt eine Reihe von deutschen und weltweiten Entwicklern angezogen, sodass man von einer internationalen Entwicklergemeinde sprechen kann. deegree ist zuallererst ein Framework zur Entwicklung OGC-standardisierter Programme und Dienste. Der Web Map Service von deegree ist die Referenzimplementierung des OGC (MÜLLER & POTH 2003). In Zukunft wird deegree zu- dem die Referenzimplementierung für WCS 1.0.0 und CS-W 2.0 stellen. deegree umfasst mittlerweile die Implementierungen einer großen Zahl an OGC Web Servi- ces (OWS), insbesondere WMS, WFS, WCS, CS-W und WFS-G, die für das Projekt Um- weltInfo.online Verwendung finden. Darüber hinaus ist es möglich, auf Basis von deegree Clients für die genannten Dienste zu entwickeln, sowohl für einzelne Services, wie z.B. einen WMS-Client, als auch solche, die auf eine Reihe von OWS zugreifen. Man spricht hierbei von Integrated Clients. Im Rahmen von UmweltInfo.online wurden nur Clients entwickelt, die über webbasierte Benutzerschnittstellen ansprechbar sind und mittels Servlet und JSP-Technologie entwickelt wurden. Es ist aber genauso möglich Java-Applikationen mit deegree zu entwickeln, die als Clients agieren. 3.1 Suche auf Basis von Metadaten Der Catalog Client von UmweltInfo.online ist der zentrale Einstiegspunkt in das System. Er erlaubt primär die Recherche in den Metadaten des HMDK, um geeignete Datensätze zu identifizieren. Sind die Daten über einen OWS direkt verfügbar, agiert der Catalog Client auch als Client für die Services WMS oder WFS. Da Nutzer eines solchen Systems auf Basis von räumlichen Recherchekriterien suchen und normalerweise hierfür nicht direkt Koordinaten eingeben wollen, wird ein Gazetteer-Service eingesetzt. Dieser Gazetteer- Service erlaubt es, auf Basis räumlicher Bezeichner („Billstraße“ oder „Rothenburgsort“) nach Daten zu suchen. Der Catalog Client ist in dieser Hinsicht, da der Zugriff auf eine Reihe verschiedener OWS erfolgt, als Integrated Client zu betrachten.
480 M. U. Müller, B. Augstein, M. Bock, R. Glowinski und A. Poth Die Einstiegsseite des Catalog Client ist in Abbildung 3 dargestellt. Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass es möglich ist, auf „Google-ähnliche“ Weise zu suchen, für versiertere Nutzer aber auch die Möglichkeit besteht, ihre Suchparameter auf Basis fachlicher, zeitli- cher und räumlicher Parameter genauer einzuschränken. Abb. 3: Einstiegsseite von UmweltInfo.online Für Nutzer, die Administratorenrechte besitzen, erscheinen in der linken Menüleiste weitere Menüpunkte, die zur Verwaltung des Systems dienen. 3.2 Fachapplikationen Im Rahmen der Realisierung von UmweltInfo.online wird neben dem Catalog Client auch eine web-basierte Fachapplikation auf Basis von deegree realisiert. Ziel ist es, fachbezogene Anforderungen an GUI, (Karten-)Darstellung und Funktionalität zentral allen interessierten und berechtigten Personen zur Verfügung zu stellen. Insbesondere dort, wo es vor allem auf die Visualisierung von Geodaten unter Berücksichtigung spezieller Aspekte eines Fachver- fahrens ankommt, erlaubt ein zentraler, web-gestützter Ansatz die Aufwände für Verwal- tung, Koordination und Administration deutlich zu reduzieren. Da keine weitere Software auf den Clients benötigt wird als ein Internet-Browser, steht die gesamte Funktionalität einer breiten Basis von Nutzern ohne Kauf, Installation und Einrichtung eines konventio- nellen GIS zur Verfügung. Über eine serverseitige, auf dem OGC Web Map Context Standard (HUMBLET 2003) basie- rende Konfiguration wird festgelegt, welche Komponenten und Funktionen in der Fachan- wendung vorhanden sein sollen. Zusätzliche Implementierungsarbeiten zur Realisierung einer Fachanwendung sind i.d.R. nicht notwendig. Die Konfiguration enthält die Ebenen,
Neue Wege im Hamburger Umweltinformationssystem (HUIS) 481 die dargestellt werden sollen bzw. deren Zugriffsinformationen über WMS als auch weitere Informationen, die den GUI-Aufbau der Fachapplikation betreffen. Der Web Map Context Standard wurde entwickelt, um den „Zustand“ eines WMS-Client in einem XML-Dokument zu beschreiben und dieses Dokument dann mit anderen WMS- Clients austauschen zu können. Dies stellt einen ersten Schritt hinsichtlich Interoperabilität zwischen Client-Software dar. Web Map Context-Dokumente erlauben es, zusätzliche Ele- mente zu definieren, die nicht standardisiert und somit nicht interoperabel sind. Dieser Me- chanismus wurde genutzt, um spezifische Informationen zu GUI-Konfiguration im selben Dokument unterzubringen. Abb. 4: Benutzerschnittstelle der Fachschalen-Applikation. Thema: Grünplan. Für UmweltInfo.online wurden zunächst Fachapplikationen für die Themen „Grünplan“ und „Bodendaten“ realisiert. Die Darstellung der beiden Fachapplikationen kann mit mehreren Hintergrundkarten kombiniert werden. Über verschiedene Dialogelemente (z.B. konfigu- rierbarer Gazetteer) kann der Benutzer Objekte in der Karte auffinden und auswählen. Für ausgewählte Objekte können Detailinformationen angefordert werden. Der aktuelle Karten- ausschnitt steht als Druckvorlage mit einer höheren Auflösung oder in einem Vektorgrafik- format (SVG) zur Verfügung. Ferner besteht die Möglichkeit ausgewählte Objekte oder den aktuellen Kartenausschnitt als ESRI ShapeFile inklusive *.avl (Legenden-)Datei zur lokalen Weiterverarbeitung herunterzuladen.
482 M. U. Müller, B. Augstein, M. Bock, R. Glowinski und A. Poth 4 Diskussion Problematisch erschien zu Beginn des Projektes die Aufgabe der Integration in die vorhan- dene IT-Infrastruktur der Freien und Hansestadt Hamburg, so zum Beispiel die Benutzung des Active Directory Service (ADS) und eine darauf aufbauende Single-Sign-On-Lösung oder die Integration des HMDK, der bislang noch keine standardkonformen Schnittstellen besitzt. Durch die iterative Vorgehensweise bei der Entwicklung des System konnten die Probleme frühzeitig identifiziert und untersucht werden. Der Einsatz offener Schnittstellen und freier Software erwies sich als erfolgreich bei der Lösung dieser Probleme. Die Konzeption einer Infrastruktur, wie sie in diesem Beitrag beschrieben wird, ist vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Betrachtungen nur in Kooperation mit allen relevanten Res- sorts auf der Grundlage allgemein anerkannter Standards und einer modernen, komponen- tenorientierten Architektur sinnvoll und möglich. Der OGC-Ansatz erfüllt diese Anforde- rungen in wesentlichen Punkten. Bereits in der Vorphase des Projektes war es daher ein wesentliches Ziel, die zu entwickelnden Teilkomponenten des HUIS in die Geodateninfra- struktur der Freien und Hansestadt Hamburg zu integrieren. Die wachsende Kooperations- bereitschaft bei der Entwicklung gemeinsamer E-Government-Lösungen (siehe Deutsch- land.online) lassen es sogar denkbar erscheinen, die Ergebnisse des HUIS in Form von frei verfügbaren Web-Services für die bundeseinheitliche Lösung einer Geodateninfrastruktur nutzbar zu machen. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich sagen, dass der komponenten- basierten OGC-Ansatz aufgrrund der leichten Erweiterbarkeit des Systems gegenüber einer „monolithischen“ Lösungen ein bedeutend höheres Maß an Investitionssicherheit bietet. Literatur ATKINSON, R. & J. FITZKE (2002): Gazetteer service profile of the Web Feature Service Im- plementation Specification. OpenGIS Project Document 02-076r3. http://www.opengis.org/specs/?page=discussion BOCK, M. & R. GLOWINSKI (2001): Geoservices der Umweltbehörde Hamburg. In: Gegen- wart und Zukunft des GIS-Einsatzes im Umweltbereich – Dokumentation des Work- shops des Bund/Länder-Arbeitskreises Umweltinformationssysteme am 22.03.2001 in Stuttgart, 104-119 BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG (2002): Drucksache 17/1091 „E- Government – Chancen für Hamburg nutzen“, Hamburg. http://www.buergerschaft-hh.de/parldok/ DE LA BEAUJARDIÈRE, JEFF (Hrsg.) (2002): OpenGIS® Web Map Server Interface Imple- mentation Specification Revision 1.1.1. OpenGIS Project Document 01-068r3 http://www.opengis.org/specs/?page=specs FITZKE, J., GREVE, K. & M. MÜLLER (2002): Aufbau nationaler Geodatenkataloge am Beispiel Deutschland und Luxemburg. In: STROBL, J. et al. (Hrsg.): Angewandte Geo- graphische Informationsverarbeitung XIV, 96-104. Wichmann Verlag, Heidelberg FITZKE, J., GREVE, K., MÜLLER, M & A. POTH (2004): Building SDIs with Free Software – the deegree project. In: Proceedings of the 7th International Conference of Global Spati- al Data Infrastructure (GSDI-7), February, 2-6, Bangalore, India
Neue Wege im Hamburger Umweltinformationssystem (HUIS) 483 HUMBLET, J. P. (Hrsg.) (2003): Web Map Context Documents. OpenGIS Project Document 03-036r2. http://www.opengis.org/specs/?page=specs LALONDE, W. (Hrsg.) (2002): Styled Layer Descriptor Implementation Specification. OpenGIS Project Document 02-070. http://www.opengis.org/specs/?page=specs MÜLLER, M. & A. POTH (2003): OpenGIS meets OpenSource: Referenzimplementierung für OGC Web Services wird Freie Software. In: STROBL, J. et al. (Hrsg.): Angewandte Geographische Informationsverarbeitung XV, 298-307. Wichmann Verlag, Heidelberg OPEN GIS CONSORTIUM (Hrsg.) (1999): OpenGIS® Catalog Interface Implementation Specification Version 1.1.1 OpenGIS Project Document 02-087r3s. http://www.opengis.org/specs/?page=specs PAGE, B., HÄUSLEIN, A. & K. GREVE (1993): Das Hamburger Umweltinformationssystem HUIS – Aufgabenstellung und Konzeption – [Hrsg.] Freie und Hansestadt Hamburg, Umweltbehörde, Projektgruppe HUIS, Hamburg REICH, L. (Hrsg.) (2001): OpenGIS® Web Services Stateless Catalog Profile. Version 0.06. OpenGIS Project Document 01-062 (nicht öffentlich verfügbar) VRETANOS, P. (Hrsg.) (2002a): OpenGIS® Web Feature Service Implementation Specifica- tion Version 1.0.0. OpenGIS Project Document 02-058 http://www.opengis.org/specs/?page=specs VRETANOS, P. (Hrsg.) (2002b): OpenGIS® Filter Encoding Specification Version 1.0.0. OpenGIS Project Document 02-059 http://www.opengis.org/specs/?page=specs
Sie können auch lesen