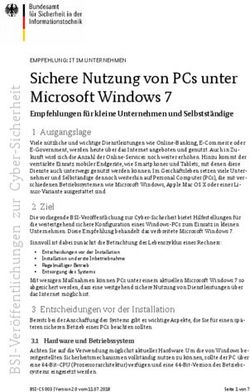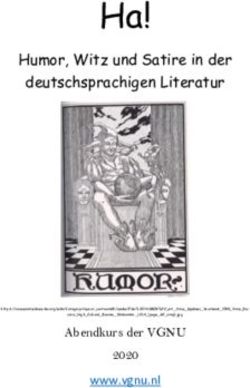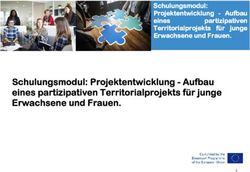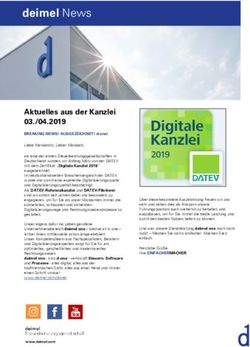PRESS REVIEW Thursday, August 27, 2020 - Daniel Barenboim Stiftung Barenboim-Said Akademie & Pierre Boulez Saal
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
PRESS REVIEW
Daniel Barenboim Stiftung
Barenboim-Said Akademie & Pierre Boulez Saal
Thursday, August 27, 2020PRESS REVIEW Thursday, August 27, 2020
Deutsche Presseagentur u.A., 26.08.2020, PBS, BSA
Theater und Konzerthäuser: Jeder zweite Platz könnte besetzt werden 3
MDR (Radio/Online), 26.08.2020, PBS, BSA
Schachbrettsitzordnung im Konzertsaal 6
Der Tagesspiegel (Print), 27.08.2020
Die Stille vor dem Glück. Start der Konzertsaison unter Pandemie-Bedingungen 7
Berliner Zeitung (Print), 27.08.2020
Die pure Virtuosität. Igor Levit eröffnet das Musikfest Berlin 9
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Print), 27.08.2020
Ein Fest: Alessandro Melanis Oper „L’empio punito“ bei den Innsbrucker Festwochen 10
The New York Times (Online), 26.08.2020
The New York Philharmonic restarts the music with a pickup truck 12
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Print), 27.07.2020
Beethoven Kolumne. Ein verletzlicher Mensch mit einem festen Platz in Kronberg 14ung Schachbrettsitzordnung im Konzertsaal Berliner Boulez-Saal plant ab 1. September mit Publikum MDR AKTUELL Mi, 26.08.2020 , 17:57 Uhr 01:40 min Zum Audio: Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/470511/18-19 1 von 2 27.08.2020, 12:22
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/470511/18-19 2 von 2 27.08.2020, 12:22
Artikel auf Seite 16 der Zeitung Berliner Zeitung vom Fr, 28.08.2020 https://epaper.berliner-zeitung.de/
Die pure Virtuosität
Igor Levit eröffnete in der Philharmonie eine Reihe von acht Konzerten, in denen er sämtliche Klaviersonaten Beethovens spielt
Der Pianist Igor Levit kürzlich bei einem Hauskonzert im Schloss Bellevuedpa/Jesco Denzel
CLEMENS HAUSTEIN
nd, als es zur Eröffnung des Musikfestes endlich wieder so weit war, wirkte der Konzertsaalbau jedenfalls heiter und erfrischt. Als hätte sich ein wenig immaterielle Patina gelöst, die
Abertausende von Veranstaltungen hinterlassen haben müssen. Aber das hat wohl nur mit dem Blick des Betrachters zu tun, der lange nicht mehr hier war. Und mit der Tatsache, dass die
architektonische Klarheit nun noch klarer erscheint, weil im Foyer die Menschentrauben fehlen am Büfett und an den Garderoben. Alles geschlossen. Das Saalpersonal mit Mundschutz
weist diskret zum Platz, als gehe es um ein konspiratives Treffen.
Igor Levit, dem die Ehre des ersten Konzertes zuteil wurde, hat die vergangenen Monate derweil nicht allzu erholsam gestaltet. Zeitweise trat er täglich in Online-Konzerten auf, gestreamt
aus seiner Wohnung; bevor er beim Musikfest nun in acht Konzerten sämtliche Beethoven-Klaviersonaten spielt, hat er das Gleiche schon bei den Festivals in Salzburg und Luzern getan.
Levit verfügt damit über eine gefestigte Corona-Routine, die ihn doch nicht dazu bewegen kann, auf die veränderte Akustik des Saals zu reagieren. Wegen der Abstandsregeln nur ein
Viertel der Plätze belegt: Das ergibt einen deutlich halligeren Klang, in dem manches untergeht, was Levit in rasendem Tempo präsentiert.
Den Schlusssatz der As-Dur-Sonate op. 26 etwa, der hier wie die Etüde eines impressionistischen Komponisten zerstäubt. Oder der vierte Satz von Beethovens erster Sonate op. 2 Nr. 1, den
Levit als einen apokalyptischen Sturmwind inszeniert. Levit will uns mit aller Kraft das Staunen über Beethoven zurückgeben, was sich als schwierige Aufgabe ausnimmt in einer Welt, die
eigentlich über gar nichts mehr staunt. Von der Dringlichkeit seines Anliegens getrieben, schießt der Pianist ein ums andere Mal über das Ziel hinaus: auch im Kopfsatz der
„Waldstein“-Sonate, sein erklärtes Lieblingsstück, die er bis zur comicartigen Verzerrung beschleunigt (über technische Hürden braucht man nicht zu sprechen, Levit scheint sie kaum zu
kennen).
Übrig bleibt die pure Virtuosität: Dass das die Absicht des Pianisten war, kann man nicht glauben. Zum Glück gehören wohlgestaltete langsame Sätze ebenfalls zu Levits Beethoven-
Inszenierung. Formgefühl zeigt er hier ebenso wie enorme Kultiviertheit: die klare Umrissenheit seines Anschlags, die Ausgewogenheit des Stimmensatzes, die rhythmische Sicherheit, die
im Fall des Adagio der ersten Sonate ein weiches, gleichmäßiges Fließen ermöglicht. Dass Levit Beethoven nicht nur spielt, sondern mit ihm spielt, zuweilen wie die Katze mit der Maus –
hier kann man es vergessen.
1 von 1 27.08.2020, 12:36Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465381/11
F.A.Z. - Feuilleton Donnerstag, 27.08.2020
Rauschgoldengel als irdische Bengel
Ein Fest: Alessandro Melanis Oper „L’empio punito“/Von Werner M.
Grimmel, Innsbruck
Seit die Figur des mythischen Frauenhelden und Draufgängers Don Juan zu Beginn des
siebzehnten Jahrhunderts die Theaterwelt aufgemischt hat, geistert sie durch die euro-
päische Literatur- und Musikgeschichte. Die erste Dramatisierung des Stoffs wird dem
spanischen Mönch und Autor Tirso de Molina zugeschrieben. Fortan hat die Geschichte
vom skrupellosen Verführer und Betrüger, der schließlich vom „steinernen Gast“ zur
Strecke gebracht wird, immer wieder zu neuen künstlerischen Bearbeitungen gereizt.
Auf die Opernbühne kam sie erstmals 1669 in Rom. „L’empio punito“ („Der bestrafte
Frevler“) heißt das Dramma per musica von Alessandro Melani (1639 bis 1703), das den
gewaltbereiten Wüstling unter dem Namen Acrimante am Hof eines antiken Phantasie-
Mazedoniens sein Unwesen treiben lässt.
Bei den Innsbrucker Festwochen Alter Musik wurde nun diese 1986 wiederentdeckte,
2003 von Christophe Rousset beim Leipziger Bachfest vorgestellte Vertonung des
Sujets von einer hochkarätigen Nachwuchstruppe präsentiert. Wegen der Corona-
Pandemie hatte man die Produktion der Reihe „Barockoper: Jung“, die traditionell an
der Universität im Innenhof der Theologischen Fakultät gezeigt wird, ins neue Haus der
Musik verlegt. Das Libretto von Filippo Acciaiuoli und Giovanni Filippo Appoloni
wartet mit raffinierter Szenenfolge, spitzer Ironie und derben erotischen Anspielungen
auf. Wie in der venezianischen Operntradition jener Zeit gibt es neben den Hauptfigu-
ren viele kleinere Rollen. Fast alle in späteren Fassungen des Stoffs variierten Zutaten,
die sich lange auch im Repertoire improvisierender Theatergruppen gehalten haben,
sind hier als Topoi schon vorhanden. Die turbulent verwickelte Handlung wird in Rezi-
tativen und zahlreichen Kurzarien mit poetischen Texten unterhaltsam erzählt. Einige
Duette und reizende instrumentale Zwischenmusiken sorgen für zusätzliche Abwechs-
lung.
Die genial auf einfachste Mittel setzende Innsbrucker Inszenierung von Silvia Paoli lebt
vom Charme des Provisorischen. Auf Andrea Bellis Bühne erscheinen zur tänzerischen
Einleitungsmusik hoch über drei grauen Wänden vier Amoretten mit blondem Locken-
schopf, Flügelchen, kurzen Lederhosen und roten Turnschuhen. Auch die anderen
Kostüme von Valeria Donata Bettella kombinieren barocke Optik mit Anleihen bei Tiro-
ler Trachten. Die Rauschgoldengel erweisen sich bald als verkappte Stallknechte, die bei
Melani sarkastisch verfremdend das Geschehen kommentieren. Hier lenken sie an
roten Schnüren von oben als himmlische Puppenspieler die ins Rennen geschickten
Protagonisten, kollidieren dabei miteinander oder baldowern aus, welche Marionette
jeweils auf die Bühne muss. Gelegentlich mischen sie sich als ziemlich irdische Bengel
unter ihre Figuren und bringen deren ohnehin chaotische Liebeshändel durcheinander.
Mariangiola Martello dirigiert Melanis vokal stets kantable, farbig instrumentierte
Musik umsichtig vom Cembalo aus. Das kleine „Barockorchester: Jung“ mit zwei Violi-
nen, Viola da gamba, Cello, Violone, zwei Blockflöten, Fagott und zusätzlichem Cemba-
lo bezaubert mit sattem Sound und betörenden Soloeinlagen. Großartig meistert die
schwedische Mezzosopranistin Anna Hybiner den einst für einen Soprankastraten
komponierten Part des notorischen Schürzenjägers Acrimante. Wie sie haben auch die
anderen Mitglieder des jungen Gesangsensembles im vergangenen Sommer erfolgreich
am Innsbrucker Cesti-Wettbewerb teilgenommen. Dioklea Hoxha führt als Ipomene
(die Donna Anna der Melani-Version) ihre leuchtende Sopranstimme souverän durch
die Register. In gewichtiger Mezzo-Lage verkündet Natalia Kukhar als deren Gatte
Cloridoro und Jäger im Dienste des Königs, er könne jetzt kein Auge für sie haben. Das
1 von 2 27.08.2020, 11:27Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465381/11
muss er freilich bitter büßen. Bei erster Gelegenheit geht Ipomene ausgerechnet mit
Acrimante fremd.
Als theatralische Atamira (Mozarts Elvira) wendet sich Theodora Raftis mit einem herr-
lich klagenden Lamento an alle erdenklichen Götter. Andrew Munn preist als König
Atrace mit tief knarzenden Basstönen seine Freiheit von Regierungspflichten, um gleich
darauf stimmlich recht schüchtern in die Liebesfalle zu tappen. Wie Leporello erweist
sich Acrimantes Diener Bibi als Schlitzohr und abergläubischer Angsthase – eine Rolle,
die dem klangvoll singenden und brillant spielenden Bassbariton Lorenzo Barbieri wie
auf den Leib geschrieben ist. Köstlich zelebriert er bei einer urkomischen Balkonszene
seinen absehbaren Absturz.
Auch der Tenor Joel Williams als alte Amme Delfa, Rocco Lia als basskräftiger Fähr-
mann Caronte und Juho Punkeri als königlicher Berater Tridemo, der von Acrimante
fies abgemurkst wird und als rächende Statue zurückkehrt, überzeugen vokal und
szenisch. Nach makabren Sexspielen im vermeintlichen Sarg wird der scheintote Lüst-
ling, der noch im Angesicht der Hölle scharf wird und sein loses Maul nicht bändigen
kann, von einem Obdachlosen in einen Einkaufswagen gepackt und als Orfeos frecher
Bruder zu schaurigen Tönen in die Unterwelt befördert. Erst jetzt merkt er, dass es für
ihn keine Wiederkehr gibt. Oder sollte er als Don Giovanni doch entkommen sein?
2 von 2 27.08.2020, 11:27New York Philharmonic Restarts the Music With a Pickup Truck - Th... https://www.nytimes.com/2020/08/26/arts/music/new-york-philharmon... 1 von 2 27.08.2020, 12:43
New York Philharmonic Restarts the Music With a Pickup Truck - Th... https://www.nytimes.com/2020/08/26/arts/music/new-york-philharmon... 2 von 2 27.08.2020, 12:43
Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465381/12
F.A.Z. - Feuilleton Donnerstag, 27.08.2020
Ein verletzlicher Mensch
Er hat einen festen Platz in Kronberg/Von Raimund Trenkler
Ein Künstler war er, aber auch ein Mensch, Mensch in jedem,
im höchsten Sinn.
Franz Grillparzer,
Grabrede für Ludwig van Beethoven
Zehn Stiegenstufen haben mich zu Beethoven geführt. Das war in Heiligenstadt, Wien,
19. Bezirk (Döbling), Pfarrplatz 2. Eine kleine an die Wand geschmiegte Treppe im
malerischen Hof eines Heurigenweinguts mit einer Tafel, die verriet: „Genau hier
befand sich der Stiegenaufgang zu seiner Wohnung.“ Da stand er plötzlich vor mir, der
Mensch Ludwig van Beethoven. Und begleitete mich für nur wenige Gehminuten in die
Probusgasse 6 (auch hier hat er einen Sommer lang gewohnt) in die Beethoven-
Gedenkstätte: Perücken, ein Koffer, Bücher, ein Hammerflügel, sein Stammbuch, ein
Hörrohr ... was der Mensch so brauchte.
Vier Sommer seines Wiener Lebens hatte der Mietnomade Beethoven (fast dreißig
Umzüge!) allein in Heiligenstadt Logis genommen. Ein Grund, warum dieses beschauli-
che ehemalige Weindorf nun für den Menschen Beethoven so gut Zeugnis ablegen
kann, ist vor allem der Brief, den der erst zweiunddreißigjährige Ludwig hier in der
Probusgasse 6 geschrieben hat: das berühmte sogenannte „Heiligenstädter Testament“,
an seine Brüder gerichtet, aber nie abgeschickt, das einen tiefen Einblick gibt in das,
was ihn verzweifeln ließ – seine damals beginnende Taubheit –, und in das, was ihm die
Kraft gab weiterzuleben – seine Verpflichtung der Musik gegenüber.
Natürlich, die tragische Geschichte von Beethovens zunehmender Taubheit kennt wohl
jedes Kind. Man muss es sich nur ausmalen, dieses Genie, das es drängt, für die
Menschheit Musik zu schaffen, und erkannt hat, dass diese Aufgabe grenzenlos ist,
verliert ausgerechnet das Gehör!
Was mich jedoch beim Lesen dieser Schrift am meisten berührt hat, war dieses: Die
Klage des noch jungen Klaviervirtuosen und Komponisten gilt gar nicht zuerst dem
Verlust, den er für sein musikalisches Wirken zu befürchten hatte. Nein, das größte
Unglück schien es für ihn zu sein, sich von der Gemeinschaft absondern zu müssen. Am
meisten quälte es ihn, die Verbindung zu den Mit-Menschen zu verlieren, gar (und am
Ende noch für die Nachwelt) als Misanthrop zu gelten. In Heiligenstadt habe ich dieses
tief bewegende Zeugnis seiner Qual und seiner Angst sozusagen unter seinen Augen
gelesen. Mensch, Beethoven.
Ludwig van Beethoven hat geliebt, gelitten, geträumt und gehadert, er war leidenschaft-
lich, diszipliniert, ungeduldig, fürsorglich, weltoffen, stur.Beethoven war ein Genie,
sicher, aber vor allem war er ein Mensch, der geben wollte und der gegeben hat, was er
zu geben hatte. Er machte weiter, obwohl er körperlich litt – an seiner mit Tinnitus und
weiteren Verzerrungen einhergehenden Ertaubung, aber auch an anderen schmerzhaf-
ten Krankheiten – und obwohl er sein eigenes ersehntes privates Liebes- und Lebens-
glück nie finden konnte. Eindrucksvoll hat der Komponist Jüri Reinvere die Suche nach
diesem verletzlichen Beethoven zur Gefühlswelt eines Cellokonzerts – das Beethoven
leider nie geschrieben hat – gemacht.
1 von 2 27.08.2020, 11:41Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465381/12
Beethovens Musik ist ungemein menschlich, denn sie drückt alles aus, was der Mensch
ist und fühlt. Wir dürfen sie auch als eine höhere Macht verehren, die uns berührt,
ergreift und vielleicht alle Menschen Schwestern und Brüder werden lässt. Unsere
Begegnung in Heiligenstadt aber hat mir den Menschen Beethoven selbst zum Vorbild
werden lassen: Was man geben kann, das soll man geben. Eigentum verpflichtet,
ebenso wie Talent. Selbstlos geben zu können und aufrecht durch Leben zu gehen zeich-
net uns Menschen aus. Das ist Menschlichkeit.
Auf die Menschen zu schauen, auch als Musiker und Interpret, das hat uns ein von mir
zutiefst verehrter Mann vorgelebt: Pablo Casals. Mit seinem (Glaubens-)Satz „Kunst
und Menschlichkeit sind untrennbar“ hilft er uns in Kronberg dabei, junge Ausnahme-
musiker zu Künstlerpersönlichkeiten auszubilden und ihnen dabei bewusst zu machen,
dass sie nicht nur für die Musik Verantwortung tragen.
Wie man Menschlichkeit ganz schlicht und einfach praktiziert, hat Pablo Casals uns
vorgemacht, als er Konzerte für Arbeiter gab, als er sich weigerte, unter Diktatoren
aufzutreten, als er im Spanischen Bürgerkrieg ins Exil ging, Flüchtlinge aktiv unter-
stützte, Briefe an Gefangene schrieb. „He was a simple man“ wird Pablo Casals’ Witwe
Marta Casals Istomin nicht müde, uns zu erinnern, jedes Mal, wenn wir in Kronberg
über seinen Aufruf zu mehr Menschlichkeit sprechen. Casals hat einfach getan, was er
tun konnte, mit allem, was ihm zur Verfügung stand. Und er war darin konsequent, in
seinem Tun wie in seinem Sichverweigern. Aber sein 1945 abgegebenes Gelöbnis, keine
Konzerte in Deutschland zu geben, solange das Land die Franco-Diktatur tolerierte,
brach er doch, genau einmal, als er im September 1958 im Geburtshaus Ludwig van
Beethovens in Bonn vor einem kleinen Publikum Sonaten von Bach und Beethoven
spielte. Für ihn war das nicht inkonsequent. Denn dieser Ort war für ihn ein Pilgerort,
heilig, neutral und frei.
Passt es da nicht, junge Interpreten und angehende aufrechte Botschafter für die klassi-
sche Musik im Umfeld dieser beiden Namen wachsen zu lassen? Mein Ziel ist es, dass
der Platz vor dem in Kronberg entstehenden Casals Forum, unserem neuen Konzertsaal
und Studienzentrum, einmal Beethovenplatz heißen wird.
Raimund Trenkler, Cellist, ist Gründer und Leiter der Kronberg Academy.
2 von 2 27.08.2020, 11:41Sie können auch lesen