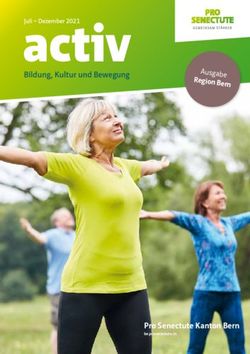PRESS REVIEW Thursday, March 11, 2021 - Daniel Barenboim Stiftung Barenboim-Said Akademie & Pierre Boulez Saal - Index of
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
PRESS REVIEW
Daniel Barenboim Stiftung
Barenboim-Said Akademie & Pierre Boulez Saal
Thursday, March 11, 2021PRESS REVIEW Thursday, March 11, 2021 Der Tagesspiegel, DB Am 20. März beginnt eine Pilotphase für den Neustart der Berliner Bühnen – neun Häuser sind dabei Frankfurter Allgemeine Zeitung, DB Tango für die Ohren und manchmal sogar für die Füße: Vor hundert Jahren wurde Astor Piazzolla geboren Frankfurter Allgemeine Zeitung Imperiale Männlichkeit. Drei Direktorinnen kritisieren Horst Bredekamp Monopol Bredekamp über Raubkunstdebatte. Eine irrwitzige Verdrehung des Diskurses Texte Zur Kunst Zur Solidarität unter ungleichen von Mahret Ifeoma Kupka Die Welt In Sinfonieorchestern spielen weiterhin weniger Frauen als Männer. Interview mit Katharina Wagner Der Tagesspiegel Bundeskultur- Ministerium stößt auf Ablehnung Die Zeit Erstmals äußert sich Johannes Öhman über die Gründe für seinen Rücktritt als Direktor des Staatsballetts Berlin. Und erzählt von einer Kunstform, die unter Rassismus, Diskriminierung und altem Hierarchie denken leidet
11.3.2021 https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/475131/8-9
Donnerstag, 11.03.2021, Tagesspiegel / Berlin
Erst testen, dann Platz nehmen
Am 20. März beginnt eine Pilotphase für den Neustart der Berliner Büh-
nen – neun Häuser sind dabei
Von Frederik Hanssen
© Britta Pedersen/dpa
Live-Erlebnisse sind unersetzbar. Das Publikum und die Theatermacher brennen darauf, sich wieder be‐
gegnen zu können. Und sei es auch in einem Zuschauerraum, in dem die Hälfte der Sitze fehlt, wie hier
im Berliner Ensemble.
Der Barbier ist wieder geöffnet, die Bierbar weiterhin geschlossen – jetzt aber gibt es
immerhin einen Hoffnungsschimmer für die Bühnen der Hauptstadt. Kultursenator
Klaus Lederer (Linke) will ab dem 20. März ein Pilotprojekt starten, bei dem in neun In-
stitutionen einmalig Aufführungen mit Publikum stattfinden. Mehrfach hatten er und
sein Staatssekretär Torsten Wöhlert im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses
schon angekündigt, dass seine Verwaltung so einen solchen Live-Testballon vorbereite.
Am heutigen Donnerstag soll der Vorschlag nun endlich in der Senatssitzung diskutiert
und auch beschlossen werden. Nach vier langen Monaten im zweiten Kultur-Lockdown
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/475131/8-9 1/311.3.2021 https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/475131/8-9
brennen die Häuser der darstellenden Künste darauf, wieder öffnen zu können.
Wie genau ein Neustart organisatorisch funktionieren kann, soll in dem Pilotprojekt
ausprobiert werden, über das zuerst die „B.Z.“ berichtete. Mit einer doppelten Strategie
möchte Klaus Lederer den Besuch von Kultureinrichtungen besonders sicher machen:
Zum einen werden ausschließlich personalisierte Tickets ausgegeben, damit die Kon-
taktnachverfolgung gesichert ist. Und zum anderen muss ein tagesaktueller negativer
Schnelltest vorgelegt werden. Dieser Test wird zwar kostenlos sein, die potenziellen
Besucher:innen werden vor dem Kulturgenuss dafür jedoch eine Menge Zeit einplanen
müssen. Genaueres dazu soll nach der Senatssitzung bekannt gegeben werden.
Im Gespräch mit dem Tagesspiegel erklärte Klaus Lederers Pressesprecher Daniel
Bartsch: „Die neun Häuser, die teilnehmen, sollen eine Blaupause dafür liefern, wie sich
das bestehende Hygienekonzept in Verbindung mit dem Testen und der personalisier-
ten Eintrittskarte bewährt.“ Für jede Kultursparte wird dabei jeweils eine repräsenta-
tive Institution ausgewählt: ein Opernhaus, ein Theater, ein Konzertsaal, eine Popmu-
sik-Location und so weiter. Auch ein Club darf dabei sein, allerdings werden die Gäste
dort nur Musik hören, aber noch nicht tanzen können.
Daniel Bartsch lobte ausdrücklich die kooperative Haltung der Berliner Kulturinstitu-
tionen in den vergangenen zwölf Monaten: Sie seien seit dem Beginn der Pandemie alle-
samt „ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht geworden“ und hätten sich „vor-
bildlich“ ans gemeinsam erarbeitete Rahmenkonzept gehalten. Darum wolle man jetzt
testen, wie der Betrieb in den Häusern funktionieren kann, obwohl noch kein konkre-
tes Datum für den von den Machern wie vom Publikum ersehnten Neustart feststeht.
Mit seinem Pilotprojekt reagiert Klaus Lederer auf den wachsenden Druck der
Bühnenkünstler:innen, die eine verlässliche Öffnungsperspektive einfordern. Am 22.
Februar hatte eine spartenübergreifende Initiative von 30 Kultur- und Sportinstitutio-
nen zusammen mit 20 Wissenschaftler:innen einen „Leitfaden zur Rückkehr von Zu-
schauern und Gästen“ vorgestellt. Am 26. Februar schickten die Chefdirigenten aller
großen Berliner Orchester sowie viele Intendant:innen einen offenen Brief an die Bun-
deskanzlerin, den Regierenden Bürgermeister sowie die Wirtschaftssenatorin und den
Kultursenator, in dem es ebenfalls um die Forderung nach einem Neustart ging.
Die Bereitschaft zur Teilnahme an Lederers Pilotprojekt in der Kulturszene der Haupt-
stadt ist sehr groß. Zu Details der Planungen wollten sich auf Tagesspiegel-Anfrage al-
lerdings weder die Deutsche Oper noch die Berliner Philharmoniker oder die Staats-
oper äußern. Mit Klaus Lederer sei Stillschweigen vereinbart worden, bis der Vorschlag
im Senat beschlossen ist, hieß es.
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/475131/8-9 2/311.3.2021 https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/475131/8-9
Klar ist nur, dass weder das Staatsballett noch die Komische Oper mitmachen werden –
denn sie haben sich schon festgelegt, dass sie ihren Spielbetrieb nicht vor Ende April
respektive Anfang Mai aufnehmen wollen. Die Deutsche Oper dagegen könnte Riccardo
Zandonais Musikdrama „Francesca da Rimini“ präsentieren, deren Premiere bisher als
Streaming-Event am 14. März geplant ist. Die Staatsoper wiederum bereitet aktuell un-
ter der Leitung ihres Generalmusikdirektors Daniel Barenboim eine Neuinszenierung
von Mozarts „Hochzeit des Figaro“ vor.
Mit seiner „Erst testen, dann Platz nehmen“-Strategie erweist sich der Senator einmal
mehr als übervorsichtig, was mögliche Lockerungen in seinem Bereich betrifft. Sämtli-
che Studien von Wissenschaftlern, die in aufwendigen Verfahren nachgewiesen haben,
dass der Besuch in einem Saal mit moderner Lüftungsanlage absolut unbedenklich ist,
reichen ihm nicht aus.
Dabei hatte der Bürgermeisterkandidat der Linken den jüngst veröffentlichten „Leitfa-
den zur Rückkehr von Zuschauern und Gästen“ noch als „richtigen Weg“ und „starkes
Signal“ beschrieben. Außerdem war am „Leitfaden“ auch der TU-Professor und Aero-
sol-Spezialist Martin Kriegel beteiligt, von dem sich Lederer seit Langem beraten lässt.
„Lieber ein Sicherheitsnetz mehr als weniger in der aktuellen Situation“, kommentierte
sein Pressesprecher jetzt die Entscheidung des Senators gegenüber dem Tagesspiegel.
Durcheinandergeraten ist damit Klaus Lederers ursprüngliche Prioritätenliste für die
Öffnungen in seinem Bereich. Eigentlich sollten zuallererst Kulturangebote für Kinder
und Jugendliche wieder anlaufen, dann erst Museen und im dritten Schritt die Bühnen.
Nun können Museen seit dieser Woche wieder öffnen, für die Bühnen und Konzertsäle
wird das Pilotprojekt gestartet – nur die Minderjährigen schauen weiterhin in die
Röhre.
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/475131/8-9 3/311.3.2021 https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466591/11
F.A.Z. - Feuilleton Donnerstag, 11.03.2021
Der mit dem Kopf tanzt
Tango für die Ohren und manchmal sogar für die Füße: Vor hundert Jahren wurde Astor
Piazzolla geboren
Das Wort „Tänzer“ kommt Astor Piazzolla nicht über die Lippen. In Daniel Rosenfelds Doku-
mentarfilm „The Years of The Shark“ (neu auf DVD bei EuroArts/Warner) spricht er nur
verächtlich von „Menschen, die zu viel auf ihre Füße achten“. Ihretwegen war ihm schon 1950
das Spiel auf dem Bandoneon in den Tango-Lokalen von Buenos Aires völlig verleidet gewesen.
„Meine Musik ist für Menschen, die denken“, sagt er auf einem der alten Tonbänder, die seine
Tochter Diana bespielt hat, „ich will, dass die Menschen bei meiner Musik ein bisschen denken.
Sie soll nicht nur eine Verdauungspause sein.“
Astor Piazzolla kam heute vor hundert Jahren in Argentiniens größtem Seebad Mar del Plata
zur Welt, drei Monate nach der Uraufführung von Maurice Ravels „La Valse“ und sieben Jahre
vor der Uraufführung von dessen „Boléro“. Es sind diese beiden Werke, die den Abriss einer
jahrhundertealten Verbindung zwischen Kunstmusik und Gesellschaftstanz – als einer sozial
regulierten Konversation der Körper – in Europa markieren. Alle späteren Reflexe komponier-
ter Kunst auf den Tanz trugen dann retrospektive Züge – wie in den Balletten Prokofjews oder
Chatschaturjans – oder den Charakter des Ausflugs wie in den Jazznummern bei Hindemith,
Strawinsky oder Schulhoff. Dass aber Kunst, die wie die Tanz-Suiten Bachs, die Mazurken
Chopins oder die Walzer Tschaikowskys auf der Höhe ihrer Zeit steht, ihre Beziehung zum
Tanz reflektiert, ohne tanzbare Musik zu liefern, das schien – nach dem radikalen Bruch der
europäischen Avantgarden mit allem, was in Musik sprachlich, kulturell und geschichtlich
geprägt war – nicht mehr möglich.
In diesen scheinbar zielgerichteten Prozess einer Trennung von ernster und unterhaltsamer
Musik, auch zwischen Kunst und Tanz platzte Piazzolla in den fünfziger Jahren hinein als
jemand, mit dem keiner gerechnet hatte. Er faszinierte mit seinem Quintett in Buenos Aires
Jazzgrößen wie Dizzy Gillespie, Stan Getz und Ella Fitzgerald. Chansonniers wie Claude Bras-
seur suchten die Zusammenarbeit mit ihm. Für den klassischen Cellisten Mstislaw Rostropo-
witsch, der mit Prokofjew und Britten, Dutilleux und Lutosławski gearbeitet hatte, schrieb er
„Le grand tango“. Seine Musik, in der die Melancholie osteuropäisch getönter Romanzen durch
die Spitzen Ravels, Bartóks und Strawinskys geschärft wurde, trug Welterfahrung in sich und
stellte doch die Konversation der Körper von den Füßen auf den Kopf.
Dass es Piazzolla im zwanzigsten Jahrhundert wie wenigen gelang, dem sozialen und ästheti-
schen Auseinanderdriften von Musiksphären entgegenzuwirken, hat sicher mit seiner Herkunft
und seinem Bildungsweg zu tun. Das Kind italienischer Einwanderer liebte während seiner
Jahre in New York das Klavier und die Musik Johann Sebastian Bachs, lernte aber dem Vater
zuliebe, der im nordamerikanischen Exil sein Heimweh stillen wollte, Bandoneon. Mit dem
Bandoneon verdiente der Halbwüchsige, zurück in Buenos Aires, in den Kneipen und Bordel-
https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466591/11 1/311.3.2021 https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466591/11
len sein Geld, wollte aber zum Klavier und zum Orchester. Der Legende nach war es Nadia
Boulanger in Paris, bei der wenig später auch Daniel Barenboim studierte, die ihm gesagt
haben soll, in seinen akademischen Kompositionen stecke nichts Persönliches. Er selbst sei er
nur, wenn er auf dem Bandoneon spiele.
An diesem Punkt wird die Instrumenten- und Ingenieursgeschichte bedeutend: Denn wie der
jüngst im Klartext Verlag erschienene Bildband „Bandoneon“ anschaulich darlegt, wäre ohne
Heinrich Band (1821 bis 1860) die Geschichte des Tangos, wie wir ihn heute kennen, nicht
denkbar. Die Behauptung „Der Tango kommt aus Krefeld“ schiene indes überspitzt, da manche
auch den Chemnitzer Instrumentenbauer Carl Friedrich Uhlig für den Erfinder der Knopf-
Tastatur halten, und wieder andere sagen, die Finnen haben den Tango erfunden. Das von
Band gebaute Instrument mit der „rheinischen Tastatur“ erreichte jedenfalls – wie auch
immer, darum ranken sich Legenden – zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts die Hafen-
stadt Buenos Aires, und wir lesen: „Als der deutsche Starspieler Walter Kanone‘ Pörschmann
1925 Argentinien besuchte, erzählte er von mehreren tausend Bandoneonisten.“
Weil das Bandoneon im Gegensatz zum Akkordeon zur Hervorbringung von Einzeltönen
ausgelegt ist, eignete es sich noch besser zum Soloinstrument und wurde ein solches zunächst
im „Sexteto típico“, dann in argentinischen Tango-Orchestern und schließlich jenes, das uns
heute sofort im Ohr klingt, wenn wir an „Oblivion“ oder „Adios Nonino“ denken.
Schon als Dreizehnjähriger hatte Piazzolla das Idol des klassischen Tango Argentino, den
Sänger Carlos Gardel, auf dem Bandoneon begleitet. Doch kompositorisch wollte Piazzolla
etwas anderes. Er öffnete die geschlossene Form des klassischen Tangos zu rhapsodischer Frei-
heit; er verkomplizierte dessen Harmonik so stark, dass sie Zuhören erzwang; vor allem aber
strukturierte er die Metrik um. Während der klassische Tango auf dem Schlag durchpulsiert
und den Zwei- oder Viervierteltakt symmetrisch unterteilt, zerstörte Piazzolla diese Symmetrie,
indem er die klassische Habanera-Punktierung in der Taktmitte zur zweiten Hälfte überband.
Damit waren die acht Teilschläge des Taktes nicht mehr in vier plus vier, sondern in drei plus
drei plus zwei gegliedert – vermutlich die gravierendste Änderung im Tango Nuevo, die ihm in
Argentinien heftige Anfeindungen einbrachte.
Stellt dieser neue Tango wohl sein wichtigstes Vermächtnis dar, ist Piazzollas Bedeutung
schließlich auch kaum zu überschätzen für den Electrotango, den man schon ansatzweise in
Grace Jones’ Reggae-Dub-Version von Piazzollas „Libertango“ (1981) erkennen konnte und
dessen weltweiter kommerzieller Siegeszug um die Jahrtausendwende mit dem „Gotan Project“
einsetzte. In Paris hatten sich dafür ein Schweizer, ein Franzose und ein Argentinier zusam-
mengetan, um bekannte Tangomelodien in Stücke zu zerlegen und mit Beats zu garnieren.
Mit dem Electrotango fand Piazzolla auch noch mal den Weg in die Tanzschulen – zur geregel-
ten Konversation der Körper und zu Menschen, die auf ihre Füße achteten – und letztlich
zurück auf die Straße, als mit dem Aufkommen sogenannter Flashmobs in den sozialen Medien
auch solche für Tango sich fanden. So konnte man an einem Sommertag vor einem deutschen
Hauptbahnhof stehen und plötzlich Dutzende teils sehr junge Tangopaare dort lostanzen
sehen: auch zu Bandoneonklängen des alten Astor.
https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466591/11 2/311.3.2021 https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466591/11
Dass sein ganzes Leben und Arbeiten möglicherweise unter zwanghaftem Beweisdruck von
Stärke stand, weil er mit einer Fußfehlstellung zur Welt gekommen war, legt der Film von
Daniel Rosenfeld nahe. Die innerfamiliären Verwerfungen bei Piazzolla sind so schmerzhaft,
wie die politischen verheerend sind. Das gemeinsame Mittagessen mit Argentiniens Diktator
Jorge Videla hat ihm seine Tochter Diana nie verziehen. Natalio Gorin überlieferte vor Jahren
noch einen ganz anderen Satz Piazzollas: „Ich dachte, uns Argentiniern fehlt eine Persönlich-
keit wie Pinochet. Vielleicht hat Argentinien in einem Moment seiner Geschichte ein wenig
Faschismus gefehlt.“ Auch das gehört zu jener „Musica impura“, jener unreinen Musik, die
nicht nur Pablo Neruda an Piazzolla faszinierte. Jan Brachmann/Jan Wiele
https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466591/11 3/311.3.2021 https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466591/9
F.A.Z. - Feuilleton Donnerstag, 11.03.2021
Imperiale Männlichkeit
Drei Direktorinnen kritisieren Horst Bredekamp
Am vergangenen Montag erschien in diesem Feuilleton ein polemischer Artikel des Berliner
Kunsthistorikers Horst Bredekamp mit der These, dass im Zuge der Debatte über das Eigen-
tum an Museumsgut außereuropäischer Herkunft der „antikoloniale Kulturbegriff“ der Grün-
derzeit deutscher Völkerkundemuseen aus dem Gedächtnis verbannt werde. Bredekamp
beklagte in den Worten des Artikelvorspanns die „Zerstörung des Antikolonialismus durch den
Postkolonialismus“.
Léontine Meijer-van Mensch, die Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen
Sachsens, kommentierte Bredekamps Veröffentlichung bei Twitter. Genauer gesagt, galt ihr
Kommentar dem Datum der Veröffentlichung: „Solchen Typen eine Bühne geben am Weltfrau-
entag, irgendwie schräg.“ Viola König, die pensionierte Direktorin des Ethnologischen Muse-
ums der Staatlichen Museen zu Berlin, stimmte ihrer Kollegin zu und buchstabierte den Sinn
des hingeworfenen Kommentars aus: Schräg sei es in der Tat, „ausgerechnet am Weltfrauen-
tag, angesichts der heute mit einer Ausnahme von problembewussten Frauen geleiteten Ex-
VK-Museen, einem Beitrag, in dem es von all den Horst, Wolfgang, Adolf, Georg, Franz, Felix,
Alexander, Wilhelm und Carl nur so wimmelt, eine Bühne zu geben“.
Diese kollegialen Reaktionen bestätigen den von Bredekamp geäußerten Verdacht, dass im
Kulturkrieg um die Kolonialvergangenheit die Symbolpolitik vollends an die Stelle der Ausein-
andersetzung in der Sache getreten ist. Ethnologinnen sind zuständig für Symbole: Der Fall ist
ernst zu nehmen. Wenn man der Entscheidung unserer Redaktion, den Artikel am Montag und
nicht erst heute herauszubringen, einen symbolischen Sinn zuschreiben will, muss man uns
entweder eine bewusste Absicht unterstellen oder aber annehmen, dass die gedankenlose
Datumswahl etwas über uns verrate. Übrigens kommt es bei Zeichen immer darauf an, wer sie
setzt. „Solche Typen“ bekommen eine Bühne: Man stelle sich vor, ein professoraler Horst hätte
sich mit einem analogen herabsetzenden Plural über den Artikel einer Museumsfrau geäußert.
Was wäre dann wohl auf Twitter losgewesen?
Nadine Snoep, als Direktorin des Kölner Rautenstrauch-Joest-Museums eine der von Viola
König angesprochenen problembewussten Frauen, wurde im Deutschlandfunk zu der „Empö-
rung“ befragt, die Bredekamps Intervention „allein schon bei Twitter“ ausgelöst habe. Auch
Snoep fand es „interessant, dass am Frauentag dieser Artikel publiziert wurde“. Aber sie
nannte ein Argument: Bredekamp verbreite „ein sehr paternalistisches Gedankengut“. In dem
Leitgedanken Bredekamps, dass der Berliner Museumsdirektor Adolf Bastian die vom Kolonia-
lismus bedrohte Vielfalt der Weltkulturen habe „retten“ wollen, macht Snoep ein patriarchali-
sches Wunschbild aus. Bredekamps Artikel ist für Snoep „eine sehr interessante psychologische
Reaktion“ auf die Änderung der „Machtverhältnisse“ im öffentlichen Diskurs: Material für
„eine Psychoanalyse“. Auf die Frage, ob man denn Wilhelm Joest, dessen Sammlungen den
https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466591/9 1/211.3.2021 https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466591/9
Grundstock ihres Museums bilden, einen „antikolonialen Sammler“ nennen könne, sagte
Snoep: „Auf gar keinen Fall.“
Eine differenzierende Antwort ist von der Dissertation zu erwarten, an der Carl Deußen, ein
Mitarbeiter des Museums, sitzt. Joest, Enkel eines Zuckerfabrikanten und preußischer Ritt-
meister, war ein Weltreisender und Privatgelehrter, der bei Bastian studierte. Seine Berliner
Wohnung hatte er als privates Weltmuseum eingerichtet. Joest ist eine Schlüsselfigur der
Berliner Zirkel, die Bredekamp rehabilitieren möchte.
In einem ersten Bericht über sein Projekt hebt Deußen hervor, dass Joest das Rüstzeug einer
kolonialistischen Denkungsart durch Lektüre in der Kindheit erworben habe. Wir stoßen auch
auf den Begriff des Paternalismus: Joests Einstellungen zu den Menschen, deren Dinge er
sammelte, schwankten „zwischen paternalistischer Bewunderung und offen rassistischer
Feindseligkeit“. Deußen hat seine Untersuchung als Fallstudie über „imperiale Männlichkeit“
angelegt. Die Dominanz sozialpsychologischer und insbesondere sexualpsychologischer Kate-
gorien in der heutigen Forschung zur Geschichte der Ethnologie kann wohl auch die Reaktio-
nen der drei Museumsdirektorinnen auf Bredekamp verständlich machen.
Deußen bekennt, dass er Züge seines eigenen jüngeren Forscher-Ich bei Joest wiederfinde,
romantische Neugier auf bedrohte Völker oder mit einem Wort: ein Rettersyndrom. Joest
dürfe nicht auf einen „kolonialen Buhmann“ reduziert werden. Auch den Kritikern der kriti-
schen Fachgeschichte möchte Deußen mit Verständnis begegnen. Man müsse verhindern, dass
„weiße Menschen sich aus der öffentlichen Diskussion zurückziehen, nur um ihren Schmerz
auszusprechen, wenn sie ,unter sich‘ sind“. Joest fehlte laut Deußen eine „epistemische Grund-
lage“ für den selbstkritischen Blick in den „Spiegel der Geschichte“, wie er sie heute in Gestalt
der „postkolonialen Theorie“ besitze. Dass die postkoloniale Theorie selbst Objekt von Kritik
werden muss, ist jenseits der Invektiven der provokative Gedanke Horst Bredekamps. Patrick
Bahners
https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466591/9 2/2Raubkunstdebatte um Humboldt Forum Eine irrwitzige Verdrehung des Diskurses
Sammlungen liegen, wie passen die in die sozialdemokratische Konzeption? Die brauchte in den Herkunftsländern wahrscheinlich auch niemand mehr, während sie hierzulande für wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse sorgten. Aber bevor es allzu morbide wird, müssen wir noch kurz das mit der Auslöschung erklären. Bredekamp schreibt, dass er und Thierse ja damals die wichtigen Säle im Forum nach Aby Warburg und Franz Boas hatten benennen wollen, den großen jüdischen Gelehrten und Vorreitern eines antirassistischen und antihierarchischen Sammelns. Wenn jetzt stattdessen über Raubkunst diskutiert wird, ist das seiner Auffassung nach Antisemitismus. Am Ende ist alles in eins gerührt, die Raubkunstdebatte mit Identitätspolitik gleichgesetzt und der Antisemitismusvorwurf oben drauf gestapelt. Womit wir auch schon beim Fazit wären: Mit den Anfeindungen durch die AfD werde unsere Gesellschaft schon fertig werden, da ist Bredekamp ganz optimistisch. Aber die überwindung des "identitären Angriffs auf die Vernunft dürfte schwerer zu erbringen sein." Wie die grantigen Herren aus der Muppet-Show Man kann sich vorstellen, wie man sich im Humboldt Forum in diesem Moment die Haare rauft - und bei der Staatsministerin für Kultur wahrscheinlich auch. Schließlich versucht man seit Monaten, die Debatte zu befrieden, die Kritiker und Kritikerinnen in das Gespräch einzubinden, den Ruf als Leugner der Verbrechen der Kolonialgeschichte loszuwerden. Gerade erst hat Monica Grütters in einem "SZ"-Interview wieder betont, dass allen Verantwortlichen im Humboldt Forum klar sei, dass sie am Umgang mit der Raubkunst gemessen würden, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit Partnern aus Benin in Gesprächen über die gestohlenen Bronzen sei, dass ein eigenes Referat für den Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten eingerichtet werde. Denen, die all das für zu wenig halten, gibt eine Wortmeldung wie die von Bredekamp jetzt wieder wunderbare Munition. Die alten Freunde Bredekamp und Thierse kommen einem ein bisschen vor wie die grantigen Muppets-Show-Herren Waldorf und Statler - nur deutlich weniger sympathisch. Außerhalb von Slapstickfilmen sind Pensionäre, die meckernd in ihrer Loge sitzen und faule Tomaten werfen, einfach nicht hilfreich.
11.3.2021 ZUR SOLIDARITÄT UNTER UNGLEICHEN Von Mahret Ifeoma Kupka
ZUR SOLIDARITÄT UNTER UNGLEICHEN
VON MAHRET IFEOMA KUPKA
Maske der Igbo, heute Nigeria, mit zufälliger Buchauswahl der Autorin in ihrer Frankfurter Wohnung.
Als „identitären Wahn“ bezeichnete der Kunsthistoriker Horst Bredekamp am Montag in der „FAZ“ das Begehren
von Personen, die nicht-weiß sind und die ihre jahrhundertelang unterdrückte Sichtbarkeit und Mitsprache
einklagen. Damit nimmt Bredekamp bewusst in Kauf, dass identitätspolitische Forderungen und Praktiken, die
People of Color in Reaktion auf systemische Ausschlüsse und Ungleichverteilungen artikulieren, mit den Anliegen
der rechtsextremen identitären Bewegung in eins gesetzt werden. Insofern macht der Backlash derer, die, wie
Bredekamp, um den Verlust an Aufmerksamkeit und Deutungshoheit bangen, das empathische Einfühlen in die
Erfahrungswelten marginalisierter Bevölkerungsgruppen umso notwendiger. Wie die Kunstwissenschaftlerin und
Kuratorin Mahret Ifeoma Kupka zeigt, lohnt sich hierfür einmal mehr der Blick in die Schwarzen politischen
Kunstbewegungen der 1960er Jahre.
Ich ging kürzlich mit einem Freund spazieren, wie das dieser Corona-Tage so üblich ist. Wir sprachen über dies
und das, darüber, was uns fehlt und worauf wir uns freuen usw. Plö lich sagte er, dass er besonders Gespräche
über zeitgenössische Kunst vermissen würde, den anregenden Austausch mit Kolleg*innen. Ich schaute ihn mit
meiner FFP2-Maske erstaunt an und sagte, dass er sich doch mit mir austauschen könne und wir das bereits die
längste Zeit unseres Spaziergangs getan ha en. Darau in entgegnete er: „Nein, wir sprachen über Rassismus,
Schwarze Künstler*innen, Dekolonisierung und Afrika. Ich meine die richtige Kunst.“ Und während er das sagte
und ich ihn weiter erstaunt anschaute, fiel ihm und auch mir auf, dass etwas sehr Merkwürdiges an dem war,
was er da gesagt ha e. „Schwarze Künstler*innen sind also keine richtigen Künstler*innen?“, fragte ich lächelnd,
während wir beide wussten, dass darauf mit „doch“ zu antworten, zu einfach wäre. Ich ha e gerade einen
https://www.textezurkunst.de/articles/mahret-ifeoma-kupka-zur-solidaritat-unter-ungleichen/11.3.2021 ZUR SOLIDARITÄT UNTER UNGLEICHEN Von Mahret Ifeoma Kupka
wissenschaftlichen Essay publiziert, der sich mit dieser Frage beschäftigte. Ausgehend von dem berühmten Zitat
Jean-Michel Basquiats – „I am not a Black artist; I am an artist“ – diskutiere ich darin Möglichkeiten der
Annäherung und Solidarität über strukturell bedingte Differenzen hinweg. [1]
Mi e Februar beschrieb Megan O‘Grady in einem Essay in der New York Times die Bedeutung von Kunst in
der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre. [2] Besonders figurative Malerei und Skulptur
ha en die Funktion, „directly to the needs and aspirations of Black America“ zu sprechen. Es ging auch darum,
mit einem westlichen, weißen Kulturkanon zu brechen, der zu dieser Zeit in der Abstraktion oder der Minimal
Art seine unmi elbare Repräsentionalität verlor. [3] Wer Schwarz war und abstrakt arbeitete, ha e es zu dieser
Zeit in der eigenen Künstler*innen-Identitäts-Verortung nicht leicht: „For [Jack] Whi en and other Black artists
of his generation, abstraction was something of a lonely course, one that set them apart from the Black Arts
Movement.“ Schwarze Kunst in den USA der 1960er Jahre war offiziell deutlich politisch und vor allem figurativ.
Daraus allerdings einem Beharren auf einer spezifischen Schwarzen Kunst und ihrer Fokussierung auf Figuration
die Bedeutung abzusprechen, sie gar als rein „identitätspolitisch“ abzutun, wäre fatal. Es bleibt vielmehr zu
untersuchen, ob die neue Aufmerksamkeit, die abstrakte Kunst Schwarzer US-amerikanischer Künstler*innen
der 1960er Jahre heute erhält – fast ein halbes Jahrhundert später –, nicht eher im Zusammenhang steht mit der
zuvor bewussten Trennung in Schwarz und weiß, durch die systemische Ausschlüsse und Ungleichverteilungen
überhaupt erst sichtbar gemacht werden konnten: „The license to free expression that white artists have been
granted by birthright — especially white male artists, so often perceived as the vanguard in visual arts — hasn’t
been available to Black artists“, schreibt O‘Grady. Das Privileg, einfach Kunst machen zu können, haben
Schwarze Künstler*innen und Künstler*innen of Color bis heute nicht vollständig. Allerdings haben die
Schwarzen politischen Kunstbewegungen der 1960er Jahre möglicherweise mit ihrer Institutionskritik die Basis
geschaffen, auf der heute eine angemessene Theoretisierung sta finden kann.
Es stimmt, dass ich sehr viel über „Rassismus, Schwarze Künstler*innen, Dekolonisierung und Afrika“
spreche. Diese Themen sind für mich untrennbarer Teil zeitgenössischer Kunstbetrachtungen, deren Integrierung
das gesamte System nachhaltig verändert. Die „richtige Kunst“ ist demnach die, in der alle vorhandenen
Perspektiven und Erfahrungsräume ihren Pla haben. Es gibt also kein „normal“, zu dem nach einem
ausgedehnten Gespräch über Rassismus zurückgekehrt werden kann. Normal ist ein Prozess, und wir sind
mi endrin.
„Fühlst du dich nicht ausreichend repräsentiert? Sollen wir mehr über die Kunst weißer Cis-Heteromänner
sprechen?“, fragte ich meinen Freund süffisant. Dabei kann ich das unbestimmte Unbehagen, das spontan aus
ihm sprach, durchaus nachvollziehen. Ein Blick in die Werbung, in die Modemagazine, in die Onlineshops, ja,
selbst in aktuelle Kunstausstellungsprogramme zeigt eine bisweilen groteske Übertreibung. Allerspätestens seit
der weltweiten Black-Lives-Ma er-Proteste im vergangenen Jahr scheint, was zuvor zu viel an weiß war, einem
Zuviel an Schwarz gewichen zu sein. Schwarz ist Trend. Von überall her strahlen, winken, posieren, provozieren
die zuvor marginalisierten Körper – daran ist nichts falsch. Was mich einerseits freut und entlastet – schön, so
viel Inspiration zu bekommen –, lässt mich den Backlash derer fürchten, die nun um den Verlust an
Aufmerksamkeit und Deutungshoheit bangen und den vermeintlich „identitären Wahn“ (das heißt alles, was
nicht-weiß ist und seit Langem unterdrückte Sichtbarkeit einfordert) als „größte Bedrohung“ sehen, wie
beispielsweise Horst Bredekamp am Montag in der FAZ. [4]
Das, was Bredekamp als „identitären Wahn“ bezeichnet, ist Identitätspolitik. Was darunter heute verstanden
werden kann, welche Gefahren mit einer derartigen Politik verbunden sind und wie sich diese von dem
unterscheidet, was Ende der 1970er Jahre das Combahee River Collective als solche begründete, beschreibt z. B.
Asad Haider in Mistaken Identity. [5] Ihm zufolge ist das größte Problem der zeitgenössischen Identitätspolitik,
dass sie weniger eine revolutionäre politische Praxis (so wie ursprünglich gedacht!) als eine individualistische
Methode ist. Sie basiert auf dem Bedürfnis des Individuums nach gesellschaftlicher Anerkennung und
untergräbt damit die Möglichkeit kollektiver Selbstorganisation und gesellschaftstransformierender Kämpfe. Das
passt ein bisschen zu dem, was Bredekamp sehr viel reißerischer in der FAZ schreibt: „Die Floskeln der
Selbstbestimmung sind Zwangsmi el eines totalitären Zugriffs auf Sprache, Geschichte und Zukunft.“ Oder:
„Am Ende einer identitären Politik [steht] nicht etwa eine aufgeklärte multikulturelle Realität […], sondern die
https://www.textezurkunst.de/articles/mahret-ifeoma-kupka-zur-solidaritat-unter-ungleichen/11.3.2021 ZUR SOLIDARITÄT UNTER UNGLEICHEN Von Mahret Ifeoma Kupka Reinheit einer so sauberen wie menschenverachtenden Orientierung.“ Ich frage mich, ob Bredekamp hier vielleicht eher von der rechtsextremen identitären Bewegung spricht (zumindest mit der „Verwechslung“ spielt). An anderer Stelle heißt es: „Das Unsägliche des Identitären liegt in der Gnadenlosigkeit, in der die Ethnien und ihre Kulturen voneinander getrennt werden.“ [6] Tatsächlich greift Bredekamp merkwürdigerweise Praktiken an, die deutlich auf das Gegenteil abzielen und sogar explizit radikal kollaborative Solidarität fordern, deren Teil auch Weiße sein sollen, nur eben nicht länger ausschließlich. https://www.textezurkunst.de/articles/mahret-ifeoma-kupka-zur-solidaritat-unter-ungleichen/
11.3.2021 ZUR SOLIDARITÄT UNTER UNGLEICHEN Von Mahret Ifeoma Kupka https://www.textezurkunst.de/articles/mahret-ifeoma-kupka-zur-solidaritat-unter-ungleichen/
11.3.2021 ZUR SOLIDARITÄT UNTER UNGLEICHEN Von Mahret Ifeoma Kupka
Nimba-Fruchtbarkeitsgöttin, vermutlich aus dem heutigen Guinea, und Feuerläufer-Maske aus Mali mit zufälliger Auswahl
an Büchern der Autorin in ihrer Frankfurter Wohnung.
Im April erscheint die deutsche Überse ung einiger einflussreicher Schriften der afroamerikanischen
Aktivistin Audre Lorde. [7] Sie initiierte in ihrer Zeit als Gastprofessorin an der Freien Universität im Berlin der
1980er Jahre die Gründung der Schwarzen deutschen Bewegung. Überse t wurden die Texte von einem Team:
Marion Kraft, afrodeutsche Autorin und Überse erin sowie Zei eugin, gemeinsam mit Eva Bonné (weiß),
Amerikanistin und Überse erin von unter anderen Sara Gran, Richard Flanagan, Amy Sackville und Michael
Cunningham. Das Nachwort stammt von der Politikwissenschaftlerin und Postkolonialismus-Expertin Nikita
Dhawan (PoC). Die drei konnten ihre jeweiligen Expertisen vor den Hintergründen ihrer Erfahrungswelten
einbringen. Eine Überse ung ist nie allein wörtlich, sondern bedarf auch einer sprachsensiblen Übertragung in
den entsprechenden kulturellen Kontext.
Kraft äußerte sich im Deutschlandfunk [8] auch zur Kontroverse um die Überse ung ins Niederländische
von Amanda Gormans Gedicht zur Inauguration Joe Bidens. Die Aktivistin Janice Deul ha e auf
Machtstrukturen und Marginalisierungen im Literaturbetrieb verwiesen und den damit verbundenen
Automatismus, dass zuerst nach weißen Expert*innen gesucht und gar nicht daran gedacht wird, dass es auch
andere Überse er*innen geben könnte, die vielleicht aufgrund ihrer Expertise besser geeignet sein könnten.
Darau in trat die beauftragte Überse erin (Marieke Lucas Rijneveld) zurück und machte Pla für ein
Überse er*innen-Team. Die belgisch-kongolesische Musikerin Marie-Pierra Kakoma wird das Gedicht ins
Französische überse en. Für die deutsche Überse ung wurden Kübra Gümüşay, Hadija Haruna-Oelker und
Uda Strätling beauftragt. [9] Es gibt weitere gelungene Beispiele für Kollaboration auf Augenhöhe (!), die das
empathische Einfühlen in die Erfahrungswelten anderer überhaupt erst ermöglicht. Dass das dringend
notwendig ist, zeigen nicht zule t solche peinlichen Entgleisungen wie im Feuilleton (nicht nur) der FAZ.
„Was wünschen Sie sich für die Zukunft?“, wurde ich kürzlich auf einem Panel gefragt. Ich bin realistisch.
Jahrhundertelang gewachsene Strukturen lassen sich nicht spontan überwinden. Rückblickend hat sich sehr viel
verändert; verinnerlichte, rassistische Strukturen wirken aber weiterhin in unseren Köpfen, bestimmen unser
Handeln. „Ich wünsche mir, dass die Leute zumindest kurz zusammenzucken, innehalten und nicht länger wie
selbstverständlich Rassismen reproduzieren“, antworte ich. Eine Gesellschaft, in der alle gleichberechtig und
gleichwertig miteinander verschieden sein können, braucht alle Informationen über ihre Mitglieder, und diese
bekommen wir, wenn wir uns gegenseitig davon erzählen und einander aufrichtig zuhören – in Neugier darauf,
wie diese Gesellschaft (und ihre Kunst) aussehen werden.
Dr. Mahret Ifeoma Kupka ist Kunstwissenschaftlerin, Kuratorin und freie Autorin. In ihren Ausstellungen, Vorträgen, Texten und interdisziplinären
Projekten befasst sie sich mit den Themen Rassismus, Erinnerungskultur, Repräsentation und der Dekolonisierung von Kunst- und Kulturpraxis in
Europa und auf dem afrikanischen Kontinent.
Image credit: Mahret Ifeoma Kupka
ANMERKUNGEN
[1] Mahret Ifeoma Kupka, „I am not a Black Artist; I am an artist – Kunst und Identität“, in: Hypthesen. Kunst und Krise,
12.02.2021, h ps://kxk.hypotheses.org/442 (h ps://kxk.hypotheses.org/442); gesehen am 09.03.2021.
[2] Megan O‘Grady, „Once Overlooked, Black Abstract Painters Are Finally Given Their Due“, in: The New York Times
Style Magazine, 12.02.2021, h ps://www.nytimes.com/2021/02/12/t-magazine/black-abstract-painters.html
(h ps://www.nytimes.com/2021/02/12/t-magazine/black-abstract-painters.html); gesehen am 09.03.2021.
[3] Bei der Schreibweise von „Schwarz“ mit großem S und „weiß“ klein und kursiv orientiere ich mich am Glossar für
diskriminierungssensible Sprache von amnesty international: h ps://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-
diskriminierungssensible-sprache (h ps://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache).
https://www.textezurkunst.de/articles/mahret-ifeoma-kupka-zur-solidaritat-unter-ungleichen/11.3.2021 ZUR SOLIDARITÄT UNTER UNGLEICHEN Von Mahret Ifeoma Kupka
[4] Horst Bredekamp, „Warum der identitäre Wahn unsere größte Bedrohung ist“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
08.03.2021, h ps://www.faz.net/aktuell/feuilleton/deba en/postkolonialismus-schaedigt-antikoloniale-vernunft-
17232018.html (h ps://www.faz.net/aktuell/feuilleton/deba en/postkolonialismus-schaedigt-antikoloniale-vernunft-
17232018.html); gesehen am 09.03.2021.
[5] Asad Haider, Mistaken Identity. Race and Class in the Age of Trump, London 2018.
[6] Vgl. Anm. 3.
[7] Audre Lorde, Sister Outsider, München 2021.
[8] „Streit um Amanda-Gorman-Überse ung. ‚Es geht nicht um Hautfarbe, sondern um Erfahrungswelten‘. Marion
Kraft im Gespräch mit Timo Grampes“, in: Deutschlandfunk Kompressor, 02.03.2021,
h ps://www.deutschlandfunkkultur.de/streit-um-amanda-gorman-ueberse ung-es-geht-nicht-um.2156.de.html?
dram:article_id=493425 (h ps://www.deutschlandfunkkultur.de/streit-um-amanda-gorman-ueberse ung-es-geht-
nicht-um.2156.de.html?dram:article_id=493425); gesehen am 09.03.2021.
[9] Sarah Hucal, „Armanda Gormans niederländische Überse erin tri vom Job zurück“, in: DW, 03.03.2021
h ps://www.dw.com/de/amanda-gorman (h ps://www.dw.com/de/amanda-gorman)-überse erin/a-56760193;
gesehen am 09.03.2021.
https://www.textezurkunst.de/articles/mahret-ifeoma-kupka-zur-solidaritat-unter-ungleichen/24 FEUILLETON DIE WELT DONNERSTAG, 11. MÄRZ 2021
Das Festivalorchester (mit Michael Volle als Hans Sachs) spielt „Die Meistersinger von Nürnberg“, 2017
PICTURE ALLIANCE / ENRICO NAWRATH/FESTSPIELE BAYREUTH/DPA/ENRICO NAWRATH
„Es gibt immer noch TYPISCHE Männerinstrumente“
E
ine neue Studie des Musik-
In Sinfonieorchestern lungen für Bayreuth immer komplizier- vorbereiteten Musizieren auf höchstem noch erfreulich höher. In diesem Jahr haltendes Gerücht, dass man nur auf An-
spielen weiterhin
informationszentrums hat ter. Außerdem hat heutzutage die Work- Niveau. Die reine Freude – aus der Sicht spielen im Bayreuther Festspielorches- frage von Orchesterseite Mitglied im
den Frauenanteil bei den 129 Life-Balance eine ganz andere Bedeu- der Intendantin und auch der Dirigen- ter immerhin 36 Musikerinnen, das ent- Festspielorchester werden könne.
weniger Frauen als
deutschen Kulturorches- tung. Einige wollen – und das ge- tinnen und Dirigenten. spricht einem Frauenanteil von 16 Pro-
tern untersucht. Er liegt bei schlechterunabhängig – ihren Urlaub, zent – für mich bei Weitem noch nicht Zu diesem Sommer: Wie werden Sie
Männer. Am
39,6 Prozent im Durchschnitt. Dabei die meist spielfreie Zeit an ihren Wie viele Musikerinnen und Musiker genug. 2019 betrug der Frauenanteil im spielen können?
schlechtesten
wurde deutlich: Je höher die Dienstpo- Stammhäusern, also die Sommerferien machen denn eigentlich das Festspiel- Orchester 14 Prozent, vor zehn Jahren Wir hoffen, dass wir aufgrund unseres
sition, je besser bezahlt die Stelle, desto ohne ihr Instrument verbringen. Wie- orchester aus? allerdings nur die Hälfte davon. Wir ma- vorgelegten Hygienekonzepts sowohl
schneidet Bayreuth
seltener finden sich dort Frauen. Insge- der andere möchten nicht jedes Jahr In normalen Jahren etwa 200 Mitglie- chen also Fortschritte – langsam. im Graben als auch auf der Bühne in den
samt ist nur jedes zehnte Orchester ge- nach Bayreuth kommen, um mehr Zeit der inklusive der Bühnen- und Pausen- für Bayreuth normalen Besetzungen
ab. Warum ist das so,
schlechtsparitätisch besetzt. Im Osten für und mit der Familie zu haben. Und musik, diesen Sommer werden es aber Enthüllen Sie mal einen Mythos. Wie werden spielen können. Nur der Chor
beträgt der Frauenanteil 36,7 Prozent, manche finden inzwischen auch Meer um die 230 Musikerinnen und Musiker kommt man ins Festspielorchester? wird höchstwahrscheinlich, aufgrund
Katharina Wagner?
im Westen 41 Prozent. Bei Musikern un- und Strand schöner als jeden Sommer sein, denn ich muss aufgrund der Pan- Ganz einfach: Man bewirbt sich schrift- der coronabedingten Auflagen des Sin-
ter 45 Jahren ist die Gleichstellung der das Fichtelgebirge. demie mit zwei kompletten Besetzun- lich im Orchesterbüro. Man muss nicht gens mit Abständen bei großen Kollekti-
Geschlechter bereits annähernd er- gen operieren, welche jeweils alle hier zwingend Mitglied eines Opernorches- ven, wohl etwas verkleinert aus dem
reicht. Die schlechteste Gleichstel- Musikerinnen und Musiker. Es hat Bay- Es gibt sie noch, die alten Bayreuth- gespielten Stücke beherrschen müssen, ters sein, an erster Stelle steht das künst- Chorprobensaal live übertragen werden
lungsnote bekam übrigens das als raue, reuth immer ausgezeichnet, dass die Kämpen? um sich im Quarantänefall gegenseitig lerische Können. Auch internationale müssen.
schwitzige Männerbastion verschrieene Künstlerinnen und Künstler in der Zeit Klar. Wir haben glücklicherweise einen ersetzen zu können. Bewerbungen und insbesondere Bewer-
Bayreuther Festspielorchester. Wir ha- der Sommerferien stets von ihren Fami- harten Kern, quasi Wagner-Überzeu- bungen von Musikerinnen sind uns sehr Und was hat das Publikum zu erwar-
ben bei dessen Chefin Katharina Wag- lien begleitet wurden, die Kinder quasi gungstäter, die teilweise seit Jahrzehn- Und wie viele Frauen spielen nun im willkommen. Es ist ein sich hartnäckig ten?
ner nachgefragt. zusammen aufwuchsen und gemeinsam ten bei uns im Graben sitzen. Übrigens Orchester? Unabhängig von der dann letztlich im
ihre Ferien verbrachten, während meist auch einige Frauen. In den vergangenen Immer noch zu wenige! Obwohl schon Sommer zugelassenen Anzahl an Zu-
VON MANUEL BRUG ein Elternteil im Festspielhaus tätig Jahren haben wir auch zunehmend so- seit Jahrzehnten Musikerinnen mitwir- schauern, wird sich für die Gäste im Zu-
war. Urlaub und Arbeit wurden und genannte „Wechselwähler“ die zwar ken, bemühen wir uns stets, diese Zahl schauerraum nicht sehr viel ändern,
WELT: Wie gehen Sie damit um, dass werden hier somit auf besondere Weise nicht jedes Jahr kommen, aber dennoch in allen Stimmgruppen noch zu erhö- aber die Pausengestaltung wird sich
angeblich im Bayreuther Festspielor- verbunden. in regelmäßigen Abständen im Fest- hen. Leider haben sich in den vergange- von den Vorjahren unterscheiden. Die
chester die wenigsten Frauen zu fin- spielorchester spielen. Die Herausfor- nen Jahren in sieben von 17 Stimmgrup- gastronomische Situation ist in diesem
den sind? Aber das ist nicht mehr so verbreitet derung, besonders bei der Diensteintei- pen überhaupt keine Frauen beworben. Jahr verändert und an die coronabe-
KATHARINA WAGNER: Es sind meiner wie früher? lung besteht dann gerade darin, erfahre- Es scheint leider immer noch typische dingten Vorgaben angepasst. Es muss
Meinung nach leider immer noch viel zu Die Gesamtsituation der Musikerinnen ne und neue Kräfte paritätisch zu ver- „Männerinstrumente“ zu geben, dies besonders flexibel zugehen, zumeist
PICTURE ALLIANCE/DPA/NICOLAS ARMER
wenige Frauen auch bei uns im Orches- und Musiker hat sich insoweit deutlich teilen. Die Musikerinnen und Musiker spiegelt sich auch an den Hochschulen draußen, mit Zelten oder Picknick. Es
ter, im Vergleich zu den anderen Spit- verändert, als es immer mehr Festivals müssen die kräftezehrenden Wagner- wider. In diesem Sommer freuen wir uns wird also ein wenig Glyndebourne-Fee-
zenklangkörpern allerdings auch nicht gerade auch im Sommer und an den Opern zum einen beherrschen, zum an- sehr auf zwei neue Hornistinnen und ling in Bayreuth geben.
weniger. Darüber hinaus haben wir in Stammhäusern gibt. Als Beispiel sei hier deren müssen alle mit der besonderen voraussichtlich auch zwei neue Kontra-
Bayreuth aber eine besondere Situation. die Bayerische Staatsoper mit den Akustik in diesem Orchestergraben zu- bassistinnen. Wir konnten dort, wo Va- Kommt denn Angela Merkel ein letz-
Opernfestspielen genannt, die alljähr- rechtkommen. Das Zusammenspiel von kanzen bestanden, in diesem Jahr mehr tes Mal als Kanzlerin?
Warum? lich bis Ende Juli stattfinden und nicht Bayreuth-erfahrenen Musikerinnen und Frauen als in den Vorjahren für die Fest- Darüber liegen mir noch keine Angaben
Das Festspielorchester spielt nur zur selten großes Opern- und Konzertre- Musikern und Bayreuth-Novizen und - spiele gewinnen. Hätten alle Musikerin- vor, das wird wahrscheinlich erst zu ei-
Festspielzeit, eben diese ist für gewöhn- pertoire mit ebenso großen Besetzun- novizinnen führt zu einem einzigartig nen, die wir ansonsten noch angefragt nem späteren Zeitpunkt von ihr ent-
lich allerdings auch die Urlaubszeit der gen umfassen. Somit werden Freistel- disziplinierten, konzentrierten und gut haben, zugesagt, läge der Frauenanteil Festivalchefin Katharina Wagner schieden werden.
Eine endlose Schleimspur
D
Jedes soziale Netzwerk ist ein Teufelszeug, aber Facebook oder Twitter haben auch ihr Gutes. LinkedIn jedoch bringt das Schlechteste im Menschen zum Vorschein
ie sozialen Netzwerke sind, das harmloser Weise darum, den Lebensstil tungen und dem „Handelsblatt“. Echte Der heillosen Konfrontation bei on, Purpose, Impact, CO2-Kompensati- Das geht so: Sie wenden ihre guten Sei-
wird man ja noch sagen dürfen, zu zeigen, die Urlaube und das Essen, Zeitungen nennen Autokraten Autokra- Twitter und der heillosen Banalität der on und liefern atemberaubende Beweise ten dem Geldschwein zu und verdecken
Werkzeuge des Teufels, und zu- das man „genießt“. Die Gefahr, hier ten und Lügner Lügner. Das „Handels- Freizeitnetzwerke steht hier die heillo- in Form großer Zahlen, die kein Mensch ihre Schwachstellen. Jeder schwätzt ir-
gleich sind sie auch, das wird man ja fortlaufend das depressive Innere mit blatt“ singt auf einer Doppelseite das se Schleimerei entgegen. Man dankt nachvollziehen kann. gendwas, was dem Geldschwein gefällt.
noch sagen dürfen, heilsam, zum Bei- schöngefärbten Selfies an extravagan- ungetrübte Loblied der Türkei, nur weil nach oben und strahlt nach unten. Per- Ein Unternehmen mit ein paar Tau- Das schwillt vor lauter Stolz immer
spiel in den Diktaturen, in denen sie ten Orten gewissermaßen photoshop- die Inflationsrate ein wenig zurückgeht. manentes Lob der Exzellenz und Dyna- send Mitarbeitern, die dem LinkedIn- mehr an. Am frühen Morgen platzt es
noch nicht verboten wurden. Jeder Ka- pen zu wollen, liegt auf der Hand. LinkedIn ist ein Wirtschaftsnetz- mik der eigenen Institution und ihrer Kanal des Unternehmens selbstver- dann, liegt in tausend Scherben da. Die
nal, der freie wahre Worte ermöglicht, Bei Instagram musste man plötzlich werk. Und pars pro toto dafür, was das führenden Vertreter gehört zum guten ständlich enthusiastisch folgen, er- Spielsachen drehen sich wieder um, die
ist dort in dem Maß gut, in dem sich auch noch tanzen, um zu zeigen, wie le- mit uns Menschen macht, fiel mir dieser Ton, wie auch das völlige Desinteresse reicht schnell eine Reichweite von ein Kinder wachen auf. Die Kinder wundern
dort mutige User finden. bendig und jung man heute ist. Bei Beitrag eines bedauernswerten „young an anderen Organisationen, wie auch an paar Tausend Leuten, zuzüglich der Ti- sich, warum das Geldschwein in Scher-
Twitter demonstrieren überreizte Aka- professional” aus meinem Netzwerk derjenigen, für die man noch gestern melines weiterer zehntausend Linke- ben liegt, und stellen das nächste
VON JAN GROSSARTH demiker aus dem Bereich Politik-Me- auf. Er hatte wohl eine Karrierestufe ge- „schaffte“ und all seine ,,passion“ dar- dIn-Bekannter (die diesen Content voll- Schwein auf.
dien-Lobby ihren elaborierten Ver- nommen und ließ sein Netzwerk daran gebracht hatte, und die schon heute in ständig desinteressiert wegrollen). Aber Das alte Geldschwein ist über Nacht
Der Teufel, der die Digitalisierung stand, und sie kämpfen für ihre hoch- teilhaben: „I am delighted to share after totale Vergessenheit geraten ist. Ein Be- das ergibt ein paar Zehntausend Views. total uninteressant geworden. Was na-
ebenfalls mag, verfolgt in den sozialen moralischen Anschauungen, was immer some insightful six months”, lässt der kannter, der jahrelang den Content sei- Und dann sagt man: Das bringt exzel- türlich das Schicksal der Posts ist und
Netzwerken nach seiner altvertrauten schiefgeht und zu heillosem Missverste- „young professional” in seinem Post ner Beratungsfirma geteilt hatte, tat das lenten Case Use! Wieso eigentlich dann ihrer Verfasser, und vor allem derjeni-
Art die Absicht, die Menschen auf hen führt, weil dafür nur zwei Sätze wissen. Es geht um eine Versetzung, nach seinem Arbeitgeberwechsel nie noch kritischen Journalisten Interviews gen, an welche die Posts gerichtet sind.
Schleimspuren ihrer selbst oder ihrer Platz sind. Clubhouse ist im Grunde von B. nach Br., womöglich ein Karriere- wieder. geben? Die Social-Media-Kommunikati- Der „young professional“ ist nur ein
schlauen Ansichten zu locken, damit sie dasselbe, aber mit menschlicher Stim- sprung. Nicht nur ,,young professionals“, on wird zum großen Erfolg. Nämlich Spielzeug, aber wenn er sehr fleißig ist,
auf ihrem Schleim fortrutschen, mit un- me, doch es bietet eine gewisse Diskre- Der ,,young professional” führt wei- sondern ganze Unternehmen und Kon- messbar. wird er eines Tages zu einem echten
bemerkt zunehmender Geschwindig- tion und wohltuende Vergänglichkeit ter aus: ,,I am very much looking for- zerne rutschen auf die Schleimspur und Nur in LinkedIn demonstriert die Geldschwein heranreifen.
keit, und irgendwie nicht mehr zum Ur- des Wortes. ward”, „working with my excellent col- leiten, weil es so gut gefällt, ihr gesam- schöne Welt der Erwachsenen, dass sie Es gibt allerdings auch ganz andere
sprung zurückfinden. Im Ursprung ist Das widerwärtigste aller Netzwerke leagues”, und „I highly appreciate this tes Budget für Marketing und PR auf die wirklich so ist, wie im Märchen „Das Unternehmenskulturen. Bloß dort, wo
das Interesse, das Ende ist das Erkannt- aber ist LinkedIn. Hier verbindet sich opportunity as an occasion to grow, to LinkedIn-Schiene um. Das ist bequem Geldschwein“ von HC Andersen bereits die „Arroganz der Apparate“ (Jürgen
Haben. So macht er das schon lange, das Banale (zeigen, wer man zu sein learn and to actively shape […] tomor- und messbar erfolgreich. Sie unterhal- dargelegt wurde. Das ist allgemein et- Kuhlmann, 1984) Überhand gewinnt, ist
und deswegen hat der Teufel jetzt auch vorgibt) auf besondere Weise mit dem row’s industry”. Viele, darunter auch ten technisch aufwendige YouTube-Ka- was unbekannt und geht so: Die Kinder es wie mit dem Geldschwein. Um das zu
die sozialen Netzwerke entsprechend Finanziellen (Netzwerk). Anders als Ältere, überschreiben ihr Profil mit näle, auf denen Greenwashing in Dauer- legen sich schlafen. Auf dem Tisch des erkennen, bevor man sich dort bewirbt,
programmiert. über alle anderen Netzwerke kann man ,,passionate about“ und fügen an, was schleife gesendet wird. Lebhaft gestiku- Kinderzimmers steht das prall gefüllte ist es wichtig, regelmäßig in sein Linke-
Jedes Netzwerk kann aber auf andere sagen, LinkedIn bringt wirklich niemals sie in ihrer Funktion gerade tun. ,,Pas- lierend und mit demonstrativem Enga- Sparschwein. Die Spielsachen und Bil- dIn-Profil zu schauen. Der Teufel heißt
Art Teufelszeug sein. Bei Facebook, dem etwas Gutes hervor. Es ist im Grunde sionate about marketing“, ,,passionate gement, flöten Manager, extrem ,,pas- der an der Wand sagen in der Nacht: ja deshalb Luzifer, weil er die Dinge ans
mildesten dieser Medien, ging es in wie der Vergleich zwischen echten Zei- about sustainability“. sionate“, süße Melodeien von Innovati- Kommt, jetzt spielen wir Erwachsene! Licht bringt.
© WELTN24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exclusiv über https://www.axelspringer-syndication.de/angebot/lizenzierung11.3.2021 https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/475131/24-25
Donnerstag, 11.03.2021, Tagesspiegel / Kultur
Bundeskultur- ministerium stößt auf
Ablehnung
Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) lehnt ein Bundeskulturministerium ab.
„Es gibt wichtigere Themen“, sagte Brosda zu der am Anfang der Woche in der „SZ“ er-
hobenen Forderung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) nach einem ei-
genständigem Ministerium. Bislang ist Grütters’ Ressort an das Kanzleramt angebun-
den. Im Deutschlandfunk betonte Brosda am Mittwoch, statt neuer Strukturen sei eine
Verständigung notwendig, wie die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommu-
nen bei der Kulturförderung besser werden könne. Dies zu organisieren, sei eine Auf-
gabe, der sich die Kulturpolitik stellen müsse. Aber solche Prozesse funktionierten
nicht so gut, wenn sie mit dem Anspruch anfingen, eine Seite mächtiger zu machen,
sagte Brosda. Der Bund beanspruche mit dem Ministerium die Zuständigkeit in einem
Bereich, in dem 16 Bundesländer nach der Verfassung ihren eigenen Auftrag sähen. Mit
einer Debatte über ein Bundeskulturministerium seien immer Hoffnungen verbunden,
die sich dann doch nicht realisieren ließen, sagte Brosda. Er habe sehr viele Themen auf
dem Zettel, die vordringlicher seien. epd
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/475131/24-25 1/1Sie können auch lesen