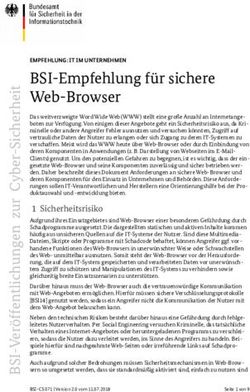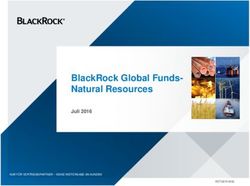PRESS REVIEW Thursday, September 10, 2020 - Daniel Barenboim Stiftung Barenboim-Said Akademie & Pierre Boulez Saal
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
PRESS REVIEW
Daniel Barenboim Stiftung
Barenboim-Said Akademie & Pierre Boulez Saal
Thursday, September 10, 2020PRESS REVIEW Thursday, September 10, 2020 Frankfurter Allgemeine Zeitung Geglückte Ost-West-Vereinigung. Die Staatskapelle Berlin feiert mit Daniel Barenboim Jubiläum Der Tagesspiegel Deutsche Oper Berlin muss weitere Premieren verschieben Der Tagesspiegel Vulkanisch. Igor Levit spielt Beethoven in der Philharmonie Deutschlandfunk Kultur Musikfest Berlin: Rebecca Saunders und das Schlagzeug Der Tagesspiegel Tränen und Trost. Riccardo Chailly und Scala Orchester gedenken Corona Toten in Bergamo The New York Times An operatic innovator takes on Detroit. Yuval Sharon will lead Michigan Opera Theatre Der Tagesspiegel Art-Week diskutiert Inklusion und Dekolonisierung Süddeutsche Zeitung Echo des vergoldeten Zeitalters. Metropolitan Museum öffnet wieder Frankfurter Allgemeine Zeitung Wir bewundern andere Meister! Heftige Proteste gegen Besetzung an Budapester Theateruniversität
Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465463/11
F.A.Z. - Feuilleton Donnerstag, 10.09.2020
Geglückte Ost-West-Vereinigung
Weiblicher und bunter: Die Staatskapelle Berlin feiert mit Daniel
Barenboim ihr vierhundertfünfzigjähriges Jubiläum
Das Berliner Staatsopern-Gebäude war nach 1945 schlimmer zerstört als das Schloss.
Aber das Schloss ist von Ulbricht abgerissen worden, die Oper nicht – und wissen
Sie, warum?“ – Matthias Glander, der Solo-Klarinettist der Staatskapelle, lehnt sich
einen Moment fast genüsslich zurück: „Weil Erich Kleiber klar angesagt hat, dass er
nur dann als Dirigent zurückkommt, wenn das in diesem Haus passiert!“ In diesem
Haus: Das ist die Lindenoper, ab 1741 im Auftrag Friedrichs II. durch Knobelsdorff
als weltweit erste frei stehende Musikbühne errichtet und bis heute der nobelste
Blickfang zwischen Brandenburger Tor und dem mittlerweile wiedererrichteten
Hohenzollern-Schloss. „In diesem Haus“ steht aber auch für Zuhause, Gemeinschaft
– eine Daseinsform, die man nicht rein intellektuell erlangen kann.
Der Hornist Thomas Jordans beschreibt sie so: „Es ist etwas Magisches in dem Bau
und in dem, was wir darin weitertragen. Man lebt natürlich nicht unentwegt im
Bewusstsein dieser Traditionen, aber wenn das wieder mal durch einen hindurch-
geht, kann es schon Gänsehaut machen: Mendelssohn, wie er die Kapelle dirigiert,
Kleibers ,Wozzeck‘-Uraufführung 1925. Manches ist ja auch schiefgegangen:
Wagner, der mit seinem ,Holländer‘ umsonst vor der Intendanztür stand, oder
Richard Strauss, der hier, obwohl schon Hofkapellmeister, von der ,Feuersnot‘ an
keine seiner frühen Opern zur Premiere bekam, weil der Kaiser was dagegen hatte.
Da hätte manches noch ganz anders laufen können – aber wenigstens Strauss hat
sich ja trotzdem bestens mit der Oper und dem Orchester arrangiert. In der Kapell-
geschichte gab es öfter so eine Art Phönix-Momente, wo alles schon am Boden schien
– und dann ging es doch wieder zum Neustart.“
Wenn Jordans solchermaßen in die Vergangenheit zurückwandert, hat das noch
einen anderen Klang als bei Glander, weil zwischen beiden fast eine ganze Generati-
on liegt. Als der Klarinettist 1983 zum Ensemble stieß, ging der Jüngere noch in die
Grundschule. 1996 trat Jordans dann seinerseits zum Probespiel an und wurde
aufgenommen – als einer der ersten erfolgreichen Absolventen der damals noch ganz
jungen Orchesterakademie, die seither über 180 Musiker in nationale und interna-
tionale Klangkörper „entlassen“ hat. Dreißig davon sind, wie Jordans, in der Kapelle
geblieben: „Die Vorgeschichte dazu ging 1991 los, als das Jeunesses-Musicales-
Orchester hier in Berlin eine Arbeitsphase hatte und ich eher zufällig in eine ,Nuss-
knacker‘-Aufführung der Staatsoper geriet, wunderbar altmodisch mit Bühnen-
Schneegestöber und Rauschgold. Als ich da erlebt habe, wie die Musiker mit den
Tänzern zusammenwirken, was das an Reaktionsfähigkeit fordert, welche Aufregun-
gen damit verbunden sein können, war mir klar: Das ist das Richtige! – Und dass es
dann diese Akademie hier geworden ist, hat genau damit zu tun: weil man ziemlich
bald als Aushilfe mit in den Orchestergraben geht, auf die Bühnenakteure eingehen
muss und schneller flexibel wird als in allen Hochschuljahren zuvor. Es war genau
das, was ich wollte.“
1 von 2 09.09.2020, 20:13Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465463/11
So sitzen nun zwei Bläserkollegen zusammen, die zwar mit vierzehn Jahren Abstand
zum Orchester gekommen sind, aber beide ihr ganzes bisheriges Berufsleben hier
verbracht haben. Was, wie es aussieht, auch weiter so bleiben soll: „Wir alle sind
ziemlich eng verbunden, der Umgang ist fast familiär – und wenn es nottut, ist einer
für den anderen da. Das ist, wenn man sich umhört, nicht in jedem Ensemble so“,
sagt Glander, bei dem das Hineinwachsen in genau diese Formation als Ostrand-
Berliner – Qualität natürlich vorausgesetzt – geradezu naturgesetzlich wirkt. Der
Hornist dagegen ist Rheinländer und wurde auch musikalisch anders sozialisiert, mit
einem strafferen, kühleren Klang, wie er sich in den Jahrzehnten der beginnenden
Globalisierung bei vielen Orchestern ähnlich entwickelte. Den der Kapelle dagegen
hat er selbst einmal als „warm und rotgolden“ beschrieben, und so erlebt man ihn
auch als Hörer: dunkel gesättigte Streicher, ein schönes, dynamisch stufenlos aufblü-
hendes Bläserlegato, Intensität bis ins pianissimo hinein.
Es war auch dieser oft beschworene, nicht leicht beschreibbare „deutsche Klang“, der
Thomas Jordans nach Berlin zog: womöglich ein ungewolltes, aber in diesem
Ausnahmefall positives Ergebnis der internationalen Isolierung der DDR, weil der
globale Mainstream außen vor blieb und stattdessen ein Klang wiederaufgenommen
und konserviert wurde, wie er in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts
gepflegt worden war. Noch ein anderer entdeckte dieses Phänomen und war davon
begeistert: Daniel Barenboim, als er Anfang der neunziger Jahre in die wiederverei-
nigte deutsche Hauptstadt kam und bei seinem „Parsifal“-Dirigat einen Klang
wiederfand, den er längst verloren wähnte.
Den Boden dafür hatte vor allem Otmar Suitner bereitet, der nach dem einschnei-
denden Aderlass von 1961, als der Mauerbau die in West-Berlin wohnenden Musiker
von ihrem Arbeitsplatz abschnitt, die Fäden ebenso behutsam wie energisch neu
knüpfte und die historische Kontinuität wahrte.
Was seither aus dem Zusammentreffen Barenboims mit dem Orchester erwachsen
ist, wurde an vielen Stellen beschrieben. Fast drei Jahrzehnte währt diese Liaison
nun schon. Am Freitag feiert das Orchester unter Barenboims Leitung und in Anwe-
senheit des Bundespräsidenten sein vierhundertfünfzigjähriges Bestehen. Dabei ist
die Staatskapelle inzwischen internationaler und weiblicher geworden. Jiyoon Lee
aus Südkorea, die 2017 Erste Konzertmeisterin wurde und von der beide Gesprächs-
partner gleichermaßen schwärmen, steht für beides und außerdem dafür, dass die
Identität des Orchesters und seines besonderen Klanges durch solche Öffnungen
keineswegs in Frage gestellt wird. Dabei hilft, was Glander das „Zwei-Schlüssel-Prin-
zip“ nennt: bei jeder Neuverpflichtung müssen sowohl der Chef als auch das Ensem-
ble zustimmen – ohne einen von beiden wird nichts daraus. Und es braucht auch die
Neigung zum Zusammengehen mit Sängern, die Bereitschaft, sensible Stimmen zu
tragen, zum Leuchten zu bringen – denn nach wie vor spielt sich der Großteil der
Dienste, unerachtet der Konzertzyklen von Beethoven bis Mahler und prägender
Plattenaufnahmen, auch abseits der Oper, im Orchestergraben der Lindenoper ab.
Das war im Prinzip schon am Beginn so: Die 1570 gegründete Brandenburgische
Hofkantorei zählte in ihren ersten Jahrzehnten mehr Sänger als Instrumentalisten.
Ein Vorzeichen? – Wenn ja, dann ein gutes. Gerald Felber
2 von 2 09.09.2020, 20:13Firefox https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/470739/22-23
Deutsche Oper Berlin muss weitere Premieren verschieben
Während Intendant Dietmar Schwarz und sein Team weiter darauf hoffen,
dass am 27. September wie geplant die Premiere von Richard Wagners
„Walküre“ stattfinden kann, hat die Deutsche Oper jetzt bekanntgegeben,
dass die Premiere von Giuseppe Verdis „Simon Boccanegra“, die für den 22.
November 2020 angekündigt war, auf die Saison 2022/23 verschoben
werden muss. Einen neuen Termin gibt es auch für das „Rheingold“, das
zunächst Mitte Juni geplant war und dann wegen der Pandemie abgesagt
werden musste: Der Auftakt zum neuen „Ring des Nibelungen“ wird unter der
musikalischen Leitung von Donald Runnicles und in der Regie von Stefan
Herheim nun am 12. Juni 2021 nachgeholt. Die für diesen Tag Tag
angekündigte Premiere von Beethovens „Fidelio“ wird in die Saison 2022/23
verschoben. Tsp
1 von 1 09.09.2020, 19:19Firefox https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/470739/20-21 1 von 2 09.09.2020, 19:12
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/470739/20-21 2 von 2 09.09.2020, 19:12
KONZERT | Beitrag vom 08.09.2020 Musikfest Berlin: Rebecca Saunders und das Schlagzeug Mit Mikrostrukturen große Klang- Räume schaffen Moderation: Olaf Wilhelmer Beitrag hören Viele Ideen, viele Noten: der Komponistin Rebecca Saunders, Jahrgang 1967, ist ein Schwerpunkt des Berliner Musikfestes gewidmet. (Astrid Ackermann / Berliner Festspiele) Aus der Not eine Tugend, aus großbesetzten Stücken Kammermusik machen: Rebecca Saunders zeigt, wie es geht. Der britischen Komponistin ist ein Schwerpunkt des Berliner Musikfestes gewidmet. Ein Schlagzeugabend mit Christian Dierstein und Dirk Rothbrust. Eigentlich. Dieses Wort steht wie ein mahnendes Zeichen über der jetzt beginnenden Saison in Deutschlands Konzert- und Opernhäusern. Eigentlich hätte dieses gespielt werden sollen, stattdessen erklingt jenes. Eigentlich ist das Musikfest Berlin eines der international wichtigsten Orchesterfestivals, das unter der Flagge der Berliner Festspiele und der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin alljährlich zum Saisonauftakt die Berliner Orchester mit den großen internationalen Klangkörpern zusammenbringt.
Kontinuität trotz Corona Und so hätte – eigentlich – an diesem Abend das Orchester der Lucerne Festival Academy anreisen sollen, was schon deswegen nicht möglich war, weil auch die Aktivitäten in Luzern in diesem Sommer auf ein Minimum reduziert worden waren. Immerhin, das Konzert findet statt, Christian Dierstein und Dirk Rothbrust sind wie geplant die Solisten, und auch in der Corona-Version ist dieser Abend der britischen Komponistin Rebecca Saunders, Jahrgang 1967, gewidmet. Sie erhielt im vergangenen Jahr eine der renommiertesten Auszeichnungen der Musikwelt, den Ernst-von Siemens Musikpreis. Die Berliner Philharmonie als Perkussionslabor: Dirk Rothbrust (li.) und Christian Dierstein bei ihrem Konzert im Rahmen des Berliner Musikfests (Monika Karczmarczyk / Berliner Festspiele) Aus ihren groß besetzten Schlagzeugwerken – „Dust“ existiert in einer Version für sechs Schlagzeuger, „Void" ist für Schlagzeugduo und Orchester gedacht – hat Saunders nun zwei reine Schlagzeugduo-Kompositionen gemacht. Die Vielzahl an Perkussionsinstrumenten und Spieltechniken ist eine solche Welt für sich, dass der Verlust zu verkraften ist, zumal wenn die Bühne von zwei so großartigen Virtuosen wie Dierstein und Rothbrust bespielt wird, die seit Jahren eng mit der Komponistin zusammenarbeiten. Magie und Mikroorganismus Während das rund 20-minütige „Void“ als Bild der Leere eine räumlich weite Musik beschwört, scheint das gut 40-minütige „Dust“ – „Staub“ – eher ins Mikroorganische
hineinzuhorchen, und so beginnt das Werk mit feinstem Reiben und Knirschen, um in
weit ausschwingenden Resonanzen von Kristallklangschalen zu münden, die den
ganzen Saal erfassen. Gedanklicher Hintergrund beider Werke sind die magisch-
hermetischen Textwelten von Samuel Beckett, die allerdings nicht zitiert, sondern
gleichsam nur gedacht werden.
Deutschlandfunk Kultur ist Partner des Musikfestes Berlin und dokumentiert auch in
diesem Jahr, in dem – eigentlich – alles ganz anders hätte sein sollen, das Festival mit
einer Reihe von Konzertübertragungen in lockerer Folge.
Musikfest Berlin
Philharmonie Berlin, Aufzeichnung vom 07.09.2020
Rebecca Saunders
„Void II“ für Schlagzeugduo (Erstaufführung der neuen Fassung)
„Dust II“ für Schlagzeugduo (Erstaufführung der neuen Fassung)
Christian Dierstein, Schlagzeug
Dirk Rothbrust, Schlagzeug
ungenFirefox https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/470739/22-23 1 von 3 09.09.2020, 19:21
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/470739/22-23 2 von 3 09.09.2020, 19:21
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/470739/22-23 3 von 3 09.09.2020, 19:21
An Operatic Innovator Takes On Detroit - The New York Times https://www.nytimes.com/2020/09/09/arts/music/yuval-sharon-michig...
09.09.2020, 19:49An Operatic Innovator Takes On Detroit - The New York Times https://www.nytimes.com/2020/09/09/arts/music/yuval-sharon-michig...
09.09.2020, 19:49An Operatic Innovator Takes On Detroit - The New York Times https://www.nytimes.com/2020/09/09/arts/music/yuval-sharon-michig...
09.09.2020, 19:49An Operatic Innovator Takes On Detroit - The New York Times https://www.nytimes.com/2020/09/09/arts/music/yuval-sharon-michig... 5 von 5 09.09.2020, 19:49
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/470739/20-21 1 von 2 09.09.2020, 19:16
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/470739/20-21 2 von 2 09.09.2020, 19:16
Firefox https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/794711/9 1 von 2 09.09.2020, 19:08
Firefox https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/794711/9 2 von 2 09.09.2020, 19:08
Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465463/11
F.A.Z. - Feuilleton Donnerstag, 10.09.2020
Wir bewundern andere Meister!
Heftige Proteste gegen die regierungsnahe Besetzung an der Budapester
Theateruniversität / Von Stephan Löwenstein, Wien
In Ungarn tobt seit Wochen eine Art Kulturkampf. Anlass ist ein Führungsstreit um
die Budapester Universität für Theater- und Filmkunst (SZFE). Dozenten und
Studenten protestieren dagegen, dass ihre Hochschule in eine Stiftungskonstruktion
überführt wurde, an deren Kuratoriumsspitze der Direktor des Nationaltheaters
steht, Attila Vidnyánszky. Er gilt als Gefolgsmann von Ministerpräsident Viktor
Orbán. Der bisherige Direktor der Hochschule, Gábor Zsámbéki, hat als Reaktion auf
die neue Führungsstruktur schon Anfang August gekündigt, ihm folgten mehrere
namhafte Regisseure und Schauspieler, die an der SZFE unterrichteten, und schließ-
lich der gesamte Senat. Studenten haben die Universität „besetzt“. Zuletzt demons-
trierten Tausende mit einer Menschenkette zwischen Hochschule und Parlament.
Der Protest findet auch internationale Resonanz. Ungarische Teilnehmer erschienen
in Venedig auf den Filmfestspielen mit „Free SZFE“-T-Shirts. Ein Brief für die
„authentische Führung“ (also die frühere) der SZFE wurde von drei Dutzend
vornehmlich britischen Künstlern unterzeichnet, darunter die Schauspielerinnen
Helen Mirren und Cate Blanchett sowie der Schriftsteller Salman Rushdie. Das Berli-
ner Ensemble sagte ein Gastspiel in Budapest ab, das für nächstes Jahr auf einem
Festival unter der Ägide Vidnyánszkys geplant war.
Für die Regierung kommt das möglicherweise unerwartet. Denn eingestielt wurde
die neue Struktur für die SZFE im Mai dieses Jahres, als niemand von Theater und
Filmkunst redete, sondern alle nur von Corona. Seit Verabschiedung des Etats im
Juni ist die Sache eigentlich in trockenen Tüchern. Aber es geht längst um mehr als
die Theaterhochschule. Die seit zehn Jahren regierende nationalkonservative Partei
Fidesz versucht nicht nur die Politik im engeren Sinne zu bestimmen, sondern es ist
auch ein erklärtes Ziel Orbáns und seiner Leute, das zu brechen, was sie in Medien,
Kultur und Universitäten als linksliberale „Diktatur“ empfinden („Wessen Diktatur“
hieß eine Serie vor zwei Jahren in dem Fidesz-treuen Blatt „Magyar Idők“). Die
einzelnen Scharmützel dieses Kulturkampfes finden mal leiser, mal lauter statt.
Eines der ersten hatte bereits mit Vidnyánszky zu tun. Er ersetzte 2013 als Direktor
des Nationaltheaters Róbert Alföldi, der für alles stand, was die rechten Kulturrevo-
lutionäre Orbáns verabscheuen: links, internationalistisch, schwul. Vidnyánszky, der
der ungarischen Minderheit in der Ukraine entstammt, kündigte an, dass sein Thea-
ter künftig andere Botschaften aussenden werde: Tradition, die „ungarische Seele“
und die „ungarische Idee“. Vydnyánsky beherrschte binnen kurzem weitgehend die
ungarische Theaterlandschaft, er ist Präsident des Dachverbands und leitet die
entsprechende Fakultät an der Hochschule in Kaposvár. Allein auf die Budapester
Film- und Theateruniversität, geschützt durch die Hochschulautonomie, hatte er
nicht direkten Einfluss – bis jetzt. Der Austausch Alföldis schlug bereits relativ hohe
Wellen. Dabei erfolgte er immerhin regulär: Sein Fünfjahresvertrag war abgelaufen.
Vidnyánszky erhielt ebenfalls einen Vertrag über fünf Jahre, der inzwischen einmal
verlängert wurde. Alföldi, der seither von freien Engagements im In- und Ausland
1 von 2 09.09.2020, 20:18Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465463/11
lebt, kommentierte jetzt die Proteste gegen den Eigentümerwechsel bei der Theater-
hochschule und das Unverständnis des neuen Kuratoriums dafür: „Wir haben die
Vorführungen anderer Meister bewundert, wir sind mit einer anderen Theaterkultur
aufgewachsen, wir haben eine andere Theatervergangenheit. Wir verstehen etwas
anderes unter Theater, ich wage zu sagen: unter gutem Theater.“
Ebenfalls im Licht von Orbáns Kulturkampf lassen sich Vorgänge sehen, bei denen es
aber auch um direkte machtpolitische Auseinandersetzungen geht: der wirtschaftli-
che Druck gegen regierungskritische Medien, von denen einige inzwischen „umge-
dreht“ wurden, oder das Vorgehen gegen die private Hochschule CEU, finanziert
durch den Milliardär George Soros. Die ungarische Akademie der Wissenschaften
wurde im vergangenen Jahr unter Druck gesetzt, bis sie einer Struktur zustimmte,
auf die die Regierung mehr Einfluss hat. Auch jetzt geht es nicht nur um die Film-
und Theaterhochschule: Insgesamt sieben Hochschulen sollen in Stiftungskonstruk-
tionen überführt werden, bei denen die Kuratorien von der jetzigen Regierung
besetzt werden. So soll die angestrebte neue, nationale und konservative Hegemonie
offensichtlich abgekoppelt werden von den Zufällen politischer Zeitläufte.
Lässt man politische und kulturelle Geschmacksfragen beiseite, so wird man immer-
hin zugestehen können, dass Orbán sich hier als ein gelehriger Schüler der alten
kommunistischen, später linksliberal gewendeten Eliten erweist. Dass die sich zum
Teil in Kultur und Medien nach der Wende in Positionen gehalten haben, von denen
aus sie eine Lufthoheit über den öffentlichen Diskurs behielten, hat es nicht nur in
Ungarn gegeben. Einen Ausweis der spiegelbildlich gleichen Denkweise hat jetzt
ausgerechnet der frühere Regierungschef und Orbán-Intimfeind Ferenc Gyurcsány
(früher Sozialist, heute Linksliberaler) erbracht. Er beschimpfte Vidnyánszky als
Parteisoldaten, der sich nur so lange halten werde wie Orbán selbst: Sobald der
gestürzt sei, würden diese Leute allesamt zu „Heimatlosen“, und zwar „in jeder
Hinsicht“. Für das Regierungslager war das ein gefundenes Fressen, es mobilisierte
aus dem Stand 300 ihm zugeneigte Künstler, die eine Protestpetition gegen Gyurcsá-
ny unterzeichneten.
Aber für ungarische Konservative sollte all das eigentlich nicht ein Grund sein, sich
noch unnachgiebiger in ihre Kulturrevolution treiben zu lassen. Denn die nimmt
bisweilen bereits bedrückende Züge an. Die oben erwähnte Artikelserie von „Magyár
Idök“ erinnerte in ihrer denunziatorischen Art, die nicht zuletzt vermeintliche
Abweichler aus den eigenen Reihen anprangerte, an die unselige Praxis von „Kritik
und Selbstkritik“ aus ganz anderen Zeiten.
2 von 2 09.09.2020, 20:18Sie können auch lesen