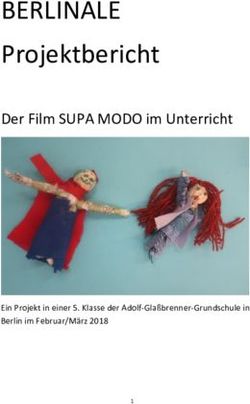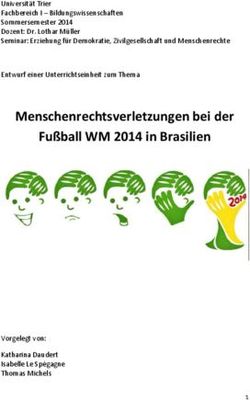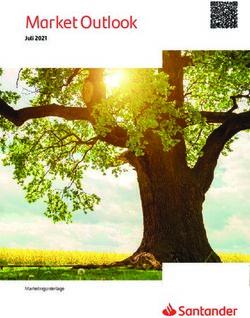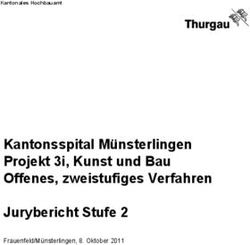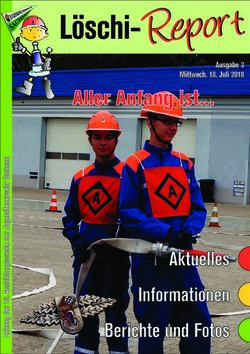Söhne der Erde FWU-Klassiker - FWU - Schule und Unterricht
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
FWU – Schule und Unterricht
DVD 46 02454 / VHS 42 01719 21 min, Farbe
FWU-Klassiker
Söhne der Erde
FWU – ®
das Medieninstitut
der Länder
00Lernziele – Natur die Weißen in den Untergang führt.
nach Lehrplänen und Schulbüchern Diese Prophezeiung hat nach wie vor eine
Eingeführt werden in den Zusammenhang von Brisanz und Aktualität, die immer dringen-
Glauben und Handeln. Erkennen, dass die Reli- der zu werden scheint.
gion eine wesentliche Voraussetzung für den
Menschen darstellt, für die Art und Weise, an
die Welt heranzugehen. Die Gefahr der Umwelt-
zerstörung durch den Menschen erkennen und Ergänzende Informationen
seine Verantwortung für die Erhaltung der
Natur verstehen. 1. Ein Film und seine Geschichte
Der Film bringt dem Betrachter folgende Si-
Zum Inhalt tuation nahe: Ein Indianerhäuptling richtet
eine Rede an einen US-Präsidenten, der Ver-
1853/54 teilt der amerikanische Präsident treter eines untergehenden Naturvolkes
Franklin Pierce durch seinen Gouverneur spricht zu dem Repräsentanten der moder-
Stevens dem Stamm der Duwamish-Indianer nen, siegreichen Zivilisation. 1855 soll das
mit, dass er deren Land zu kaufen gedenke. geschehen sein. Der Indianerhäuptling
Die damals angeblich gehaltene „Rede“ des Seattle (in ursprünglicher Form lautete sein
Häuptlings Seattle, die dem Film zugrunde Name wohl „Seeathl“) musste damals tat-
liegt, ist tatsächlich 1969/70 entstanden und sächlich massivem Druck nachgeben und
stammt von dem Amerikaner Ted Perry, der das im Nordwesten der heutigen USA gele-
sich darin auf eine 1887 von Henry A. Smith gene Gebiet seine Stammes, der Duwamish,
veröffentlichte Rede von Seattle bezieht, den „Weißen“ überlassen. Doch Seattle ver-
diese aber in dichterischer Freiheit ergänzt teidigt sein Land erhobenen Hauptes: Er
und verändert hat. rechnet mit ihnen und mit ihrer Zivilisation
in einer Rede von hoher Poesie ab. Um die
Der Text des Filmes vergleicht das Lebens- Unterschiede zwischen dem „roten Mann“
und Naturverständnis der Indianer und der und dem „weißen Mann“ geht es darin. Für
Weißen. Für den Indianer ist die Natur „hei- sein Volk ist „die Erde unsere Mutter“. Des-
lig“, weil Gott in ihr lebt. Darum kann der halb gehört ihm der Boden nicht. Vielmehr
Mensch – in der Sicht des „roten Mannes“ – ist ihm „jeder Teil dieser Erde heilig“. Der
nicht beliebig in ihre Zusammenhänge ein- „Weiße“ hingegen meint, ihm gehöre die Er-
greifen. Bäume, Tiere und Menschen sind de und er könne mit ihr tun, was er will.
Geschöpfe. Alles ist miteinander verbunden. Seattle: „Er behandelt seine Mutter, die Er-
Diesem Geheimnis kann der Mensch nur mit de, (...) wie Dinge zum Kaufen und Plündern
Achtung und Ehrfurcht begegnen. Im Unter- ... Sein Hunger wird die Erde verschlingen
schied dazu ist der„weiße Mann“ ohne Res- und nichts zurücklassen als eine Wüste.“
pekt vor der Natur: „Die Erde ist sein Bruder Hat Seattle die weltweite Umweltkrise, die
nicht, sondern sein Feind.“ So sind diejeni- zweifellos eine Folge der westlichen Zivilisa-
gen, die in den Indianern wilde „Barbaren“ tion darstellt, vorausgesehen? Der Indianer
sehen, selbst Barbaren, weil sie die Natur Seattle als ökologischer Prophet? Nur zu
missachten. Der Autor des Textes befürch- gern wollte man dies – vor allem in der welt-
tet, dass diese Barbarei im Umgang mit der weiten Ökologiebewegung – glauben. Der
21971 in den USA produzierte Film „Home“, Indianer wortgetreu zitiert, nicht mehr klä-
der der deutschen Version „Söhne der Erde“ ren. Wer jene „Urfassung“ der „Seattle“-Re-
zugrundeliegt, erweckt den Eindruck, „Chief de von 1887 mit dem Text von Perry ver-
Seattle“ habe diese Rede so im Jahr 1855 gleicht, der wird leicht erkennen, wo und
gehalten. Gleiches gilt für die weit verbrei- wie Perry seine Vorlage erweitert und ver-
tete Buchversion jener Rede. Inzwischen ist ändert hat. (Vgl. dazu Kaiser, aaO, S. 75–92!)
bekannt: In ihrer heutigen Form stellt Dabei sind Ted Perry einige Fehler unterlau-
Seattles Rede eine Fiktion dar. Der Amerika- fen, die den fiktiven Charakter seines Textes
ner Ted Perry, der für die Southern Baptist erkennen lassen. So fuhren in den Jahren
Convention den Filmtext für den Film 1853/54 noch keine Züge durch die Prärie.
„Home“ geschrieben hat (um dessen leicht Das sinnlose Abschlachten der Büffel erfolg-
gekürzte Fassung es sich beim vorliegenden te erst ab 1860.
Film „Söhne der Erde“ handelt), hat diese
Rede 1969/70 verfasst. In einem Brief aus Immerhin besteht fast wörtliche Überein-
dem Jahr 1983 an den deutschen Anglisten stimmung in einer zentralen Stelle: „... die-
und Indianerexperten Rudolf Kaiser bekennt ser Boden ist uns heilig ...“, heißt es bei Ted
Perry: „So schrieb ich eine Rede, die fiktiv Perry. „Jeder Teil dieses Landes ist meinem
war... Dabei unterlief mir jedoch der Fehler, Volke heilig“, lautet dies bei Smith.
dass ich Chief Seattles Namen im Text be-
nutzte“ (R. Kaiser: Die Erde ist uns heilig, 2.Fälschung oder Fiktion?
S. 71). Der Eindruck, der Film „Home“ basiere Ein wichtiger Unterschied
auf einer tatsächlich gehaltenen Rede
Seattles, geht darauf zurück, dass im Film Als bekannt wurde, dass die Film-Version
nicht mitgeteilt wurde, von wem der Text von Seattles Rede so nicht von dem Duwa-
tatsächlich verfasst worden ist. Ganz frei mish-Häuptling gehalten wurde, gab es viele
hat Perry die Rede, wie Kaiser nachweist, je- Irritationen. Seattles Text war inzwischen so
doch nicht erfunden. Er „benutzte zu Beginn etwas wie ein viel zitiertes Manifest der
und zwischendurch Teile der Urfassung der Ökologiebewegung geworden. Es forderte
Rede Seattles" (Kaiser, aaO, S. 71). Diese „Ur- dazu auf, ein anderes, neues Verhältnis zur
fassung“ geht auf den Artikel eines Henry A. Erde zu gewinnen. Nun konnte diese Rede
Smith zurück, der 1887 in der Lokalzeitung unwidersprochen als Fälschung bezeichnet
„Seattle Sunday Star“ veröffentlicht wurde. werden. Das führte in Deutschland zu der
Smith beruft sich dabei auf – heute aller- Forderung, sowohl den Film „Home“ als
dings verschollene – Notizen, die er wäh- auch dessen gekürzte Fassung „Söhne der
rend einer Rede Seattles gemacht hat. Diese Erde“ aus dem Verkehr zu ziehen. Die Inter-
Rede hat der Häuptling beim Empfang des essen, die hinter einer solchen Forderung
neuen Gouverneurs Stevens aber schon stehen, könnten darauf abzielen, die Anlie-
1853 oder 1854 gehalten, nicht erst, wie der gen der Ökologiebewegung als illusionäre
Film glauben macht, im Jahr 1855, als in Naturromantik zu brandmarken. Deshalb ist
Point Elliott über den Landverkauf verhan- es wichtig, zwischen Fälschung und Fiktion
delt wurde. Smith erhebt nicht den An- zu unterscheiden. Als Fälschung können et-
spruch, Seattles Rede vollständig wiederzu- wa die angeblichen „Hitler-Tagebücher“ gel-
geben. Auch lässt sich die Frage, ob er den ten. Damit sollte die Öffentlichkeit ganz be-
3wusst in die Irre geführt werden. Eine Fik- einen Steinbruch für unseren Wohlstand an-
tion hingegen ist ein viel verwendetes Stil- sehen, mit einem ganz anderen Naturver-
mittel in der Literatur und auch in der Film- ständnis. Das ist eine Konfrontation, die be-
kunst: Um ein Gegenwartsproblem mit mehr wusst provozieren will.
Gewicht und auch mit einem gewissen Neu- Aus diesem Grund ist es gerade nicht sinn-
giereffekt auszustatten, wird es in die Ver- voll, diesen Film heute aus dem Verkehr zu
gangenheit zurückdatiert und auch gern ei- ziehen. Seine eindringlichen Bilder, die
nem prominenten Sprecher aus jener Zeit „Seattles“ fiktive Rede veranschaulichen,
gleichsam „in den Mund gelegt. Die Weltlite- machen ihn zu einem wertvollen Dokument
ratur – bis hin zu den heiligen Schriften vie- ökologischer Bildung und Schöpfungsspiri-
ler Religionen – arbeitet seit jeher mit dem tualität, das an Aktualität bis heute nichts
Kunstgriff der Fiktion. eingebüßt hat. Dabei ist es sicher ein Gebot
der Redlichkeit, bewusst auf den fiktiven
Dies sollte auch Ted Perry, dem eigentlichen Charakter jener Rede hinzuweisen und ihn
Verfasser der Filmtextes, zugebilligt wer- im anschließenden Unterrichtsgespräch
den. Es ging ihm zweifellos nicht um eine noch genauer zu erarbeiten. Das tut der
arglistige Täuschung. Er wollte die Men- Wahrheit ihrer Aussage nicht nur keinen Ab-
schen der westlichen Industriegesellschaft bruch, sondern lässt sie vielmehr noch deut-
mit einer – damals noch weithin unbekann- licher hervortreten.
ten – Herausforderung konfrontieren: mit
der durch den maßlosen Raubbau an der Na- 3. „Die Erde ist uns heilig“
tur bevorstehenden ökologischen Krise. Wer
aber in den 70er Jahren schon eine solche Sicher haben die Indianer bis zur Eroberung
Krise sich abzeichnen sah, der hatte es – im ihres Landes durch die Weißen nicht in einer
Unterschied zu heute – schwer, öffentlich paradiesischen Idylle vorbildlicher Natur-
Gehör zu finden. Vielleicht griff Perry des- Harmonie gelebt, wie es Perrys Text stre-
halb auf das Stilmittel der Fiktion zurück: ckenweise nahe legt. Diese Idealisierung der
Wie würde ein mit den Überlieferungen sei- Indianer zu „edlen Wilden“, die schon Rous-
nes Volkes vertrauter Indianer aus der Mitte seau mit seiner zivilisationskritischen Paro-
des 19. Jahrhunderts unsere heutige Situa- le „Zurück zur Natur“ vertrat, entspricht
tion sehen? Aus dieser Motivation heraus nicht den Tatsachen des harten Existenz-
könnte Ted Perry seinen Text, dem Rudolf kampfes der nordamerikanischen Indianer-
Kaiser durchaus „poetische Schönheit“ zu- stämme. Als Jäger, Sammler und Landbau-
billigt (aaO, S. 72), verfasst haben. Seine ern führten sie ein mühsames Leben, das
Vorlage, die „Smith-Fassung“ der Rede, ge- der Natur einen – für unsere Maßstäbe –
stattete es ihm, die überlebenswichtige öko- kärglichen Unterhalt abgerungen hat. Für
logische Thematik der Gegenwart in die Ver- sie wie andere Naturvölker der Erde spielt
gangenheit zurückzuverlagern. Von einem die „Sakralität des Lebens“ (Mircea Eliade),
Volk, das davon ausgeht, dass ihm jeder Teil die „Heiligkeit der Erde“ (R. Kaiser) eine zen-
des Erdbodens heilig sei, müsse sich gerade trale Rolle. So bestand für steinzeitliche Jä-
heute viel lernen lassen. Das ist das Wahr- ger eine für uns kaum nachvollziehbare reli-
heitsmoment dieser Fiktion. Sie konfrontiert giöse Verbundenheit mit der Tierwelt. In den
unseren Umgang mit der Erde, die wir oft als Mythen vieler Jägerkulturen wird von einem
4„Herrn“ oder einer „Herrin der Tiere“ be- schied dazu hat die jüdisch-christliche wie
richtet, die das Wild schützen und entspre- auch die islamische Religion die Jenseitig-
chende Gebote erlassen. Diese Gebote hatte keit Gottes betont. Der Grund dafür lag u. a.
ein Jäger zu befolgen, wollte er mit einer in der Angst vor einem Rückfall in den Poly-
Beute belohnt werden. Beachtete er sie theismus, in den Glauben an viele (Natur-)
nicht, wurde er mit Misserfolg, Krankheit Götter. Die Betonung der Jenseitigkeit Got-
oder Tod bestraft. In ihren heiligen Erzäh- tes hat die Schöpfung „entgöttlicht“ und da-
lungen sprechen die Indianer von Tieren, die mit entzaubert. So wurde der Weg zur wis-
die Geschicke der Menschen bestimmen: senschaftlichen Erforschung der Welt und
von Adlern, Bären und Raben. Sie sind einer technischen Naturbeherrschung in der
Schutztiere (Totemtiere), denen die Men- Neuzeit frei. Dies wurde zunächst positiv als
schen etwa das Feuer, den Regen oder die gewaltiger Fortschritt gesehen. Nunmehr
Sonne verdanken. Man fühlt sich deshalb sind wir mit seinen negativen Folgen kon-
mit den Tieren verwandt. Bei dieser„Sakrali- frontiert. Die weltweite Zerstörung der na-
tät des Lebens" blieb es auch nach der Ent- türlichen Lebensgrundlagen durch die wis-
deckung des Ackerbaus: „Die religiösen Be- senschaftlich-technische Zivilisation be-
ziehungen mit der Tierwelt wurden durch ei- droht den Fortbestand der Menschheit.
ne gewissermaßen mystische Solidarität Die Wissenschaft selbst hat erkannt, dass
zwischen Mensch und Vegetation ersetzt“ die Natur ein „vernetztes System“ (Frederic
(M. Eliade: Geschichte der religiösen Ideen, Vester) darstellt, in dem Jedes mit Jedem
Bd. 1, S. 47). Für die Indianer bedeutete dies, zusammenhängt. Es geht nicht an, dass sich
im Einklang mit der Natur zu leben, ihr Ach- ein Teil der Natur, der Mensch, zum Maßstab
tung und Ehrfurcht entgegenzubringen. So des Ganzen macht und so das Gleichgewicht
schreibt Kaiser über die Hopi-Indianer: Die der Naturzusammenhänge stört oder gar
traditionelle Lebensform der Hopi-Indiander zerstört.
ist gekennzeichnet durch Bescheidenheit,
Demut, eine schlichte Lebensführung, Fleiß Die indianische Weltsicht drückt dies in ei-
bei der Pflege des Landes und sorgfältige ner„spirituellen Sprache“ aus, die Ted Perry
Beachtung der religiösen Zeremonien" (Die in seinem Text kongenial nachempfunden
Stimme des großen Geistes, S. 123). hat. Es geht ihm und anderen, die die Tradi-
tionen der Indianer wieder entdeckt haben,
Der Mensch steht hier nicht der Natur ge- sicher nicht darum, sie als ausschließliche
genüber, wie dies die jüdisch-christliche Lösung unserer ökologischen Probleme zu
Tradition (vor allem von 1. Mose 1,28 her: empfehlen. Aber sie können uns dabei hel-
„Machet euch die Erde untertan!“) gesehen fen, wieder mehr im Einklang mit der Natur
hat. Vielmehr ist der Mensch in indianischer zu leben. Es geht um eine neue, zeitgemäße
Sicht nicht Herr, sondern Teil der Natur. Schöpfungspiritualität, in der sich der
Deshalb begegnet er ihr mit tiefem Respekt. Mensch als Geschöpf neben und nicht über
Das hängt auch mit dem Gottesbild von In- anderen Mitgeschöpfen, als bescheidener
dianern zusammen: Gott wohnt für Indianer Teil dieser Erde sieht, die ihm heilig ist, weil
zumindest auch in der Welt, in der Erde, in in ihr ein Geheimnis lebt, das die religiöse
den Pflanzen und Tieren. Deshalb ist ihnen Sprache „Gott“ nennt.
„jeder Teil dieser Erde heilig“. Im Unter-
5Zur Verwendung
1. Schöpfungsverständnis und
Weltverhältnis
Der Film kann im Rahmen einer Behandlung
der alttestamentlichen Schöpfungsge-
schichte eingesetzt werden, um mit seiner
Hilfe Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen jüdisch-christlichem und indiani-
schem Schöpfungsverständnis zu erarbei-
ten. Was sagt er Menschen, die zwar keine
Indianer sind, aber achtsamer mit der
Schöpfung umgehen wollen? Wo gibt es Pa-
rallelen im Christentum (etwa Franz von
Assisi oder Albert Schweitzer)?
2. Ökologie und Umweltverantwortung
Der Film hat maßgeblich dazu beigetragen,
Menschen für die ökologische Frage sensi-
bel zu machen. Was hat sich zwischen 1971
und heute getan? Wie weit sind wir heute –
regional und weltweit – in Fragen der Ökolo-
gie und der Umweltethik? Was trägt der Film
nach wie vor dazu bei, hier unser Bewusst-
sein zu schärfen?
6Herausgabe und bearbeitete Fassung Begleitkarte
FWU Institut für Film und Bild, 2007 Dr. Hans-Joachim Petsch
Produktion Bildnachweis
International Radio&TeleVision Commission, Jim Miller – FOTOLIA
Fort Worth, Texas 1973 steyl-medien, München
Videokassette:
FWU Institut für Film und Bild, 1994 Pädagogischer Referent im FWU
DVD-Video: Peter Göpfert
FWU Institut für Film und Bild, 2007
Deutsche Fassung des Films Verleih durch Landes-, Kreis- und Stadtbildstellen,
Dedo Weigert Film, München Medienzentren
Verkauf durch FWU Institut für Film und Bild,
Regie
Grünwald
John C. Stevens
Nur Bildstellen/Medienzentren: öV zulässig
Kamera
Dedo Weigert Film, München
© 2007
FWU Institut für Film und Bild
in Wissenschaft und Unterricht
gemeinnützige GmbH
Geiselgasteig
Bavariafilmplatz 3
D-82031 Grünwald
Telefon (0 89) 64 97-1
Telefax (0 89) 64 97-300
1’7/6/07 Bau
E-Mail info@fwu.de
vertrieb@fwu.de
Internet www.fwu.de® FWU – Schule und Unterricht
■ 1:1 DVD-VIDEO 46 02454 DVD mit Kapitelanwahlpunkten
■ VHS 42 01719
FWU Institut für Film und Bild 21 min, Farbe
in Wissenschaft und Unterricht
gemeinnützige GmbH
Geiselgasteig
Bavariafilmplatz 3 FWU-Klassiker
D-82031 Grünwald Söhne der Erde
Telefon (0 89) 64 97-1 1855 teilt der amerikanische Präsident Franklin Pierce
Telefax (0 89) 64 97-300
E-Mail info@fwu.de dem Stamme der Duwamish-Indianer mit, dass er deren
Internet http://www.fwu.de Land zu kaufen gedenke. Der Häuptling Seattle antwor-
tet ihm meditativ. Ein Auszug dieses Antwortschreibens
zentrale Sammelnummern für liegt dem Film zugrunde. Bei diesem Film handelt es
unseren Vertrieb:
Telefon (0 89) 64 97-4 44 sich um eine Produktion aus dem Jahr 1994 (1973).
Telefax (0 89) 64 97-2 40
E-Mail vertrieb@fwu.de Schlagwörter
Indianer, Schöpfung, Umwelterziehung, Umweltschutz,
Kolonialismus, Naturverständnis, Naturreligion, Schöpfungs-
geschichte
Ethik
Konflikte und Konfliktregelung • Gesellschaftliche Konflikte
Geschichte
Epochen • Neuere Geschichte, Neuere Geschichte
außereuropäischer Staaten und Völker
Laufzeit: 21 min Religion
Kapitelanwahl auf DVD-Video Religiöse Lebensgestaltung • Grunderfahrungen, Wahrneh-
Sprache: Deutsch mung der Schöpfung
Systemvoraussetzungen Umweltgefährdung, Umweltschutz
bei Nutzung am PC Umwelt in Politik und Wirtschaft
DVD-Laufwerk und
DVD-Player-Software, Allgemeinbildende Schule (8–13);
empfohlen ab Windows 98 Berufsbildende Schule
Sonderschule
Kinder- und Jugendbildung (14–18)
GEMA
LEHR-
Alle Urheber- und
Programm Weitere Medien
Leistungsschutzrechte
vorbehalten. 42 00569 Der Wolf ist mein Bruder. VHS 59 min, f
Nicht erlaubte/ gemäß
genehmigte Nutzungen
werden zivil- und/oder § 14 JuSchG
strafrechtlich verfolgt.Sie können auch lesen