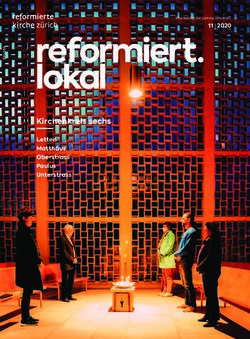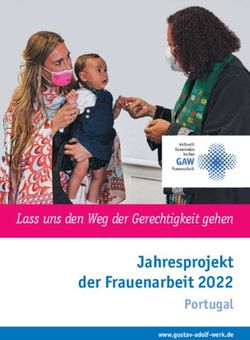Sozialwissenschaftliche Kompetenz für Kirche und Gesellschaft - 50 Jahre Sozialwissenschaftliches Institut der EKD
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gunther Schendel (Hg.)
im Auftrag des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD
Sozialwissenschaftliche Kompetenz
für Kirche und Gesellschaft
50 Jahre Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSozialwissenschaftliche Kompetenz
für Kirche und Gesellschaft
50 Jahre Sozialwissenschaftliches Institut der EKD
Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI)
Arnswaldtstraße 6, 30159 Hannover
Telefon 0511-554741-0
e-mail: info@si-ekd.de
Herausgeber:
Gunther Schendel, im Auftrag des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD
Die deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Sozialwissenschaftliche Kompetenz für Kirche und Gesellschaft – 50 Jahre Sozialwissenschaftliches Institut der EKD
ISBN 978-3-9465250-6-6 Autoren:
Reiner Anselm
Sozialwissenschaftliches Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland Heinrich Bedford-Strohm
Arnswaldtstraße 6, 30159 Hannover Karl-Fritz Daiber
Telefon 0511-55 47 41-0
Telefax: 0511-55 47 41-44 Birgit Klostermeier
e-Mail: info@si-ekd.de Ralf Meister
Sigrid Reihs
Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Verbreitung und jede Art der Verwertung sowie jegliche Speicherung Gunther Schendel
und Verarbeitung in datenverarbeitenden Systemen außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen
Claudia Schulz
Zustimmung des jeweiligen Urhebers. Es ist nicht gestattet, Abbildungen zu digitalisieren.
Gerhard Wegner
Fotos (Titelcover): iStock Ocskaymark, cmfotoworks, Exkalibur, Stadtratte, Animaflora, dem10
Redaktion und Recherche:
Gabriele Arndt-Sandrock
© creo-media, Hannover . 2019
creo-media GmbH
Bischofsholer Damm 89
30173 Hannover
www.creo-media.de
Layout, Satz, Typographie und Bildbearbeitung bei: creo-media, info@creo-media.deInhaltsverzeichnis
6 Grußworte
6 Ratsvorsitzender der EKD, Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm
10 Landesbischof Ralf Meister, Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers
12 50 Jahre SI: Profil und Geschichte einer evangelischen Institution
12 Gunther Schendel: 50 Jahre institutionalisierte Sozialwissenschaft in der Kirche.
Von der Gründung des Bochumer SWI bis zur Arbeit des SI in Hannover
28 Sigrid Reihs: Zum 50. Geburtstag des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD:
(k)ein nüchterner Rückblick auf die ersten 35 Jahre
34 Karl-Fritz Daiber: Die Pastoralsoziologische Arbeitsstelle in den 1970er und
1980er Jahren
42 Gerhard Wegner: Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD in Hannover.
Ein Rückblick auf 15 Jahre
53 Publikationen SI 2004 – 2019
66 Sozialethik und empirische Forschung für die Kirche –
Spannungsfelder und Herausforderungen
66 Reiner Anselm: Brennpunkte der Sozialethik 1969 – 2019
72 Claudia Schulz: Ganz nah am richtigen Leben!
Empirische Forschung als Beitrag zu Theologie und kirchlicher Praxis
78 Birgit Klostermeier: „Zu Risiken und Nebenwirkungen ...“ –
Empirische Forschung als soziale Praxis der Kirche
84 Anhang
85 Zeitleiste
87 Veröffentlichungen des Sozialwissenschaftlichen Instituts Bochum
92 Veröffentlichungen der Pastoralsoziologischen Arbeitsstelle/des Pastoralsoziologischen Instituts
95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1969 – 2019
5Die Arbeit des Sozialwissenschaftlichen Instituts, sowohl Denkmuster in Frage stellen und innovative Ansätze
als SWI in Bochum wie auch als SI in Hannover zeigt auf bekannt machen. Mit der Verbindung von Sozialwis-
einem speziellen Feld die Präsenz unserer Kirche in der senschaften und Theologie tragen wir zur Öffnung der
Gesellschaft: Im Jahr 1969, mitten in den Aufbrüchen Theologie für den säkularen und interdisziplinären Dis-
der 68er-Zeit, wurde es mit dem Auftrag gegründet, kurs bei. Kirchliche Selbstabschottung – so bequem sie
gesellschaftliche Entwicklungen sozialwissenschaftlich wäre – soll, so der Auftrag an das SI, keine Chance ha-
und -ethisch zu analysieren. In den 70er Jahren war das ben. Unter ausdrücklicher Anerkennung und Gewähr-
SWI maßgeblich an der Debatte um Umweltschutz und leistung der wissenschaftlichen Freiheit des SI, auch in
Grußwort an der Gründung des später einflussreichen Bundesver-
bandes Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) beteiligt.
der institutionellen Form als einer „unselbständigen
Einrichtung der EKD“, hat sich die EKD für den Erhalt
Auf die Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt in den 80er dieser kritischen Institution entschieden. Die Ergebnisse
Ratsvorsitzender der EKD, Jahren reagierte man mit der thematischen Fokussierung
auf ethische Fragen einer gerechten Wirtschaftsordnung
dieser Arbeit fließen kontinuierlich in die Kirchenmit-
gliedschaftsuntersuchungen, in die Texte der Kammer
Landesbischof und einer menschenwürdigen Arbeitswelt. Die maßgeb-
liche Mitwirkung am Ökumenischen Konsultationspro-
für soziale Ordnung, in die Stellungnahmen kirchen-
leitender Organe sowie in ökumenische Stellungnah-
Dr. Heinrich Bedford-Strohm zess zur wirtschaftlichen und sozialen Lage steht für die
Verantwortung beider christlicher Kirchen für eine so-
men ein. Wenn solche Äußerungen im öffentlichen und
kirchlichen Diskurs Relevanz gewinnen, dann ist dies
lidarische und gerechte Gesellschaft in den 90er Jahren. immer auch dem Praxisbezug und der kommunikativen
Die Zusammenlegung des SWI mit dem Pastoralsozio- Anschlussfähigkeit an öffentliche Diskurse geschuldet,
logischen Institut in der Evangelischen Fachhochschule die in interdisziplinärer Arbeit am SI eingeübt wird.
Hannover und die Neugründung als SI im Jahr 2005 si-
gnalisierte, dass die gesellschaftlichen Veränderungspro- Die Herausforderungen der 2020er Jahre zeichnen sich
zesse auch die Kirche in ihrer Sozialgestalt erreicht hat- ab. Die konsequente Weiterentwicklung der Sozialen
Dr. Heinrich Bedford-Strohm
(Fotograf: epd/mck) ten. Mit dieser programmatischen Neuaufstellung galt Marktwirtschaft mit ihren starken Wurzeln im protes-
und gilt es, sozialwissenschaftlich gestützte Gesellschafts- tantischen Geist zu einer ökologisch-sozialen Marktwirt-
analyse für theologische sozialethische Positionierungen schaft ist zu gestalten. Der Prozess der Digitalisierung
in öffentlichen sozialpolitischen Diskursen wie auch für ist als gesellschaftlicher und kultureller und nicht nur
verantwortliche Kirchenentwicklung zu nutzen. Dieser als technischer Prozess zu begreifen. Als Theologie und
Durchgang durch die Geschichte des SWI/SI zeigt, mit Kirche haben wir spätestens seit der Industrialisierung
welch hoher Sensibilität für gesellschaftliche Kontexte zu viel Abstand zur Welt der Technik in ihrer Prägekraft
und mit welch kirchenpolitischem Weitblick institutspo- gehalten. Hier müssen wir theologisch aufschließen. Die
litische Entscheidungen getroffen wurden. religiöse Vielfalt in unserem Land ist Wirklichkeit. Sie
gilt es adäquat zu erfassen, um aus Polarisierungen zwi-
Sowohl als Landesbischof wie auch als Ratsvorsitzender schen Ablehnung und Vergleichgültigung herauszufin-
erlebe ich immer wieder, wie wertvoll, ja unverzichtbar den. Als evangelische Kirche treten wir auf diesem Feld
die Arbeit ist, die vom SI geleistet wird. Neben einer religionspolitisch und kirchenpolitisch in eine neue Pha-
fundierten theologischen Theoriebildung brauchen wir se ein, für die wir Orientierungen brauchen. Die Auf-
anerkannte empirische Zugänge zur Praxis, um unsere gaben sind groß. Die erfolgreiche Geschichte des SI wie
Theoriebildung zu stützen oder auch zu irritieren. Re- auch die Kompetenz von Institutsleitung, Mitarbeiten-
präsentative Umfragen und sozialwissenschaftliche For- den, Vorstand und Wissenschaftlichem Beirat geben uns
schung können und sollen in der Kirche vorherrschende begründete Hoffnung auf tragfähige Ergebnisse.
6 750 Jahre SWI/SI geben Anlass zu großem Dank: Über Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern dieses Jubi-
die Arbeit des Institutes und dessen Mitarbeitenden in läumsbandes Freude bei der durch Fotos und lebendi-
den Jahren des Aufbaus in Bochum, der Etablierung, des ge Schilderungen leicht gemachten Erinnerungsarbeit.
Umzugs und der Neuausrichtung in Hannover gibt die Es verwundert aufgrund des Selbstverständnisses des SI
Jubiläumsschrift Auskunft. Stellvertretend für alle Mit- nicht, dass neben Erinnerung zugleich der kritische und
arbeiterinnen und Mitarbeiter möchte ich Dr. Klaus selbstkritische Ausblick gestellt wird. Gottes Segen für
Lefringhausen als Gründungsdirektor des SWI und das SI und alle Menschen, die dessen Arbeit tragen!
Prof. Dr. Günter Brakelmann als langjährigen Direktor
in der Bochumer Zeit nennen und ihnen herzlich dan-
ken. Die tägliche Arbeit mit aller Kreativität, mit allem
Engagement, mit aller Kompetenz und allem wissen-
schaftlichen Eros und auch mit aller Mühe der nötigen
Verwaltungs- und Organisationsarbeit wurde und wird
vom Direktor und seinen Mitarbeitenden, unterstützt
durch das Kirchenamt der EKD, geleistet. Dass die Neu-
gründung als SI und die Etablierung des Instituts in den
letzten 14 Jahren gelang, ist ganz wesentlich der Leitung
von Prof. Dr. Gerhard Wegner zu verdanken. Der Vor-
stand unter Leitung von Vizepräsident Arend de Vries
und der stellvertretenden Leitung von Vizepräsident Dr.
Horst Gorski arbeitet erfolgreich an der kontinuierlichen
Ausrichtung des Kurses der Institutsarbeit. Sehr dankbar
sind wir für die Einbindung des SI in die Wissenschafts-
landschaft in Theologie und Sozialwissenschaften, die
durch den Wissenschaftlichen Beirat unter Leitung von
Prof. Dr. Johannes Eurich wesentlich unterstützt wird.
Die Landeskirchen tragen das SI finanziell auch in Zeiten
von Sparmaßnahmen, weil sie die Institutsarbeit schät-
zen und von seiner Bedeutung überzeugt sind. Dies gilt
in besonderem Maße von der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannovers, die als Kooperationspartner
des SI finanziell und hinsichtlich der Mitarbeit im Vor-
stand besondere Verantwortung übernommen hat. Das
SI wäre nicht das SI, das wir kennen, wenn es nicht die
Kooperationspartner unter den Universitäten und Hoch-
schulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen,
Gewerkschaften, Stiftungen, kirchlichen Verbänden wie
dem Ev. Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt e.V.
und Evangelischen Akademien gäbe. Auch diese Partner
tragen wesentlich zum Erfolg des SI bei. Danke für Ver-
trauen und Zusammenarbeit!
8 97000 Menschen zogen am 7. Juni 1967 durch Hannover. 2004 wurde die Pastoralsoziologische Arbeitsstelle, mitt-
Sie gaben dem Studenten und Christen Benno Ohne- lerweile an der Evangelischen Fachhochschule Hannover
sorg das letzte Geleit, der am Rande einer Demonstra- angesiedelt, mit dem 1969 gegründeten Sozialwissen-
tion von einem Polizisten erschossen worden war. Der schaftlichen Institut der EKD am Standort Hannover
Berliner Bischof und EKD-Ratsvorsitzende Kurt Scharf zusammengeführt. Die Voraussetzungen hatten sich seit
hielt die Trauerrede. Er suchte die Schuld für die Eskala- den Gründungsjahren grundlegend geändert: 1971 ver-
tion nicht bei den Studierenden und nicht beim Staat, er standen wir uns als „Volkskirche“, sahen uns mitten in
suchte nach tieferen Ursachen: Nach Ursachen, die „in dieser Gesellschaft, die wir besser verstehen wollten. 2004
der Struktur unserer Gesellschaft, der Gesellschaft der dagegen erlebte sich die Kirche vielmehr als Gegenüber
Grußwort freien Welt und in Westeuropa“ gegründet sind, in der
„Art, wie wir Gemeindeverantwortung wahrnehmen
der Gesellschaft: Von der Forschung an der Schnittstelle
von Sozialwissenschaft und Theologie erhoffte sie sich, in
oder auch versäumen“.1 die Gesellschaft hinein zu wirken, Zielgruppen zu identi-
Landesbischof Ralf Meister Die Studierenden dieser Jahre haben die Gesellschaft
fizieren und passgenau anzusprechen. Das war realistisch
gedacht. Zum Jubiläum ist es allerdings ebenso berechtigt
Evangelisch-lutherische
und auch die Kirche verändert – und die Kirche hat sich zu fragen, wie wir uns als Kirche etwas von dem Opti-
verändern lassen. In Hannover waren es die Vikarinnen mismus und der Aufbruchsstimmung unserer Vorgänge-
Landeskirche Hannovers
und Vikare, die mehr wissenschaftlichen Anspruch in der rinnen und Vorgänger vor 50 Jahren erhalten können.
praktischen Ausbildungsphase vor dem zweiten theolo-
gischen Examen forderten. Sie wollten die Situation der Für mich sind die Analysen des Sozialwissenschaftlichen
Menschen verstehen, die sie später als Seelsorgerinnen Instituts unverzichtbar. Seine Studien greifen die aktu-
und Seelsorger begleiten würden. Das war kein Selbst- ellen Herausforderungen für die Kirche auf. In Fragen
zweck: Es ging darum, Gesellschaft und Gemeinde zu des demographischen Wandels, der Situation der Men-
reformieren, die Partizipation der Gläubigen zu stärken. schen auf dem Land und des Wandels zu einer multikul-
turellen und multireligiösen Gesellschaft sensibilisieren
Dr. Karl-Fritz Daiber übernahm 1971 die sozialwis- die Forschungsergebnisse und konfrontieren die Kirche
Landesbischof Ralf Meister
senschaftlichen Kurse in der Aus- und Fortbildung der auch mit Wahrheiten, die schmerzen. Präzise und schnell
(Fotograf: Heiko Preller) Seelsorgerinnen und Seelsorger. Die Hannoversche Lan- werden aktuelle Entwicklungen untersucht. In unserem
deskirche hatte das Glück, mit ihm einen Kollegen zu Engagement für Geflüchtete, die in Niedersachsen eine
gewinnen, der sich mit der Rolle nicht zufriedengab, die Zukunft suchen, hat uns eine Studie des SI den Rücken
man ihm zunächst zubilligte. Bereits drei Monate nach gestärkt, die belegt: Mehr Niedersächsinnen und Nieder-
seinem Start konnte er eine Pastoralsoziologische Arbeits- sachsen als andere Bundesbürger glauben, dass ihr Land
stelle aus der Taufe heben. Sie diente bald nicht nur der mit der Aufnahme der Geflüchteten zurechtkommt. Für
Aus- und Fortbildung, sondern stellte Forschungsergeb- solche Ermutigungen, für alle Denkanstöße und Heraus-
nisse zur Verfügung, die über die Hannoversche Landes- forderungen sage ich danke.
kirche hinaus fruchtbar waren und auch von der akade-
mischen Sozialwissenschaft wahrgenommen wurden. So
nahm das Team die Kommunikation zwischen Prediger
und Zuhörenden unter die Lupe und erforschte die oft in-
nige Beziehung von Christinnen und Christen zur Bibel
als Objekt, als Erinnerungsstück und Lebensbegleiterin.
1 Zitiert nach: Harmjan Dam, Katharina Kunter, Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts im Religions-
unterricht, Göttingen 2018, S. 76
10 11„Das Fortwirken einer Institution gründet sich auf ihre
gesellschaftliche Anerkennung als ‚permanente‘ Lösung
„Sozialer Strukturwandel erfordert kirchliche
eines ‚permanenten‘ Problems“: Diese Einsicht in die Forschung“
Grundbedingung für die Relevanz und Dauer von In-
stitutionen stammt von Peter L. Berger und Thomas Die Etablierung des Sozialwissenschaftlichen Instituts
Luckmann (Berger / Luckmann 1969: 74). Die deutsche in Bochum 1969
Übersetzung ihres programmatischen Werks „Die ge-
sellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ erschien Zum ersten Mal trat das Bochumer Sozialwissenschaft-
im Jahr 1969, also just im Gründungsjahr des (damals so liche Institut am 10. November 1969 mit einem Empfang
50 Jahre institutionalisierte genannten) Sozialwissenschaftlichen Instituts der evan-
gelischen Kirchen in Deutschland (SWI).
an die Öffentlichkeit, nachdem es bereits zum 1. Sep-
tember seine Arbeit aufgenommen hatte. Das Institut,
Sozialwissenschaft in der Kirche Von daher lädt das genannte Zitat von Berger und Luck-
mann gleich zu einer ganzen Reihe von Fragen ein: Für
Von der Gründung des
welches „Problem“ erhofften sich kirchenleitende Gre-
mien 1969 eine „Lösung“, indem sie sozialwissenschaft-
Bochumer SWI bis zur Arbeit
liche Reflexion im Bereich der evangelischen Kirche
institutionalisierten? Wie veränderte sich die Problem-
wahrnehmung in den wechselvollen fünf Jahrzehnten bis
des SI in Hannover heute? Welche Perspektiven und Akzente setzten hier die
Mitarbeitenden, vielleicht auch in Spannung zu den of-
fiziellen Erwartungen? Wie sah es mit der „gesellschaft-
lichen Anerkennung“ aus, die im Fall eines kirchlichen
Gunther Schendel Instituts ja auch die kirchliche Akzeptanz impliziert?
Und schließlich: Welche Strukturen wurden etabliert
Dr. Gunther Schendel
und z. T. auch verändert, um bestimmte Handlungen
nach Jahren als Gemeindepastor im Kirchenkreis Uelzen seit und Erwartungen auf Dauer zu stellen?
2011 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im SI der EKD tätig.
In diesem Sinn soll im Folgenden ein – notgedrungen
kurzer – Blick auf die kirchliche Institutionalisierung
von Sozialwissenschaft geworfen werden, die 1969 mit
der Gründung des Bochumer SWI begann und 2004 mit
der Etablierung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der
EKD (SI) in Hannover eine Fortsetzung erlebte. Dabei
gerät auch eine andere wichtige Institutionalisierung
der sozialwissenschaftlichen Perspektive in den Blick,
nämlich die Pastoralsoziologische Arbeitsstelle (PSA)
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers,
deren Nachfolgeeinrichtung, das Pastoralsoziologische
Eröffnung des SWI Bochum am 10. November 1969
Institut in der Evangelischen Fachhochschule Hannover Oben links: Dr. Klaus Lefringhausen (Leiter des SWI); Oben rechts: Präses D. Dr. Joachim Beckmann
(PSI), 2004 in das neugegründete SI der EKD einging. (2.v.l.; rheinische Kirche), Präses D. Dr. Hans Thimme (3.v.l.; westfälische Kirche), Erich Brühmann
(5.v.l., Superintendent des Kirchenkreises Bochum).
(QUELLE: LkA EKvW 25A 64)
12 13das sich bei dem Empfang im Bochumer „Haus der Kir- Leiter des SWI (1970-1980), u. a. auch Friedrich Kar- Interessant ist nun, welche zu lösenden „Probleme“ die
che“ präsentierte, umfasste damals fünf wissenschaftliche renberg, der langjährige Vorsitzende des Sozialethischen offizielle Aufgabenbeschreibung enthielt und welche
Mitarbeiter verschiedener Fachrichtungen und Fächer- Ausschusses der EKiR, sowie die Leiter des Sozialamts Form der Institutionalisierung die Gründungsvereinba-
kombinationen (Wirtschaftswissenschaften und Sozio- der EKvW sowie der Sozialakademie Friedewald (Lef- rung vorsah. In einem ersten, allgemeinen Passus wur-
logie, Theologie und Kirchensoziologie, Sozialethik ringhausen 1989: 12). Auch wenn dieser Plan eines insti- den die Aufgaben zunächst sehr deutlich an den „Auftrag
und ökumenische Theologie, Wirtschaftswissenschaften tutionalisierten wissenschaftlichen Dienstes für die Kam- der Kirche“ zurückgebunden, aber auch in den Kontext
und Sozialpolitik, Politische Wissenschaften). Mit die- mern der EKD zunächst nicht weitergeführt wurde, zeigt gesellschaftlichen Wandels gestellt: „Das Institut hat die
ser Zusammensetzung wurde sofort deutlich: Das neue sich hier die Bereitschaft von einigen Landeskirchen, zur Aufgabe, durch sozialethische und sozialwissenschaftli-
Institut sollte interdisziplinär arbeiten, wie es auch der Bewältigung gemeinsam wahrgenommener Aufgaben che Studienarbeit zur wissenschaftlichen Grundlegung
damaligen empirischen Wende der Praktischen Theo- eine gemeinsame „‚permanente‘ Lösung“ zu etablieren. von Verkündigung und des Dienstes der Kirche in einer
logie entsprach (Schröer 1997: 207f.). Eingeladen hatte Eine erste Institutionalisierung erfolgte im Mai 1966 mit sich wandelnden Gesellschaft beizutragen. Es dient so
der damalige Präses der Evangelischen Kirche im Rhein- der Gründung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der dem Eintreten der Kirche für Gerechtigkeit und Frieden
land (EKiR) Joachim Beckmann als Kuratoriumsvor- EKiR in Velbert, nicht zufällig dem Wohnort von Fried- in der Welt. Zu diesem Zweck beobachtet und analysiert
sitzender. Zugegen waren aber auch führende Vertreter rich Karrenberg. Karrenberg firmierte bis zu seinem das Institut die politisch-gesellschaftlichen Entwick-
der Evangelischen Kirche in Westfalen (EKvW) (epd plötzlichen Tod im Herbst 1966 als Gründungsleiter die- lungstendenzen und zeigt die für den Auftrag der Kirche
11.11.1969). Damit wurde von kirchenleitender Seite die ses Instituts, das die Arbeit des Sozialethischen Ausschus- bedeutenden Fragen auf“ (Vereinbarung, 22.5.1969, §
Unterstützung des neuen Projekts unmissverständlich ses der EKiR und damit namentlich das umfangreiche 3.1, EZA a.a.O.).
unterstrichen. Außerdem waren neben Vertreter*innen sozialethische Engagement Karrenbergs (Kammer für Bemerkenswert ist hier einerseits die gleichgewichtige
der Stadtöffentlichkeit und der katholischen Kirche auch soziale Ordnung, Kirchentag, Akademiearbeit, Hono- Nennung von Sozialethik und Sozialwissenschaft, die in
Klaus Lefringhausen, Leiter SWI 1969-1970
die Theologie-Professoren der sieben Jahre zuvor ge- (QUELLE epd Bild) rarprofessur) wissenschaftlich begleiten und unterstützen der Berichterstattung über die Eröffnungsfeier nicht in
gründeten Ruhr-Universität Bochum präsent – ein Vor- sollte (Hack 2007: 66; vgl. Schendel 2018). gleicher Weise deutlich wird, und andererseits der Hin-
zeichen für die in den kommenden Jahren sehr fruchtba- „um eine Antwort zur Gestaltung der Verhältnisse ge- weis auf die globale Perspektive von „Frieden und Ge-
re Vernetzung zwischen Institut und Universität. ben zu können“ (epd 11.11.1969). Der Blick auf das in- Aus dem Velberter Sozialwissenschaftlichen Institut der rechtigkeit“, die über die deutsche Gesellschaft deutlich
tendierte Arbeitsprogramm zeigt: Bei der beabsichtigten EKiR und dem in Villigst angesiedelten Sozialamt der hinausgeht (ebd.). Vermutlich nimmt diese globale Pers-
Dem ersten Leiter des Instituts, dem Wirtschaftswissen- „Gestaltung der Verhältnisse“ ging es um eine kompe- EKvW entstand im Jahr 1969 das ausdrücklich so genann- pektive das Erbe Friedrich Karrenbergs auf, dem ein In-
schaftler und Soziologen Klaus Lefringhausen (1934- tente Mitwirkung an der Diskussion gesellschaftlicher te „Sozialwissenschaftliche Institut der evangelischen Kir- stitut „für die großen Menschheitsfragen“ vorgeschwebt
2009), war es vorbehalten, die ersten thematischen Fragen, aber auch um die Reflexion der eigenen kirch- chen in Deutschland“ mit Sitz in Bochum. Diese Grün- hatte, u. a. zur „Ost-West-Entspannung“ und zum
Schwerpunkte des Instituts zu präsentieren. Bereits lichen Praxis. Damit präsentierte sich das SWI 1969, ein dung ging auf eine Initiative der EKiR und der EKvW „Nord-Süd-Konflikt“ (Lefringhausen 1989: 12). Aller-
im Vorfeld waren die Eckpunkte eines ambitionierten Jahr nach der Hoch-Zeit der Studentenproteste und nur zurück, die aber offenbar die EKD beteiligt hatten, um zu dings standen Fragen der globalen Gerechtigkeit längst
„Arbeitsprogramm[s]“ veröffentlicht worden, das sich wenige Wochen nach dem Beginn der Kanzlerschaft von prüfen, „ob es nicht zweckmäßig sei, ein solches Institut auch auf der Agenda der EKD: Im Februar 1969 hatte
auf „Fortschrittsprobleme der Industriegesellschaft“ Willy Brandt, als ein Institut auf der Höhe der neuen von Anfang an mit gesamtkirchlicher Aufgabenstellung der Rat die Kammer für Kirchlichen Entwicklungs-
fokussieren sollte. Dabei sollte es jedoch nicht nur um Zeit mit ihren Leitthemen: Weiterentwicklung der In- zu errichten und allen Gliedkirchen der Evangelischen dienst berufen (Willems 2013: 276).
ökonomische Folgen des „Strukturwandel[s]“ und der dustriegesellschaft und der Demokratie, aber auch der Kirche in Deutschland den Beitritt zu ermöglichen“ (Kir-
wachsenden Wirtschaftsverflechtung mit den „Entwick- Kirchenreform. chenkanzlei EKD 6.6.1969 an die Leitungen der Glied- Nach der allgemeinen Aufgabenbestimmung enthält die
lungsländern“ gehen. Thematisiert werden sollten auch kirchen, EZA 2-14523). Im April 1969 stimmte der Rat Gründungsvereinbarung eine weitere Passage, die in ei-
die Folgen für aktuelle Formen der „Demokratie“, für Die suggestive zeitliche Nähe zu den Wegmarken „1968“ der EKD dem Beitritt in die Trägerschaft des SWI zu; die ner eher offenen Formulierung Dienstleistungsaufgaben
die Entwicklung „sozialethische[r] Normen“ und die und „1969“ verdeckt jedoch die lange Vorgeschichte des Vereinbarung über die Errichtung des Instituts wurde im für Kirchen und kirchliche Einrichtungen beschreibt:
„Praxis kirchlichen Lebens“ (epd 6.11.1969). SWI. Sie reicht bis in die erste Hälfte der Sechzigerjahre Mai 1969 ausgefertigt (Vereinbarung über die Errichtung Genannt wird die „Beratung“ von Rat der EKD, den
zurück und zeigt noch einmal andere ‚permanente‘ Pro- eines Sozialwissenschaftlichen Instituts, 22.5.1969, EZA „Leitungen der Gliedkirchen“ sowie von „Einrichtun-
Dieses umfangreiche Programm gibt erste Hinweise auf bleme“, für die nach einer Lösung in Form eines Instituts a.a.O.); der zunächst geplante Eröffnungstermin zum gen der kirchlichen Sozial- und Industriearbeit“. Außer-
das „‚permanente‘ Problem“, zu dessen „‚permanenter‘ gesucht wurde: 1963 fand im Bonner Büro von Hermann 1.7.1969 (Kirchenkanzlei EKD 6.6.1969, EZA a.a.O.) dem wird eine wissenschaftliche Dienstleistungsfunktion
Lösung“ das neue Institut etabliert wurde. Im Hinter- Kunst, dem Bevollmächtigten des Rates der EKD bei konnte offensichtlich nicht gehalten werden. für drei namentlich genannte Kammern der EKD er-
grund stand die Wahrnehmung eines „sozialen Struktur- der Bundesregierung, ein erstes Planungsgespräch über wähnt (öffentliche Verantwortung, soziale Ordnung und
wandels“ (epd 6.11.1969) bzw. von „komplizierten ge- die Gründung eines Instituts statt, das der Zuarbeit zu kirchlichen Entwicklungsdienst) (§ 3.2).
sellschaftlichen Zusammenhänge[n]“, die die am Institut den Kammern der EKD dienen sollte. Teilnehmer wa-
beteiligten Kirchen „transparenter“ machen wollten, ren neben Horst Zilleßen, dem späteren Mitarbeiter und
14 15Diese kircheninterne Beratungs- und Dienstleistungs-
funktion wird in der Berichterstattung über den Eröff-
„Die Bedrohung unserer Umwelt durch unumstritten: Eine Landeskirche reduzierte bereits 1972
ihren Haushaltsansatz für das Institut, möglicherweise
nungsempfang nicht eigens erwähnt. Ihre Institutiona- die industrielle Zivilisation“ auch wegen politischer Bedenken (vgl. Zilleßen 1989:
lisierung zeigt jedoch, als wie dringend die beteiligten 20). Dazu kam der Kürzungsdruck, unter den die EKD
Kirchenleitungen den Bedarf an einer ständig zur Ver- Das erste Jahrzehnt des SWI bis zu seiner Überfüh- und einige Landeskirchen in den Jahren nach der Öl-
fügung stehenden wissenschaftlichen Expertise hielten; rung in die alleinige EKD-Trägerschaft (1969-1980) preiskrise von 1973 gerieten; dieser Kürzungsdruck er-
nicht umsonst kamen sie jetzt auf die 1963 zunächst ver- reichte auch das SWI und führte die Mitarbeitenden in
worfenen Pläne für eine institutionalisierte Zuarbeit für Mit Blick auf die ersten zehn Jahre des SWI lässt sich sa- eine „fünfjährige Phase intensiver Selbstrechtfertigung“
die Kammern der EKD zurück. gen: Die organisatorische und inhaltliche Institutionali- (ebd.). Offenbar war in Zeiten finanzieller Verknappung
sierung der Bochumer Einrichtung gelang überraschend nicht mehr allen Trägerkirchen plausibel, ob und wie das
Zu dieser Beratungs- und Dienstleistungsfunktion passt schnell. Der von der EKD-Kirchenkanzlei ausgespro- SWI die geeignete „‚permanente‘ Lösung eines ‚perma-
auch die Struktur des neuen Instituts: Es wurde als chenen Einladung, sich der Betreibung des SWI als einer nenten‘ Problems“ darstellte.
„rechtlich unselbständige Einrichtung seiner Träger“ „Gemeinschaftsaufgabe“ anzuschließen (Kirchenkanzlei
etabliert (§ 4.1). Als das zentrale Führungs- und Lei- EKD 6.6.1969, EZA 2-14523), folgten nach den beiden Schließlich übernahm die EKD zum Jahresbeginn 1980
tungsgremium wurde ein Kuratorium eingerichtet, das ersten Trägerkirchen aus Nordrhein-Westfalen in den die „alleinige Trägerschaft“ des Instituts (Kuratorium
im Wesentlichen aus Vertretern der Trägerkirchen und folgenden Jahren fast alle westlichen Gliedkirchen der an die Trägerkirchen, 7.5.1979). Entsprechende Über-
den Vorsitzenden der drei genannten Kammern bestehen EKD – auch wenn es Ausnahmen gab (Zilleßen 1989: legungen hatte das Kuratorium bereits seit 1972 verfolgt
sollte. Damit waren der Einfluss, aber auch die Verant- 15). Zugleich gelang dem SWI sehr bald eine inhaltliche (Zilleßen 1989: 20). Mit dieser Änderung in der Träger-
wortung der wesentlichen Nutznießer und ,Kunden‘ des Fokussierung seiner Arbeit, die ihm eine bundesweite schaft war jedoch nicht nur der künftige Wegfall einer
Horst Zillessen, Leiter SWI 1970-1980
neuen Instituts institutionalisiert. Dem Kuratorium sollte Bedeutung einbrachte. Verantwortlich hierfür war vor (QUELLE Mediator GmbH) Personalstelle verbunden (Kirchenkanzlei an die wiss.
die Entscheidung über die „Richtlinien für die Arbeit“ allem die Bearbeitung des Umweltthemas; hier nahm das Mitarbeiter des SWI, 8.8.1979), sondern auch eine Ver-
genauso obliegen wie die über Personalangelegenhei- SWI in der ersten Hälfte der Siebzigerjahre eine wichtige intensive Vortragstätigkeit bis zur praktischen Vernet- änderung der Institutsordnung: Das SWI wurde jetzt zu
ten. Allerdings sicherte die Gründungsvereinbarung den Pionier- und Vernetzungsfunktion ein. zung und Unterstützung der sich formierenden Umwelt- einer rechtlich unselbständigen Einrichtung der EKD;
hauptamtlichen Mitarbeitenden des Instituts sowohl in bewegung: So stand das SWI 1971 bei der Gründung der wissenschaftliche Beirat entfiel, und der Leiter be-
Personalangelegenheiten als auch bei der Entscheidung Diese Fokussierung auf das Umweltthema ging auf der „Rhein-Ruhr-Aktion gegen Umweltzerstörung“ kam ausdrücklich eine Vorgesetztenfunktion für die
über „Forschungsaufträge“ ein Anhörungsrecht zu. Zu- eine Entscheidung von Beirat und Kuratorium aus dem (RRA) genauso Pate wie es 1972 bei der Gründung Mitarbeitenden (Ordnung des SWI, 20.4.1979, §§ 2-5,
dem sollte das Kuratorium einen Wissenschaftlichen Bei- Herbst 1970 zurück, die das bei der Eröffnung präsen- der „Bundesarbeitsgemeinschaft Umweltschutz“ betei- EZA 215/31). Änderungen sah die neue Ordnung auch
rat einrichten, der ebenfalls ein Anhörungsrecht haben tierte, inhaltlich sehr breite Arbeitsprogramm auf die ligt war (Zilleßen 1989: 19). Und als sich im Juni 1972 bei der Aufgabenbeschreibung vor: Die in der Vergan-
und mit ihrem Vorsitzenden im Kuratorium vertreten Fragestellung nach der „Bedrohung unserer Umwelt der „Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz“ genheit von den Mitarbeitenden als sehr zeitaufwendig
sein sollte. Die operative Leitung des Instituts sollte das durch die industrielle Zivilisation“ konzentrierte (Zille- (BBU) gründete, wurde Zilleßen als Sprecher der RRA erlebte Zuarbeit zu den Kammern der EKD (Zilleßen
Kuratorium an einen „Leiter“ delegieren, der aus dem ßen 1989: 17). Diese Fokussierung fiel in die Zeit, als zum BBU-Vorsitzenden gewählt (Kempf 1984: 405); 1989: 21) wurde nicht mehr explizit erwähnt; jetzt war
hauptamtlichen Team „auf jeweils drei Jahre“ berufen der Politikwissenschaftler Horst Zilleßen (geb. 1938) das SWI übernahm für ein Jahr die Geschäftsführung des allgemein von der Erfüllung von „Studien- und Bera-
werden sollte. Die Kompetenzen dieser Leitungsperson nach dem Ausscheiden von Klaus Lefringhausen, der in neuen Verbands (Zilleßen 1989: 19). tungsaufträgen der EKD und ihrer Gliedkirchen“ die
waren beschränkt und sollten im Wesentlichen dem En- die Entwicklungspolitik wechselte (Willems 2013: 194), Rede. Der Zweck des SWI und seiner „Studienarbeit“
gagement für eine „sinnvolle Kooperation innerhalb des zum neuen Institutsleiter bestimmt wurde. Zilleßen hat Die erste Dekade des SWI war jedoch nicht nur durch sollte jetzt darin bestehen, einen Beitrag zum „wirklich-
Instituts“ und die Umsetzung von Beschlüssen dienen. die neue Schwerpunktsetzung rückblickend mit der Er- dieses Engagement geprägt, sondern auch durch erste keitsnahen Zeugnis und Dienst der Kirche in der mo-
Damit waren die direkten Einflussmöglichkeiten des Ku- kenntnis begründet, dass es sich beim Umweltthema Ressourcen- und Finanzprobleme. Die Verbindung von dernen Gesellschaft“ zu leisten (§ 1). Diese Aufgabenbe-
ratoriums auf die Institutsarbeit groß; zugleich bot sich nicht nur um eine Frage an das „gesellschaftliche und eigenem „Arbeitsprogramm“ und der kircheninternen schreibung zeigt: Zehn Jahre nach der Institutsgründung
aber auch die Möglichkeit für eine starke Teamidentität. politische Ordnungssystem“, sondern auch an die „gel- Beratungs- und Dienstleistungsfunktion erwies sich als war das empirische Paradigma genauso selbstverständlich
tende gesellschaftliche Wertordnung“ handle und damit schwierig, wobei es jedoch als bemerkenswert bezeich- wie das Bewusstsein, dass sich kirchliches Handeln in der
ein für die Kirche relevantes sozialethisches Thema dar- net werden muss, dass das Kuratorium die beschriebene Dynamik einer „modernen Gesellschaft“ abspielt. Dass
stelle (Zilleßen 1989: 18). Die Beschäftigung mit diesem anwaltschaftliche Rolle des SWI für die Umweltbewe- sich die Gesellschaft „wandelt“, musste offensichtlich
Thema, das bis ca. 1979 einen Schwerpunkt des SWI bil- gung und den damit verbundenen Ressourceneinsatz nicht mehr eigens betont werden.
dete, schlug sich in einer Vielzahl von Aktivitäten nieder: „ausdrücklich“ billigte (Zilleßen 1989: 19). Trotz oder
Sie reichte von einer regen Publizistik, für die 1971/72 gerade wegen dieses Engagements war die finanzielle
der Materialdienst des SWI gegründet wurde, über eine Förderung des SWI freilich nicht in allen Trägerkirchen
16 17„Arbeit – Technologie – Wirtschaftsordnung“ In zahlreichen Publikationen wurden die Themen Ar-
beit und Technologie neu in den Blick genommen, z. B.
Kirche (1997) zu nennen. Das SWI war hier über Jah-
re vielfach involviert, unter anderem auch mit der Aus-
Die weitere Entwicklung des SWI bis zu seiner Über- auch Fragen der Digitalisierung („Hilfe durch Bruder wertung der zahlreichen Stellungnahmen. Das Institut
Computer?“, 1987). Als neues Thema wurde die „Zeit- flankierte diese Diskussion durch die Herausgabe von
führung in das SI (1980-2004) politik“ entdeckt, also all die Themen, die heute unter Publikationen, die sich kritisch mit der damaligen neo-
dem Stichwort „Arbeitszeitsouveränität“ im Diskurs um liberalen Wirtschafts- und Sozialpolitik auseinandersetz-
Nach der Übernahme des Instituts in die volle Träger- „gute Arbeit“ eine Rolle spielen. Das SWI hatte hier we- ten (Brakelmann 2004: 29f.). Besondere Unterstützung
schaft der EKD war eine wichtige strukturelle Frage sentlichen Anteil an der Gründung der Deutschen Ge- und Wertschätzung erfuhr die damalige Arbeit des SWI
geklärt. In den Jahren bis 1983 erfolgten weitere wich- sellschaft für Zeitpolitik (2002). In späten Achtziger und durch Oberkirchenrat Tilman Winkler, den Referenten
tige Weichenstellungen, die die Entwicklung des SWI frühen Neunziger Jahren rückten auch Geschlechterfra-
bis zur Jahrtausendwende prägten. Dazu gehören zwei gen verstärkt in den Blickpunkt, zunächst mit dem Blick
Wechsel in der Leitung des Instituts: Nachdem Horst auf die Arbeit von Frauen, dann auch auf Männerthemen
Zilleßen 1980 als Universitätspräsident nach Olden- („Männliche Religiosität und Lebenspraxis“) (Brakel-
burg gegangen war, hatte der Rat der EKD zunächst mann 2004: 27f.). Fragen zukünftiger Wirtschaftpolitik
Michael Bartelt (1933-1984) zum Leiter berufen, bevor wurden z. B. 1989 bei einer prominent besetzten Ko-
operationstagung zum „Wirtschaften im Jahr 2000“ dis-
kutiert. Neben dem Blick auf Gegenwart und Zukunft
galt das Interesse des SWI aber auch der Geschichte des
„Sozialen Protestantismus“ des 19. Jahrhunderts, um
Günter Brakelmann, Leiter SWI 1983-1999
(QUELLE: epd Bild) die „protestantischen Wurzeln der Sozialen Marktwirt-
schaft“ (so ein Buchtitel aus dem SWI) besser einord-
auf die „Zusammenarbeit mit der Sozialkammer der nen zu können (Brakelmann 2004: 27). Dementspre-
EKD und den kirchlichen Diensten in der Arbeitswelt“ chend stand das SWI 1998 auch hinter der Initiative zur
(KDA) erfolgen (Kuratorium: Grundriss der Konzep- Gründung eines neuen Evangelisch-Sozialen Kongresses
tion, 3.5.1983, EZA 215/31). Der Abschied vom Leit- (zweiter und letzter Kongress 2000) (Brakelmann 2004:
thema Ökologie wurde rückblickend mit der 1977 er- 30f.), und es ist sehr wahrscheinlich, dass das im Grün-
folgten Gründung des Öko-Instituts Freiburg begründet dungsaufruf formulierte Selbstverständnis, „Impulsge-
(Brakelmann 1989: 22). Jetzt sollte die Frage nach der ber für soziale Verantwortung“ zu sein (ebd., 30), exakt
„Zukunft der Industriegesellschaft“ neu in den Blick dem damaligen Selbstverständnis des SWI und seiner Tilman Winkler
genommen werden, und zwar mit dem ausdrücklichen Mitarbeitenden entsprach. Mit Sicherheit galt das für das (QUELLE: epd Bild)
Willen, zukünftig relevante Themen zu antizipieren und in diesem Zusammenhang formulierte Verständnis der
zu erforschen (Brakelmann 1989: 22f.). Sozialen Markwirtschaft, demzufolge „die Systemlogik für soziale und gesellschaftliche Fragen im Kirchenamt
des Marktes und das Gewinnstreben der Unternehmen der EKD; nach seinem Tod im Jahr 2001 würdigten die
Mit dieser Schwerpunktsetzung erarbeitete sich das als partielle Konstitutionselemente in eine wohlgeordne- Mitarbeitenden des SWI sein stetes Bemühen, „die unter-
Michael Bartelt, Leiter SWI 1980-1983
SWI in den folgenden Jahren ein Profil, das einerseits te Gesellschaft eingebettet“ werden sollten, damit sie mit schiedlichen Interessen von EKD und SWI miteinander zu
(QUELLE: LkA EKvW 1 neu Nr. 105) an bestehende Strukturen wie den KDA anschloss und ihrem „Absolutheitsanspruch“ nicht das „Gemeinwohl vermitteln“ (SWI 2001: 6).
andererseits neue Bündnispartner wie z. B. die Gewerk- gefährden“ (ebd.).
dann 1983 der Sozialethiker Günter Brakelmann (geb. schaften gewann (mehrfach Projektförderung durch die Den sozialpolitischen Diskussionsprozess im Kontext
1931), der seit 1972 an der Ruhr-Universität Bochum Hans-Böckler-Stiftung, vgl. Brakelmann 2004: 27) und Die Eigen- und Kooperationsprojekte waren das eine; des Sozialwortes hat Günter Brakelmann, der das Insti-
als Professor für Christliche Gesellschaftslehre tätig war, innovative Themenfelder für die Sozialethik erschloss. daneben spielte das SWI auch in seiner Funktion als Be- tut bis 1999 leitete, rückblickend als „Höhepunkt“ der
nebenamtlich die Leitung übernahm. Damit war auf Hier können nur einige Schlaglichter auf die breit entfal- ratungs- und Dienstleistungseinrichtung eine wichtige SWI-Geschichte bezeichnet (Brakelmann 2004: 30).
Vorschlag des Kuratoriums eine neue inhaltliche Aus- tete Tätigkeit des SWI in den Jahren bis 2004 geworfen Rolle. Neben der Mitarbeit an mehreren EKD-Denk- Freilich stand damals schon ein drastischer Kürzungs-
richtung und „Konzentration“ der Institutsarbeit ver- werden (ausführlich siehe den Beitrag von Sigrid Reihs schriften zu Arbeitsthemen und der Sozial- und Wirt- druck im Raum, der 2004 zur Schließung des Bochumer
bunden. Den neuen Themenschwerpunkt markierten in dieser Broschüre). schaftsordnung ist hier vor allem die intensive Mit- SWI und zur Neugründung des SI in Hannover führte.
die Leitbegriffe „Arbeit – Technologie – Wirtschaftsord- wirkung am ökumenischen Konsultationsprozess für Der Rat und die Finanzgremien der EKD hatten bereits
nung“; dementsprechend sollte auch eine Konzentration das Sozialwort der evangelischen und der katholischen „in der intensiven Sparrunde in der Mitte der neunziger
18 19Jahre“ für das SWI ein Einsparziel von 40 Prozent for-
muliert; im Mai 2002 war der Rat auf dieses Ziel zurück-
Ratssitzung vom 5./6.9.2003, Kirchenamt EKD, Az.
4647/4). Die Konferenz der Ruhr-Superintendenten
„Der Status quo kirchlicher Institution kann
gekommen und hatte erneut die schon ältere Idee einer erinnerte die Bedeutung des SWI für die Bewältigung nicht als gegeben vorausgesetzt werden“
„Zusammenführung“ mit der Heidelberger Forschungs- des Strukturwandels im Ruhrgebiet. Und das SWI-Ku-
stätte evangelische Studiengemeinschaft (FEST) aufge- ratorium plädierte mit anderen kirchlichen Einrichtun- Die Pastoralsoziologische Arbeitsstelle und das
worfen (Niederschrift EKD-Ratssitzung 21./22.2.2003, gen aus dem Bereich Sozialethik und Arbeitswelt (KDA, Pastoralsoziologische Institut Hannover 1971-2004
Kirchenamt EKD, Az. 0232/4). Insofern war die fünf- Bundesverband evangelischer Arbeitnehmerorganisa-
jährige Amtszeit des neuen Leiters, des Theologen und tionen, Evangelische Sozialakademie Friedewald) für die Die pastoralsoziologische Arbeit, die seit 1971 in Han-
Sozialwissenschaftlers Hartmut Przybylski-Lohausen Schaffung eines „Kompetenzzentrum[s]“ an mehreren nover erst unter dem Dach der Landeskirche und dann
(1944-2015), von Stellenkürzungs- und Fusionsdebatten Standorten (ebd.). Der Rat schloss sich diesem Vorschlag im Rahmen der Evangelischen Landeskirche erfolgte,
nicht an, vermerkte in seinem Verlegungsbeschluss aber war ebenfalls ein Kind der empirischen Wende und der
ausdrücklich die Notwendigkeit einer weiteren konzep- gesellschaftlichen und kirchlichen Umbrüche der späten
tionellen und organisatorischen Klärung. Sie sollte sich Sechziger Jahre. Und dennoch hatte diese Arbeit, die
an den „veränderten Aufgaben und Bedürfnissen“ orien- 2004 in das neugegründete SI integriert werden sollte,
tieren (ebd.). Damit war angedeutet, dass sich aus Sicht ein anderes Profil. Sie war deutlich dezidierter als das
des Rates die Herausforderungen und damit auch die SWI religions- und kirchensoziologisch ausgerichtet (vgl.
Anforderungen an die Institutionalisierung von Sozial- den Beitrag von Karl-Fritz Daiber in dieser Broschüre).
wissenschaften in der Kirche geändert hatten. Das hängt mit der spezifischen Entstehungsgeschichte
dieses Arbeitsfelds in der hannoverschen Landeskirche
Karl-Fritz Daiber
Eine neue Richtung nahm die Diskussion, als sich zu zusammen: Sein Entstehungskontext sind die Kirchen- (QUELLE: LKArchivH)
Jahresbeginn 2004 die Möglichkeit einer „Kooperation reformbestrebungen um 1970, besonders aber die Über-
mit dem Pastoralsoziologischen Institut der hannover- legungen zur Reform des Vikariats. 1968 hatte der zu- Institutionalisierung, auch wenn die Gründung eines
schen Landeskirche“ (sic) verdichtete (Niederschrift ständige Ausbildungsdezernent im Landeskirchenamt Instituts erst 1998, zwei Jahre nach seinem Ruhestand,
EKD-Ratssitzung 20./21.2.2004, Kirchenamt EKD, Az. eine „Reform des landeskirchlichen Vorbereitungsdiens- erfolgte. Zwar beriefen sich Vertreter des Landeskirchen-
0232/4). Diese Gespräche mit der hannoverschen Kir- tes“ diskutiert (Fuhrmann 1968); als wesentliche Treiber amtes darauf, „dass zunächst ‚klein‘ begonnen werden
chenleitung führten sehr schnell zum Ergebnis: Im April dieser Reform erwiesen sich die Vikar*innen, die 1969 solle und später erst die die Errichtung eines Amtes in
2004 begrüßte der Rat der EKD die „Bereitschaft der zur Stärkung der Human- und Sozialwissenschaften die Frage kommen könne“ (Nachweis Schendel 2015: 377).
evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und Errichtung mehrerer Fachinstitute vorgeschlagen hatten. Doch trotz dieser eher tastenden Amtslogik konnte Dai-
der Evangelischen Fachhochschule Hannover, das Pasto- Analog zum bereits bestehenden Religionspädagogi- ber erreichen, dass zunächst die Idee einer Arbeitsstelle
ralsoziologische Institut als einen besonderen Arbeitsbe- schen Institut plädierten sie auch für die Schaffung eines weiterverfolgt wurde; im Frühjahr 1972 konnte er au-
Hartmut Przybylski-Lohausen, Leiter SWI 1999-2004
(QUELLE: epd Bild) reich in das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD ein- sozialwissenschaftlichen Instituts (zum folgenden vgl. ßerdem die „Ausschreibung von zwei Soziologenstellen
zufügen“ (Niederschrift EKD-Ratssitzung 23.4.2004, Schendel 2015: 376ff.). für den Bereich der Aus- und Fortbildung“ (Nachweis
geprägt. Als die Fusion mit der FEST sich in den Augen Kirchenamt EKD, Az. 0232/4). Auf dieser Grundlage ebd.) erwirken. Damit blieben die Zusagen hinter den
aller Beteiligten als ein wenig sinnvoller Plan erwies, be- wurde ein Kooperationsvertrag mit der hannoverschen Zu diesem Grad der Institutionalisierung kam es lan- weitgespannten Institutsplänen zurück, die Daiber im
schloss der Rat im März 2003, „die Verlagerung des SWI Landeskirche ausgehandelt, den der Rat der EKD im Juni ge nicht: Als der aus Württemberg berufene Theologe Landeskirchenamt unter Verweis auf entsprechende Zu-
an den Standort des Kirchenamtes der EKD zu prüfen“ 2004 billigte. Zugleich beschloss der Rat die Schließung und Sozialwissenschaftler Karl-Fritz Daiber (geb. 1931) sicherungen vorstellte: Neben der Aus- und Fortbildung
(ebd.). Im September 2003 fiel im Rat die Entscheidung des SWI in Bochum zum 30. September 2004 und die im September 1971 nach Hannover kam und in der schlug er den Aufbau von zwei weiteren Arbeitsfeldern
über die Verlegung des Instituts nach Hannover (Nieder- Neugründung des SI „mit Sitz in Hannover“ (Nieder- Vikarsausbildung den neugeschaffenen Schwerpunkt vor; sie sollten der „Soziologischen Beratung“ in der
schrift EKD-Ratssitzung 5.9.2003, Kirchenamt EKD, schrift EKD-Ratssitzung 23.4.2004, Kirchenamt EKD, „Gemeindeaufbau/Sozialwissenschaften“ übernahm, Landeskirche und der „Theologische Sozialethik“ gel-
Az. 0232/4). Az. 4647/10). Nach 35-jährigem Wirken am Standort musste er sich die Strukturen für seine Arbeit erst schaf- ten (Nachweis ebd.). Freilich konnte 1974 auch für Fra-
Bochum nahm das SWI im September 2004 mit einer fen. Das Landeskirchenamt hatte das neue Arbeitsfeld, gen der Gemeindeberatung eine Soziologin eingestellt
Dieser Entscheidung waren mehrere Eingaben voraus- Tagung zum „Funktions- und Bedeutungswandel der in dem Daiber als „Ein-Mann-Institut“ (Daiber) ohne werden; sie trieb in den Folgejahren den Aufbau des
gegangen, die die Verlegung verhindern wollten: Lei- Arbeit“ Abschied – nicht ohne Hinweis darauf, dass auch weitere Ausstattung begann, rechtlich dem Aus- bzw. Arbeitsbereichs Gemeindeberatung und Organisations-
tung und Mitarbeitervertretung verwiesen auf die hohen künftig „so etwas wie ein[...] sozial engagierte[r] Protes- Fortbildungsdezernat und sachlich dem Sozialpfarramt entwicklung voran, der bis heute zahlreiche Gemeinde-
Kosten einer Verlegung, vor allem aber auf die Härten tantismus“ nötig sei (Brakelmann 2004: 32). zugeordnet. Jedoch gelangen Daiber im ersten halben berater*innen qualifiziert und koordiniert.
für die Mitarbeitenden des SWI (vgl. Vorlage für die Jahr seiner Arbeit wesentliche Schritte auf dem Weg zur
20 21Vorgehen, das der Initiative Einzelner aber auch Raum die Fachhochschule (Biermann/Kampermann 2001: pastoralsoziologischem und sozialethischem Schwer-
gab. Die Probleme, für die eine Lösung gesucht wurde, 17), und zwar als eigenes Pastoralsoziologisches Institut punkt. Im Team des neuen Instituts befanden sich vier
lagen zunächst im Bereich der Ausbildung der Theo- (PSI). Zur Institutsleiterin wählten die Mitarbeitenden Mitarbeitende des PSI; außerdem waren zwei Mitarbei-
log*innen, dann aber auch in den kirchlichen Struktu- die Soziologin Ingrid Lukatis (geb. 1943). Allerdings tende des SWI der Neugründung aus Bochum nach
ren, die unter dem Eindruck der damaligen kyberneti- war mit dieser Integration noch keine stabile neue Ins- Hannover gefolgt. Am 12. Januar 2005 erfolgte die fei-
schen Diskussion reformiert werden sollten. Angesichts titutionalisierung erreicht: Der Beschluss über den Weg- erliche Eröffnung des SI. In seinem Grußwort betonte
der Konkretheit dieser Probleme waren die genannten fall der PSI-Stellen (bis auf den Erhalt einer sozialwis- der damalige EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber
Arbeitsfelder der PSA – zumal im damaligen Reformkli- senschaftlichen Professur) galt weiterhin und stellte die die Bedeutung des neuen Instituts, nicht ohne seine An-
ma – unmittelbar plausibel. Die Arbeitsstelle konnte sich Arbeitsfähigkeit des Instituts nach dem Jahr 2005 infrage erkennung für die Arbeit der Vorgängereinrichtungen
mit ihrer umfangreichen Tätigkeit (vgl. Daiber in dieser (Terbuyken 2001: 119). Zudem war die genaue Form
Broschüre) schnell ein großes Renommee erwerben, der strukturellen Eingliederung noch offen: Der dama-
obwohl oder gerade weil Daibers pastoralsoziologischer lige Rektor der Fachhochschule schlug 2001 die Integ-
Ansatz von vornherein eine ideologiekritische Stoßrich- ration in ein neuzugründendes „Institut für Forschung,
tung implizierte, die weniger an Systemstabilisierung als Weiterbildung und Beratung“ vor und versprach, „dass
an der „Möglichkeit einer konfliktorientierten kirchli- das PSI nicht abgewickelt, sondern transformiert wird“
chen Arbeit“ interessiert war (Daiber 1973). (Terbuyken 2001: 120). Die Neuformierung eines ent-
sprechenden Instituts erfolgte in den folgenden Jahren
jedoch nicht (Fachhochschule Hannover 2008: 18; Lan-
deskirchenamt Hannover 2008: 294).
Angesichts dieser unklaren Perspektive ist es erklärlich,
dass die Landeskirche im Jahr 2004 so schnell bereit war,
über die Integration des PSI in das Sozialwissenschaftliche Ratsvorsitzender Wolfgang Huber und SI-Direktor Gerhard Wegner
Institut der EKD nachzudenken und das PSI schließlich (QUELLE: epd Bild)
in das neue SI der EKD „einzufügen“. Faktisch vollzog
sich dieser Schritt so, dass das SI in das bisherige Gebäude und sein Verständnis für die „Enttäuschungen und Ver-
der PSI auf dem Campus der Fachhochschule einzog. Mit letzungen“ zu betonen, mit denen der Weg zum neuen
diesem Schritt ging allerdings die Abtrennung der Ge- Institut für die Mitarbeitenden der Vorgängerinstitute
meindeberatung und Organisationsentwicklung einher, verbunden gewesen sei (Huber 2005).
die in das landeskirchliche Haus kirchlicher Dienste in-
tegriert wurde (Landeskirchenamt Hannover 2008: 65). Interessant ist die Problembeschreibung, mit der Huber
und der neue Direktor in ihren Beiträgen die Etablierung
und die Notwendigkeit des neuen Instituts begründeten.
„Gesellschaftliche Präsenz der Kirche Huber sah die „Kooperation zwischen Landeskirche und
EKD“ als „wegweisend[es]“ Beispiel für die „intelligen-
Elke Möller
nicht ohne sozialwissenschaftliche und te Bündelung von Ressourcen“ (Huber 2005), was sich
(QUELLE: Privatbesitz)
sozialethische Kompetenz“ seinerseits als Beleg für die damals bewusst forcierte „Or-
ganisationswerdung“ der Kirche deuten lässt (Hauschildt
Ingrid Lukatis, Wolfgang Lukatis
(QUELLE: LKArchivH) Dennoch geriet auch die PSI Mitte der Neunziger Jahre Das neue Sozialwissenschaftliche Institut / Pohl-Patalong 2013: 214). Prägend war zugleich das
in den Strudel der Kürzungsdebatte. Nach Einschlagen Bewusstsein „tiefgreifend sozialer Veränderungen“, von
Dieser Überblick zeigt: Die drei Jahre dauernde Etablie- des Sparkurses erklärte die Landessynode vier Personal-
der EKD (SI) ab 2004 denen Huber „sowohl die Kirche auf allen Ebenen wie
rung der Pastoralsoziologischen Arbeitstelle in der han- stellen der PSA für künftig wegfallend und beschloss, „die auch die Gesellschaft insgesamt“ geprägt sah. Konkrete
noverschen Landeskirche verlief deutlich anders als der PSA zur Evangelischen Fachhochschule zu verlagern“ Am 1. Oktober 2004 nahm das neuformierte Sozial- Beispiele waren die gewandelte „Rolle von Religion“ in
Aufbau des Bochumer SWI. Typisch für das hannover- (Wöller 1996: 7). Diese Verlagerung wurde nach dem wissenschaftliche Institut der EKD (SI) in Hannover der Gesellschaft, der „religiöse Pluralismus“ und die „im-
sche Projekt einer Institutionalisierung der Sozialwissen- Eintritt von Karl-Fritz Daiber in den Ruhestand (1996) seine Arbeit auf. Als Gründungsdirektor war Gerhard mensen Herausforderungen des sozialen Wandels“ (Hu-
schaften in der Kirche war das tastende und schrittweise umgesetzt: 1998 erfolgte die „Integration“ der PSA in Wegner (geb. 1953) berufen worden, ein Theologe mit ber 2005), aber auch die damalige Sozialgesetzgebung
22 23(Hartz IV) und die „Kommunikationsprobleme der Kir- Institutsidee stand) über „empirische Forschung“ (wie und Interessen erinnert. Damit war auch die Entwick-
che“ bei bestimmten soziokulturellen Milieus (Wegner sie in der SI-Ordnung als Aufgabe genannt wird) bis zur lung der Institutionen deutlich mehr von Veränderung
2005). Die Herausforderungen, vor denen Huber und Gestaltung öffentlichkeitswirksamer Ausstellungen, z. B. und Diskontinuität geprägt, als der Verweis auf „50 Jahre
Wegner die Kirche sahen, betrafen damit sowohl ihre auf dem Kirchentag oder 2017 bei der Weltausstellung Sozialwissenschaftliches Institut der EKD“ suggeriert.
eigene Sozialgestalt als auch die Frage nach ihrer sozial- der Reformation. Der Rückblick auf die letzten Jahre Trotzdem bleibt jene Überschrift, die 1969 über dem
ethischen Positionierung. führt vor Augen, dass das Interesse kirchlicher Leitungs- Bericht zur SWI-Eröffnung stand, ebenso richtig wie
ebenen an der Evaluation von Arbeitsfeldern und Um- herausfordernd und zukunftsweisend: „Sozialer Struk-
Wozu sollte das SI in komplexer werdenden Zeiten die- bauprozessen weiterhin steigt. Hier wird eine Folge der turwandel erfordert kirchliche Forschung“.
nen? Huber verwies auf den notwendigen Beitrag „so- bereits erwähnten Organisationswerdung der Kirche
zialwissenschaftliche[r] und sozialethischer Kompetenz“ deutlich; damit nimmt der Bedarf an der externen Be-
für die „gesellschaftliche Präsenz der Kirche“: Gerade von wertung, Begründung und z. T. auch Legitimierung von
einem kirchlichen, nichtuniversitären Institut erhoffte er Entscheidungen zu (vgl. den Beitrag von Birgit Kloster-
sich eine Bündelung der Kompetenz, damit „sie unmit- meier in dieser Broschüre). Hier stößt das SI auf eine ge-
telbar für die kirchlichen Handlungsaufgaben fruchtbar wachsene Nachfrage nach seinen Leistungen, aber auch
gemacht wird“. Um die Handlungsfähigkeit der Kirche Das erste Team des SI (2005), v.l.n.r. G. Wegner, H. Grosse, W. v. Nathusius, H. Jablo-
auf ein Interesse an Beratung.
zu gewährleisten, sei eine „solide Bestandsaufnahme und nowski, I. Messmer-Klingen, M. Zeeb, J. Rinderspacher, P.-A. Ahrens, I. Lukatis, W. Lukatis
eine gründliche, wissenschaftlich fundierte und kriti- (QUELLE: SI-EKD) Besondere Erwähnung verdienen jedoch auch die Pro-
sche Anfragen berücksichtigende Analyse“ erforderlich. jekte, die das SI-Team auf eigene Initiative durchführt.
In diesem Sinn bezeichnete er das SI als „sozialwissen- Eine Besonderheit des SI ist das „besondere, vertraglich Als Beispiel dafür lässt sich der soziologisch und theo-
schaftliche[s] und sozialethische[s] Kompetenzzentrum“ geregelte Kooperationsverhältnis“ zur Evangelisch-lu- logisch grundierte Diskussionsprozess nennen, den das
(Huber 2005), was über die Reduzierung auf einen rei- therischen Landeskirche Hannovers (Ordnung, § 2), das SI im Jahr 2007 nach der Veröffentlichung des EKD-Re-
nen wissenschaftlichen Dienstleister hinausging. sich dem Kooperationsvertrag von 2004 entsprechend formpapier „Kirche der Freiheit“ angeregt hat (SI 2007).
in mehreren Regelungen dokumentiert (Kooperations- Seit einigen Jahren werden solche Eigenprojekte vor al-
Das hier formulierte Profil des neuen Instituts erinnert vertrag über die Nutzung des SI der EKD, Juni 2004, lem in Form von „Leitprojekten“ durchgeführt. Die bis- Nach Ablauf der Probezeit wurde der Kooperationsvertrag mit der hannoverschen
an vieles, was 2004 bereits in der Ordnung für das SI Kirchenamt EKD, Az. 4647/10). Die Landeskirche be- herigen Leitprojekte galten der Grundlagenforschung im Landeskirche aktualisiert, v.l.n.r. G. Wegner, Präsident H. Barth, Präsident E.v. Vietinghoff
(QUELLE: SI)
festgeschrieben war. Danach ist das Institut dezidiert für teiligt sich am SI mit einem vereinbarten Kostenbeitrag Bereich der Kirchengemeinde (Rebenstorf et al. 2015)
beide Themenfelder zuständig, für die „Sozialethik“ incl. und kann dafür Leistungen des SI im selben Umfang in sowie dem Verhältnis von Kirche und Zivilgesellschaft.
„Sozialpolitik“ und „Arbeitswelt“ genauso wie für die Anspruch nehmen (dies geschieht zum Beispiel durch die Das aktuelle Projekt beschäftigt sich mit zivilgesellschaft-
„Pastoralsoziologie“ (Ordnung für das SI, 2004, § 2). Da- Mitwirkung im Predigerseminar Loccum). Im Vorstand, lichem Engagement am Beispiel des Engagements im
mit wurden die Schwerpunkte der beiden Vorgängerins- dem Steuerungsgremium des SI, ist die Landeskirche ge- Rahmen der Flüchtlingsthematik.
titute im SI kombiniert, und zwar unter bewusster Beto- nauso wie die EKD mit zwei Personen vertreten. Außer-
nung der Interdiszplinarität („insbesondere theologische, dem ist bei der Berufung der Institutsleitung das „Ein- Seit dem Jahresende 2011 hat das Institut seine Räum-
sozialwissenschaftliche und ökonomische Kompetenz“). vernehmen zwischen der EKD und der Landeskirche“ lichkeiten in der Innenstadt Hannovers, und zwar im
Genauso wie das SWI ist das SI eine rechtlich unselbstän- erforderlich (§§ 4-6). Diese Regelungen (die seit 2004 neu konstituierten Friedrich Karrenberg Haus. In die-
dige Einrichtung, die bestimmte Dienstleistungsfunktio- mehrfach aktualisiert wurden) sind mehr als nur eine sem Haus arbeiten auch der Evangelische Verband Kir-
nen wahrnimmt („wird [..] auf Anforderung als wissen- historische Reminiszenz, eine Erinnerung an die Ver- che-Wirtschaft-Arbeitswelt (KWA) und das Studienzen-
schaftlicher Dienst tätig“), ohne dass die Institutstätigkeit schmelzung von SWI und PSI. Vielmehr zeigt sich hier trum der EKD für Genderfragen. Somit bietet sich dem
darin aufgeht. Ausdrücklich genannt sind die Vernetzung der Wille, die neugeschaffene Struktur auch in Zukunft SI heute auch in der direkten Nachbarschaft die Chan-
und die „Kooperation“ mit Universitäten, Akademien gemeinsam zu nutzen. ce einer vielfachen Vernetzung (die noch intensiver ge-
und der Fort- und Weiterbildung – ein neuer Passus im nutzt werden könnte). Die Benennung des Hauses nach
Vergleich zu den Ordnungen des SWI. Hier wird das de- Das SI der EKD hat in den Jahren seit 2004 mit seinen Friedrich Karrenberg erinnert dabei an einen Pionier je-
zidierte Interesse an wissenschaftlicher Kompetenz deut- Projekten, Publikationen und thematischen Akzentset- ner Institutionalisierung der Sozialwissenschaften in der
lich, das sich auch in der erneuten Einrichtung eines Wis- zungen eine sehr vielfältige Wirkung entfaltet (s. den Kirche, um die es in diesem Beitrag ging. Der Blick auf
senschaftlichen Beirats ausdrückt. Beitrag von Gerhard Wegner in dieser Broschüre). Die die vergangenen fünfzig Jahre hat nicht nur Kontinui-
Aktivitäten des SI reichen von der traditionellen Mit- tätslinien aufgezeigt, sondern auch an mehrfache Para-
wirkung an Denkschriften (die 1963 am Anfang der digmenwechsel sowie an sich ändernde Problemanalysen
24 25Sie können auch lesen