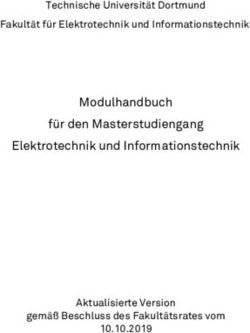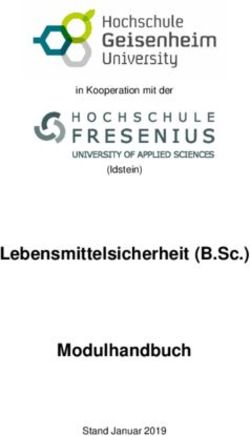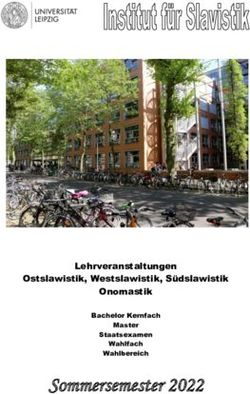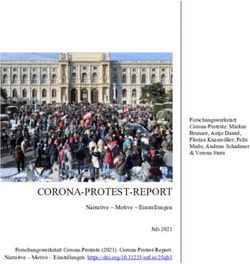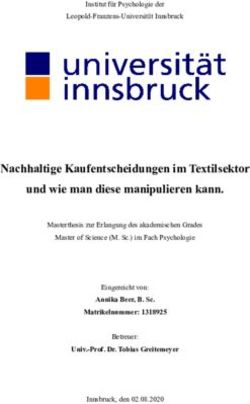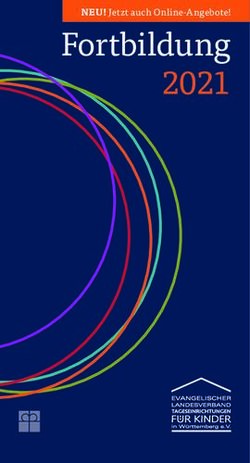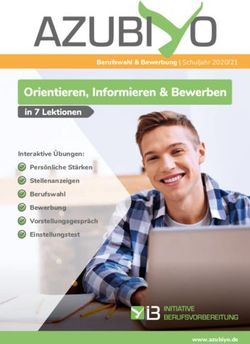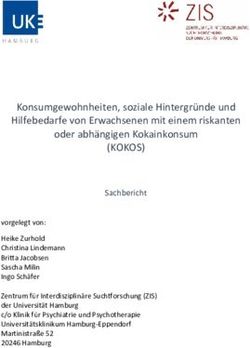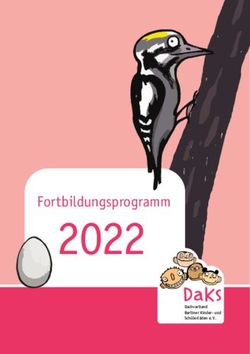Studie zur Qualitätssteigerung und -sicherung in der curricularen Neustrukturierung des Sachkundeerwerbs in der Zahnärztlichen Radiologie - HHU
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Aus der Poliklinik für Kieferorthopädie
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dieter Drescher
Studie zur Qualitätssteigerung und -sicherung in
der curricularen Neustrukturierung des
Sachkundeerwerbs in der Zahnärztlichen
Radiologie
Dissertation
zur Erlangung des Grades eines Doktors der Zahnmedizin
der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
vorgelegt von
Sophie Marie Ylinen
2021Als Inauguraldissertation gedruckt mit der Genehmigung der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gez.: Dekan: Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaj Klöcker Erstgutachterin: PD Dr. med. dent. Kathrin Becker Zweitgutachter: Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Jörg Handschel
Zusammenfassung
Die Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefer (ZMK)-Erkrankungen ist eine
der wichtigsten Aufgaben von Zahnärzten. Zahlreiche Befunde mit ossärer
Beteiligung können röntgenologisch bereits viel früher als in der Phase der
klinischen Manifestation ersichtlich sein. Ungeachtet der hohen Inzidenzen
maligner Erkrankungen im ZMK-Bereich fehlt ein systematisches Training der
Befundung von Röntgenbildern im zahnärztlichen Curriculum. Ein zu spätes
Erkennen maligner Pathologien kann nicht nur für den Patienten gravierende
Konsequenzen haben, sondern auch zu einer erheblichen Kostensteigerung im
Gesundheitssystem führen. Um Zahnmedizinstudierenden die Möglichkeit zu
bieten, ihre Radiologie-Kenntnisse interaktiv, zeitlich und örtlich flexibel zu
überprüfen und zu vertiefen, wurde an der Heinrich-Heine-Universität (HHU) die
elektronische Radiologie-Plattform CONRAD, benannt nach dem Entdecker der
Röntgenstrahlen Wilhelm Conrad Röntgen, entwickelt. Ziel der vorliegenden
Doktorarbeit war es, im Rahmen einer prospektiven Kohortenstudie die
Effektivität dieser Plattform in der Einführungsphase zu evaluieren.
Zahnmedizinstudierende im klinischen Studienabschnitt erhielten kostenfreien
Zugang zur neuen E-Learning-Umgebung. Der Lernzuwachs wurde zu Beginn
und Ende eines Semesters mithilfe von E-Klausuren auf der elektronischen
Plattform ILIAS (Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-
System) ermittelt. In den E-Klausuren der Pilotphase im Wintersemester (WS)
2016/17 wurden die Klausurfragen validiert. Im Sommersemester (SS) 2017
wurde die erste Testphase durchgeführt. Die Klausuren bestanden
ausschließlich aus validierten Klausurfragen mit Trennschärfen ≥ 0,25.
Die Fragen der E-Klausuren in der ersten Testphase wurden unter
Berücksichtigung folgender Aufteilung der Item-Schwierigkeiten erstellt: 15%
einfach, 49% angemessen, 25% mittelschwer, 10% schwierig und 1% sehr
schwierig. Die Unterschiede im Lernerfolg zwischen Eingangs- und
Abschlussklausuren wurden mittels Statistikprogramm R unter Benutzung des
paired t-Tests berechnet (p < 0,05). Außerdem wurde mittels Fragebögen die
Zufriedenheit der Studierenden mit der Plattform evaluiert.
In der Pilotphase im WS 2016/17 wurde eine Verbesserung der Ergebnisse
verzeichnet, die allerdings nicht signifikant war. In der ersten Testphase im SS
2017 wurde eine signifikante Verbesserung der Ergebnisse in zwei von drei
Semestern erzielt. In der Befragung äußerten die Studierenden Zufriedenheit
mit dem elektronischen Lernangebot. Die E-Learning-Plattform erwies sich
angesichts der signifikanten Steigerung des Lerneffekts in der ersten Testphase
und des hohen Zufriedenheitsgrades der Studierenden als geeignetes
Lernmedium. Die ILIAS-E-Klausuren sind gegenwärtig Teil der Klinik und
Poliklinik für ZMK-Kursordnung. Bei Erreichen der 70-Prozent-Grenze bei den
E-Abschlussklausuren im siebten, achten und neunten Semester, können sich
seit 2019 Studierende an der HHU die Hälfte ihrer 100 Röntgenbefunde für die
Radiologie-Sachkunde gutschreiben lassen.
IAbstract
Detecting pathologies of the mouth and jaw is one of the most important
responsibilities of dentists when diagnosing dental radiographs. Many
pathologies can be detected on radiographs a lot earlier than the clinical
manifestation. Despite high incidences, diagnostic skills are often not
systematically trained in dental schools. As a result, malignant pathologies may
be diagnosed too late, which might have fatal consequences to the patient. A
virtual e-learning platform CONRAD, named after the founder of x-rays, Wilhelm
Conrad Röntgen, was developed to provide undergraduate students with an
interactive way to improve their radiological skills. The learning effects were
evaluated within a prospective cohort study.
Students attending a three-semester clinical course for dental and craniofacial
diseases were given free of charge access to the new e-learning platform. To
evaluate the improvement of students’ diagnostic skills after using CONRAD,
electronic exams were conducted at the beginning and end of each semester
using the ILIAS platform, an open source, web based learning management
system. The questions used were validated beforehand during a pilot phase in
the winter semester of 2016/17. The test period ran in the summer semester of
2017. The electronic exam in the summer semester of 2017 included only
validated questions with discriminatory powers ≥ 0,25.
The test was set up with the following distribution of difficulties for the questions:
10% easy, 49% moderate, 25% moderately difficult, 10% difficult and 1% very
difficult. The results were analyzed by using the statistics software R and a
paired t-test (p < 0,05). Students’ satisfaction with the platform was evaluated
by using opinion polls.
In the winter semester of 2016/17 there was an improvement of the students‘
diagnostic skills, which was not significant. In the summer semester of 2017
though, a significant improvement was noted in two of the three semester
courses. The opinion polls revealed high satisfaction with the e-platform.
The e-learning platform proved to be a qualified method for improving students’
diagnostic skills by showing a significant learning improvement in the test phase
in two of three semester courses, and high satisfaction of the students. Due to
the findings of this study, the e-exams on the ILIAS platform are now an
obligatory part of the three-semester course for dental and craniofacial
diseases. If students answer 70 percent or more questions correctly in all three
tests at the end of each semester, they will earn bonus points for their requisite
qualification in radiology.
IIAbkürzungsverzeichnis
Abb. Abbildung
bzw. beziehungsweise
HHU Heinrich-Heine-Universität
ILIAS Integriertes Lern-, Informations- und
Arbeitskooperations-System
RKI Robert Koch-Institut
SS 17 Sommersemester 2017
vs. versus
WS 16/17 Wintersemester 2016/17
ZfKD Zentrum für Krebsregisterdaten
ZIM Zentrum für Informations- und Medientechnologie
ZMK Zahn, Mund und Kiefer
IIIInhaltsverzeichnis
1 Einleitung ................................................................................................................ 1
1.1 Lehre der Zahnärztlichen Radiologie ................................................................... 1
1.2 Fachkundeerwerb der Zahnärztlichen Radiologie ............................................... 2
1.3 Diagnose von ZMK-Erkrankungen ...................................................................... 3
1.4 Neues radiologisches Curriculum ........................................................................ 4
1.4.1 Planung der neuen E-Learning-Tools ............................................................ 5
1.4.2. Radiologischer E-Learning-Atlas CONRAD.................................................. 7
1.5 E-Learning vs. konventionelles Lernen ............................................................... 8
1.6 Ziele der Arbeit .................................................................................................. 10
2 Material und Methoden ........................................................................................ 11
2.1 Aufbau der E-Learning-Plattform ....................................................................... 11
2.1.1 Framework der CONRAD-Plattform ............................................................ 12
2.1.2 Annotationen ............................................................................................... 12
2.1.3 Interaktive Features der Plattform ............................................................... 12
2.1.4 Ergänzende Histopathologien ..................................................................... 14
2.2 Leistungsüberprüfung über ILIAS-E-Klausuren ................................................. 15
2.2.1 Itemanalyse der E-Klausurfragen ................................................................ 15
2.2.2 Fragetypen .................................................................................................. 16
2.3 Durchführung der E-Klausuren .......................................................................... 18
2.3.1 Eingangsklausur im Wintersemester 2016/17 ............................................. 18
2.3.2 Abschlussklausur im Wintersemester 2016/17 ............................................ 19
2.3.3 Eingangsklausur im Sommersemester 2017 ............................................... 19
2.3.4 Abschlussklausur im Sommersemester 2017 .............................................. 20
2.4 Fragebögen ....................................................................................................... 20
2.5 Teilnehmende der Studie .................................................................................. 21
2.5.1 Teilnehmende im Wintersemester 2016/17 ................................................. 22
2.5.2 Teilnehmende im Sommersemester 2017 ................................................... 22
2.6 Studienaufbau ................................................................................................... 23
2.7 Statistik .............................................................................................................. 25
3 Ergebnisse ............................................................................................................ 25
3.1 Ergebnisse der E-Klausuren.............................................................................. 26
3.1.1 Ergebnisse Wintersemester 2016/17........................................................... 27
3.1.2 Ergebnisse Sommersemester 2017 ............................................................ 30
3.2 Analyse der Plattformnutzung ........................................................................... 33
3.3 Probanden ......................................................................................................... 34
3.4 Ergebnisse der Fragebögen .............................................................................. 34
3.4.1 Fragebögen im Wintersemester 2016/17 .................................................... 34
3.4.2 Fragebögen im Sommersemester 2017 ...................................................... 38
4 Diskussion ............................................................................................................ 42
4.1 Umsetzung des Projektziele an der HHU .......................................................... 42
4.1.1 E-Learning-Atlas CONRAD ......................................................................... 43
4.1.2 E-Klausuren und elektronischer Sachkundeerwerb ..................................... 44
4.2 Diskussion von Material und Methoden ............................................................. 46
4.2.1 Studiendesign .............................................................................................. 46
4.2.2 Teilnehmende der Studie ............................................................................ 48
4.2.3 Lernplattform ............................................................................................... 50
4.2.4 E-Klausuren ................................................................................................. 51
IV4.2.5 Fragebögen ................................................................................................. 53
4.3 Diskussion der Ergebnisse ................................................................................ 54
4.3.1 E-Klausurergebnisse ................................................................................... 55
4.3.2 Ergebnisse der Fragebögen ........................................................................ 57
4.4 Schlussfolgerungen ........................................................................................... 60
4.4.1 E-Learning-Plattform CONRAD ................................................................... 60
4.4.2 Sachkunde der Zahnärztlichen Radiologie .................................................. 61
5 Literatur- und Quellenverzeichnis ...................................................................... 63
6 Anhang .................................................................................................................. 69
V1 Einleitung
1.1 Lehre der Zahnärztlichen Radiologie
Die zahnärztliche Approbationsordnung aus dem Jahr 1955 stellt bis dato
weitgehend unverändert die Richtlinien für das Zahnmedizinstudium dar.
Angesichts der Entwicklungen im Bereich der Zahnmedizin und der
Anforderungen an eine zeitgemäße Lehre ist eine Neuregelung der
zahnärztlichen Ausbildung dringend erforderlich. Deshalb wird zurzeit an einer
Novellierung der zahnärztlichen Approbationsordnung gearbeitet (1). Diese
Neuregelung ist auch im Fach Zahnärztliche Radiologie unerlässlich, da es seit
dem Jahr 1955 bei den Anforderungen und Gewichtungen für das Curriculum
Radiologie kaum Veränderungen gegeben hat, obwohl sich im Laufe der Zeit
auch in diesem Fachbereich viel geändert hat.
Ungeachtet der Tatsache, dass heutzutage beinahe jeder Zahnarzt ein eigenes
Röntgengerät besitzt, wird der Radiologie im Studium eher geringe Bedeutung
beigemessen. Zum einen ist bis zu diesem Datum im zahnärztlichen Examen
die Zahnärztliche Radiologie nur eines von drei Teilprüfungsfächern des
Prüffaches Chirurgie und wirkt sich somit mit nur einem Drittel auf die
Gesamtnote dieser Teilprüfung des zahnärztlichen Examens aus. Zum anderen
gibt es im Studium selbst bis heute nur einen einzigen Semesterkurs, in dem
ausschließlich radiologische Inhalte unterrichtet werden. Dabei handelt es sich
um den im sechsten Semester unterrichteten Radiologischen Kursus mit
besonderer Berücksichtigung des Strahlenschutzes, welcher sich aus einer
semesterübergreifenden Vorlesungsreihe und einem einwöchigen
Röntgenpraktikum während der vorlesungsfreien Zeit zusammensetzt. Im
achten und neunten Studiensemester besuchen die Studierenden noch
zusätzlich eine interdisziplinäre Vorlesung zu speziellen Zahn- Mund- und Kiefer
(ZMK)-Erkrankungen, in der im Zusammenhang mit verschiedenen Pathologien
unter anderem auch Röntgenbilder besprochen werden. Radiologische
Befunde werden darüber hinaus in Fächern wie Kieferorthopädie,
Zahnerhaltung, Prothetik und zahnärztliche Chirurgie fallorientiert und somit nur
1unsystematisch besprochen. Für die Vermittlung eines Gesamtbildes und für
ein vertieftes Verständnis der Röntgenbefunde bei den Studierenden bedarf es
jedoch didaktisch gesehen eines übersichtlichen und systematischen Aufbaus
des Radiologie-Unterrichtsangebotes sowie verbesserter und modernerer
Möglichkeiten für Training und Selbststudium. Vor dem Hintergrund der oben
angesprochenen Tatsachen scheint die Radiologie im Zahnmedizinstudium als
Studienfach insgesamt eine untergeordnete Stellung einzunehmen.
1.2 Fachkundeerwerb der Zahnärztlichen Radiologie
An der Heinrich-Heine-Universität (HHU) Düsseldorf wird den Studierenden der
Zahnmedizin die Möglichkeit geboten, im Rahmen ihres Staatsexamens auch
die Bescheinigung über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz zu
erwerben. Damit erhält der Zahnarzt die rechtliche Befähigung, für
diagnostische Zwecke intraorale Röntgenaufnahmen,
Panoramaschichtaufnahmen und Fernröntgenaufnahmen des Schädels
anzufertigen und zu befunden.
Um die Fachkunde im Strahlenschutz zusammen mit der bestandenen
Zahnärztlichen Prüfung zu erlangen, müssen die Studierenden sowohl die
Sachkunde als auch Kenntnisse im Strahlenschutz erwerben. Die Sachkunde
umfasst sowohl praktisches als auch theoretisches radiologisches Wissen. Im
Mittelpunkt steht dabei das Erlernen der rechtfertigenden Indikation sowie die
korrekte Befundung verschiedener Typen von Röntgenaufnahmen.
Die Kenntnisse im Strahlenschutz erwerben Zahnmedizinstudierende im
Rahmen des Radiologischen Kursus mit besonderer Berücksichtigung des
Strahlenschutzes. An der Heinrich-Heine-Universität werden die theoretischen
Grundlagen in einer Vorlesungsreihe im ersten klinischen Semester gelehrt,
während die Studierenden im Rahmen eines einwöchigen Praktikums die
technische Durchführung mittels Aufnahmeübungen an Phantommodellen mit
anschließender Befundung erlernen.
2Der Erwerb der Radiologie-Sachkunde an der Heinrich-Heine-Universität setzte
bis Sommer 2018 die Befundung von 100 selbst gewählten Röntgenbildern in
Papierform voraus. Die Befunde wurden von einer fachkundigen Lehrperson
korrigiert und im Anschluss daran mit dem Kandidaten besprochen.
Dieses Vorgehen ist bei Gewährleistung einer adäquaten Betreuung sehr zeit-
und kostenaufwändig. Bei einer Besprechungszeit von 5 Minuten pro
Röntgenbild und einer Semesterstärke von 30 Studenten beliefe sich der
Arbeitsaufwand auf 250 Stunden pro Semester. Diese theoretisch benötigte Zeit
war jedoch nicht in den curricularen Normwerten abgebildet. Für die
Besprechung der Röntgenaufnahmen steht deshalb nicht genügend Personal
zur Verfügung. Da eine korrekte und vollständige Befundung von
Röntgenaufnahmen in der frühen Erkennung von Malignitäten einen sehr hohen
Stellenwert im Gesundheitssystem hat (siehe Absatz 1.3), bestand hier
dringender Handlungsbedarf.
Ein weiterer potenziell nachteiliger Faktor war die fehlende Standardisierung
der zu befundenden Röntgenaufnahmen in der Radiologie-Sachkunde. Die
Auswahl der 100 Röntgenaufnahmen war den Studierenden selbst überlassen,
was häufig zur Folge hatte, dass diese bei ihrer Auswahl Aufnahmen mit
wenigen pathologischen Auffälligkeiten bevorzugten und somit die Befundung
der verschiedenen ZMK-Erkrankungen nicht systematisch und ordnungsgemäß
geübt wurde.
1.3 Diagnose von ZMK-Erkrankungen
Es ist davon auszugehen, dass Fehlinterpretationen oder Nichterkennen
maligner Befunde für den Patienten fatale Folgen haben können. Studierenden
war es aufgrund der fehlenden Definition von Anforderungen und
standardisierter Leistungsüberprüfungen jedoch möglich, auch mit
gravierenden Wissenslücken die Fachkunde im Strahlenschutz zu erwerben.
Möglicherweise hat dies auch eine Bedeutung für das Gesundheitssystem, da
3Zahnärzten eine wichtige Rolle in der frühzeitigen Diagnose von ZMK-
Erkrankungen zukommt.
Laut Daten des Zentrums für Krebsregisterdaten (ZfKD) des Robert Koch-
Instituts (RKI) aus dem Jahr 2016 (korrigierte Fassung vom 17.08.2020) liegt in
Deutschland die jährliche Inzidenz für Krebsneuerkrankungen der Mundhöhle
und des Rachens bei Frauen bei 4180 und bei Männern bei 9720 Fällen. In der
Gruppe der Frauen macht dies 1,8 % aller Tumorerkrankungen und bei den
Männern sogar 3,7 % aller Tumorerkrankungen aus. Im Jahr 2016 starben
insgesamt 1387 Frauen und 4070 Männer an den Folgen von Tumoren der
Mundhöhle und des Rachens (2).
Da Patienten in der Regel alle sechs Monate einen Zahnarzt aufsuchen, hat
dieser die Möglichkeit, als erster Pathologien im Zahn- Mund- und Kieferbereich
zu erkennen. Viele Erkrankungen in diesem Bereich sind bereits im
Frühstadium röntgenologisch ersichtlich und zeigen bei frühzeitiger Erkennung
eine gute Prognose. Eine korrekte Früherkennung steht dabei in engem
Zusammenhang mit der Kompetenz des Zahnarztes und kann zudem Patienten
vor dem Fortschreiten maligner Erkrankungen bewahren und somit auch
relevante Geldmittel im Gesundheitswesen einsparen.
1.4 Neues radiologisches Curriculum
Um die Kompetenz der Studierenden für die Früherkennung von radiologisch
sichtbaren ZMK-Erkrankungen zu steigern, schien es dringend notwendig, die
Lehre in diesem Bereich zu verbessern. Zusätzliche Personalstunden konnten
dafür nicht veranschlagt werden, da die Kapazitätsverordnung diesbezüglich
keine Erhöhung vorsah. Eine effiziente und zeitgemäße Lösung bietet jedoch
der Einsatz moderner Techniken, welche den Schwerpunkt dieser Arbeit bilden.
Mithilfe dieser technischen Hilfsmittel soll einerseits die Lehre der Radiologie
ausgebaut und verbessert und andererseits der Fachkundeerwerb im
Strahlenschutz effizienter gestaltet und standardisiert werden.
4Die angesichts des geschilderten Verbesserungsbedarfs und der geänderten
Anforderungen der Approbationsordnung in die Wege geleiteten Maßnahmen
zur Verbesserung der Lehre der zahnärztlichen Radiologie sollten im Rahmen
einer Pilotstudie untersucht werden.
Im Wintersemester 2016/17 (WS 16/17) wurde an der Heinrich-Heine-
Universität ein E-Learning-Projekt gestartet, im Rahmen dessen zwei
elektronische Tools entwickelt wurden. Bei dem ersten handelt es sich um einen
radiologischen E-Learning-Atlas, der entwickelt wurde, um den Studierenden
ein Lernmedium für das Selbststudium zur Verfügung zu stellen. Der
radiologische E-Learning-Atlas erhielt den Namen CONRAD nach dem
Entdecker der Röntgenstrahlen Wilhelm Conrad Röntgen. Das zweite
elektronische Tool ist eine elektronische Plattform mit Klausurfragen – in der
Folge als E-Klausurfragen bezeichnet –, die zur Erfolgskontrolle nach Nutzung
des E-Atlas verwendet werden sollte. Die E-Klausurfragen wurden im Laufe
dieser Studie validiert.
Die im Rahmen dieser Studie eingesetzten Tools dienten der geplanten
Weiterentwicklung des elektronischen Radiologie-Sachkundeerwerbs an der
Heinrich-Heine-Universität.
1.4.1 Planung der neuen E-Learning-Tools
In diesem Abschnitt werden die Hintergründe und Überlegungen zu dem Projekt
sowie die Implementierung der im Rahmen des Projekts ausgearbeiteten
technischen Erneuerungen beschrieben. In einem ersten Schritt wurde der
bestehende Lehrplan untersucht. Dazu wurde ein auf den Kriterien von Thomas
et al (3) basierender Katalog von Kriterien ausgearbeitet, die nach den
Projektanforderungen gewählt und dementsprechend angepasst wurden. Die
folgenden Punkte standen bei der Untersuchung im Mittelpunkt:
Problemidentifikation, Evaluation der Bedürfnisse, Ziele, pädagogische
Strategien (Inhalt und Methoden), Implementierung sowie Evaluation und
Feedback. Im Folgenden werden die Kriterien und Untersuchungsergebnisse
zusammenfassend aufgelistet.
5I. Problemidentifikation
• mangelnde Radiologie-Kenntnisse der Zahnmedizinstudierenden
• veraltetes Radiologie-Curriculum
• keine Erhöhung der Personalstunden seitens der Kapazitätsverordnung
• Aktualisierungsbedarf der Radiologie-Sachkunde
II. Evaluation der Bedürfnisse
• Notwendigkeit einer Plattform für Studierende zur systematischen Übung
radiologischer Befunde
• Wunsch nach effizienterer Gestaltung der Radiologie-Sachkunde
III. Ziele
• Effiziente Vermittlung deklarativen und prozeduralen Wissens in der
Zahnärztlichen Radiologie
• Steigerung der intrinsischen Lernmotivation der Studierenden
• Umfassende und wirksame Gestaltung der Lehre der Radiologie
• Langzeitziel: Neugestaltung des Sachkundeerwerbs der zahnärztlichen
Radiologie
IV. Pädagogische Strategien (Inhalt und Methoden)
• Lernmedium für Studierende: E-Learning-Atlas CONRAD mit zoombaren
Röntgenbildern, Annotationen und Informationstexten für das
Selbststudium
• E-Klausuren zur Erfolgskontrolle nach Nutzung des CONRAD-Atlas
• Erarbeitung eines Blended Learning-Konzepts mit Integration der
CONRAD-Plattform in den Präsenzunterricht der zahnmedizinischen
Kurse Auscultando, Practicando I und Practicando II
6• Entwicklung eines elektronischen Sachkundeerwerbs an der Heinrich-
Heine-Universität basierend auf dem vorliegendem E-Learning-Projekt
V. Implementierung
• Pilotphase im Wintersemester 2016/17: Testversion des E-Learning-
Atlas CONRAD
• Erste Testphase im Sommersemester 2017: Vollversion des E-Learning-
Atlas CONRAD
• E-Klausuren zu Beginn und Ende des jeweiligen Semesters
• Langzeitziel: Nutzung der E-Klausuren für die Neustrukturierung der
Radiologie-Sachkunde
VI. Evaluation und Feedback
• Evaluation des Lernerfolgs nach Nutzung des E-Atlas CONRAD über
E-Klausuren
• Einsatz von Fragebögen zur Untersuchung der Eignung des Online-Atlas
sowie zur Ermittlung der Einstellungen der Studierenden hinsichtlich
digitaler Medien
1.4.2. Radiologischer E-Learning-Atlas CONRAD
Das im Rahmen der Verbesserungsphase erweiterte Curriculum sah vor, dass
Studierende zusätzlich zu den Vorlesungen und zum Radiologie-Praktikum
Zugang zum radiologischen Online-Atlas CONRAD bekamen, der ihnen die
Möglichkeit bot, radiologische Befunde zu üben. Ziel war es, den Studierenden
ein didaktisch und fachlich fundiertes Lerntool an die Hand zu geben, mit dem
sie orts- und zeitunabhängig radiologische Inhalte selbständig erlernen und
vertiefen konnten. Zusätzlich geplant war die Integration des E-Learning-Atlas
in die Vorlesung der Kurse Auscultando, Practicando I und Practicando II im
Sinne eines Blended Learning-Konzepts, um den Studierenden die Funktionen
7des Atlas in der Vorlesung zu demonstrieren und vor allem die in den Kursen
besprochenen Pathologien und Differentialdiagnosen systematisch zu lehren.
Zur Überprüfung des mit der CONRAD-Lernplattform anvisierten Lernerfolgs
wurden validierte E-Klausuren ausgearbeitet. Die Leistungen der Studierenden
wurden damit zu Beginn und Ende eines Semesters überprüft. Langfristiges Ziel
war es, die validierten Fragen der E-Klausuren in einer späteren Phase auch in
den Fachkundeerwerb zu integrieren. Insgesamt sollten durch diese
Erneuerungen die Studierenden zukünftig besser auf das Examen und die
zahnärztliche Berufslaufbahn vorbereitet werden. Dies soll eine kompetentere
allgemeinzahnärztliche Behandlung gewährleisten, von der letzten Endes am
meisten der Patient profitiert.
1.5 E-Learning vs. konventionelles Lernen
In diesem Abschnitt wird das Thema E-Learning und seine Eignung kritisch in
Gegenüberstellung zu konventionellem Unterricht besprochen. Die Betonung
von E-Learning basierten Methoden stand in diesem Projekt im Vordergrund,
da, wie bereits oben erwähnt, zusätzlich zu den fehlenden Lehrpersonalstunden
auch der Stundenplan der Zahnmedizinstudierenden keine weiteren
semesterübergreifenden Lehrveranstaltungen zuließ und zusätzliche
Präsenzveranstaltungen den Universitätsalltag der Studierenden noch mehr
belasten würden. Von einem E-Learning-Angebot profitieren zudem auch
diejenigen Studierenden, die nicht direkt am Studienort wohnen.
E-Learning wird als Lernen über elektronische Mittel, wie beispielsweise über
Internet, Intranet oder andere Multimedia-Materialien definiert (4).
Elektronisches Lernen ermöglicht eine bequeme Nutzung von E-Learning-
Inhalten, eine einfache Registrierung für Kurse, erhöhte Flexibilität, reduzierte
Kosten, Möglichkeiten zur einfacheren Aktualisierung des Lernmaterials,
Nachverfolgung der Studierendenaktivitäten, sowie eine einfache Speicherung
der Kursmaterialien (5). E-Learning-Technologien bieten dem Lernenden die
Kontrolle über Inhalte, Lernsequenzen, individuelles Lerntempo, Einteilung der
8Lernzeit und auch über die Wahl des Lernmediums (Art des Endgerätes).
Dadurch kann der Lernende seinen Lernprozess an seinen Wissensstand und
seine persönlichen Ziele anpassen (6).
Als mögliche Nachteile werden in der Literatur technische Schwierigkeiten,
Aufwand bei der Entwicklung des Lehrstoffs, fehlende technische Ressourcen
sowie die Isolation bzw. Frustration der Studierenden genannt (5-9).
Sitzmann et al. (10) fassten in ihrer Metaanalyse 96 E-Learning-Studien
zusammen. Die Kernaussage der Analyse ergab, dass beim Vergleich von
E-Learning basiertem und konventionellem vorlesungsbasierten Unterricht die
Lerneffektivität in der Vermittlung prozeduralen Wissens ähnlich ist. Bei der
Vermittlung deklarativen Wissens zeigte sich jedoch, dass E-Learning um 6 %
effektiver als konventionelle Lernmethoden ist.
Ein optimales E-Learning-Programm vermittelt den Studierenden die
Kursinhalte genau und unmissverständlich. Es ist interaktiv, bietet die
Möglichkeit, sein eigenes Lerntempo zu bestimmen, ist selbstgesteuert und hat
im Gegensatz zum Präsenzunterricht für den Dozenten den Vorteil, den
Unterricht unabhängig von Faktoren wie Ablenkung, Müdigkeit oder Eile
gestalten zu können (11).
Studierende empfinden E-Learning nicht als Ersatz für konventionelles Lernen,
sondern als Ergänzung zu diesem (6). Das Ziel der neuen Radiologie-Plattform
war daher nicht, Lehrveranstaltungen zu ersetzen, sondern das Radiologie-
Curriculum, um ein weiteres Lernangebot zu ergänzen. Anstelle eines
ausschließlich webbasierten Lernkonzepts rückte deshalb bei der Entwicklung
des Projekts das Konzept des Blended Learning in den Mittelpunkt. Blended
Learning verbindet traditionellen lehrergeleiteten Unterricht mit E-Learning-
Technologien. Dabei wird zum Beispiel eine Vorlesungs- oder Vortragsserie
durch onlinebasierte Unterrichtsformen ergänzt. Aus pädagogischer Sicht hat
E-Learning das Potential, das Paradigma des passiven lehrerzentrierten
Lernens in Richtung lernerzentrierten Lernens zu verschieben (12).
91.6 Ziele der Arbeit
Für die vorliegende Arbeit werden vor dem Hintergrund der obigen
Ausführungen folgende Ziele definiert:
1. Gestaltung eines neuen E-Learning-Angebots zur Ergänzung der
konventionellen Lehre ab WS 2016/17 für die Zahnmedizinstudierenden der
HHU (übergeordnetes Ziel)
2. Durchführung einer longitudinalen Studie zur Bewertung der Entwicklung
diagnostischer Skills der Studierenden nach Verwendung des E-Learning-
Angebots im Zeitraum WS 2016/17 und SS 2017 (Primärziel)
3. Erfassung der Zufriedenheit und subjektiven Einschätzung der
radiologischen Skills der Studierenden (Nebenziel)
4. Neustrukturierung und Digitalisierung des Sachkundeerwerbs in der
Zahnärztlichen Radiologie (Langzeitziel)
102 Material und Methoden
Die E-Learning-Plattform CONRAD wurde im WS 2016/17 als Pilotversion für
die Zahnmedizinstudierenden der HHU im siebten, achten und neunten
Semester eingeführt. Im SS 2017, in der ersten Testphase, wurde den
Studierenden die Plattform in der überarbeiteten Version zur Verfügung gestellt.
Zu Beginn und Ende beider Semester wurden die Teilnehmenden mittels
E-Klausuren auf ihr radiologisches Wissen getestet.
2.1 Aufbau der E-Learning-Plattform
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde zu Beginn des Wintersemesters
2016/17 mit dem Aufbau der virtuellen Radiologie-Plattform CONRAD
begonnen. Sie beinhaltete zu Beginn 200 zahnärztliche Röntgenbilder mit
unterschiedlichen rechtfertigenden Indikationen und wird seither kontinuierlich
erweitert. Im März 2021 umfasste der Bestand des Röntgenatlas 522 Bilder.
Jede Aufnahme ist einer Kategorie zugeteilt, welche entweder die
Aufnahmetechnik charakterisiert oder ein übergeordnetes Krankheitsbild
beschreibt (Abb. 1). CONRAD wurde den Zahnmedizinstudierenden der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf aus dem siebten, achten und neunten
Semester zeit- und ortsunabhängig zur Verfügung gestellt.
Abb. 1: Übersicht über die Präparat-Kategorien nach erfolgtem Einloggen
112.1.1 Framework der CONRAD-Plattform
Als Framework für die CONRAD-Plattform wurde das kommerzielle Smart
Zoom® (SmartInMedia Gmbh & Co. KG, Köln, Deutschland) verwendet. Dieses
bietet die Möglichkeit, Bilder pyramidenartig in einzelne Pixel (Tiles) zu zerlegen
und gewährleistet somit stufenloses Zoomen. Weiterhin bietet die Plattform
verschiedene didaktische Tools. Dozierende können Annotationen und
Informationstexte für Präparate erfassen. Die Studierenden können
selbstständig Annotationen hinterlegen, Fragen an Dozierende stellen oder
sogar ein eigenes Notizbuch anlegen. Die Plattform enthält auch einen
Quizmodus, mithilfe dessen die Studierenden ihr Wissen testen können.
2.1.2 Annotationen
Die Röntgenaufnahmen wurden vom Lehrpersonal des Universitätsklinikums
Düsseldorf und von der Verfasserin dieser Doktorarbeit mit Annotationspins
versehen, welche z.B. anatomische Strukturen oder pathologische Befunde
markieren und über welche per Mausklick weitere Informationen zur markierten
Struktur abgerufen werden können. Weiterhin können auch polygonförmige
Annotationen hinterlegt werden. Diese werden für Strukturen wie die
Kieferhöhle oder die Orbita genutzt, um die Extension zu verdeutlichen und den
Verlauf bestimmter Strukturen hervorzuheben (Abb. 2). Per Mausklick auf den
Information-Button kann darüber hinaus eine Zusammenfassung mit den
wichtigsten Informationen zum Krankheitsbild geöffnet werden (Abb. 3). Auf
diese Weise können Studierende ihr Wissen über die abgebildete Pathologie
oder anatomische Struktur erweitern.
2.1.3 Interaktive Features der Plattform
Die Studierenden können auf der CONRAD-Plattform Fragen an das
Lehrpersonal richten. Die Dozierenden beantworten diese Fragen im
Administrationsbereich der Plattform. Die erfolgte Beantwortung wird allen
Nutzern durch ein grünes Fragezeichen anonymisiert angezeigt (Abb. 2).
12Unbeantwortete Fragen können nur von Administratoren und Dozierenden
eingesehen werden.
Die Bilder und Informationstexte können von den Studierenden mit einem bis
fünf Sternen bewertet werden. Damit haben sie die Möglichkeit zu beurteilen,
wie hoch der Nutzen für den individuellen Lernprozess war.
Im Quizmodus zeigt die Plattform den Studierenden ein Röntgenbild und dazu
fünf Single Choice-Antwortmöglichkeiten an, aus denen die richtige Antwort
gewählt werden muss (Abb. 4). Auf diese Weise können Studierende ihr Wissen
selbstständig testen. Des Weiteren verfügen die Nutzer über ein Notizbuch, in
dem sie eigene Anmerkungen notieren können.
Abb. 2: Beispiel einer Röntgenaufnahme im E-Atlas
Per Mausklick auf einen roten Pin oder eine gelb markierte Fläche wird die jeweilige
Annotation geöffnet. Grün erscheinende Fragezeichen im Bild kennzeichnen vom
Lehrpersonal beantwortete Fragen der Nutzer.
13Abb. 3: Zusammenfassung eines Themas im E-Atlas
Durch Mausklick auf „Information“ eröffnet sich den Nutzern eine Zusammenfassung
relevanter Themen des jeweiligen Bildes.
Abb. 4: Quiz-Funktion des E-Atlas
Im Quizmodus können Studierende ihr Wissen testen.
2.1.4 Ergänzende Histopathologien
Seit dem Sommersemester 2017 stehen den Nutzern zu einigen Erkrankungen
auch histopathologische Präparate mit virtuellem Mikroskop zur Verfügung
(Abb. 5), um Verständnis dafür zu entwickeln, warum sich verschiedene
14Pathologien in Röntgenbildern in einer bestimmten, charakteristischen Art
darstellen. Durch diese Art des interdisziplinären Lernens soll das Verstehen
des jeweiligen Erkrankungsbildes geschärft werden. Die histopathologischen
Präparate wurden durch Kooperationspartner an der Universität Göttingen und
der Universität Bonn bereitgestellt, welche in ihrem Unterricht dasselbe
Framework nutzen. Seit dem Wintersemester 2018/19 können die Präparate
des Kurses „Pathologie für Zahnmediziner“ auch an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf eingesehen werden.
Abb. 5: Histopathologische Präparate im E-Atlas
Auf der CONRAD-Plattform stehen seit dem Sommersemester 2017 für Studierende auch
histopathologische Präparate zur Verfügung.
2.2 Leistungsüberprüfung über ILIAS-E-Klausuren
Die im Laufe des Semesters erfolgte Kompetenzentwicklung wurde über
E-Klausuren auf der Open Source E-Learning-Plattform ILIAS (ILIAS =
Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System) ermittelt. Die
Klausuren fanden im Wintersemester 2016/17 und Sommersemester 2017
statt. Die im Wintersemester 2016/17 abgehaltenen Klausuren waren Teil der
Pilotphase und dienten zur Validierung der E-Klausurfragen für die
anschließende Testphase im Sommersemester 2017.
15Die Schwierigkeitsniveaus der Klausuren und Frageninhalte wurden an das
jeweilige Semester angepasst.
Nach der Teilnahme an der Eingangsklausur im Wintersemester 2016/17 hatten
die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Plattform zu Lernzwecken zu nutzen.
2.2.1 Itemanalyse der E-Klausurfragen
Alle E-Klausurfragen wurden über eine Itemanalyse validiert, im Rahmen derer
Trennschärfe und Item-Schwierigkeit bestimmt wurden. Ab dem
Sommersemester 2017 wurden ausgehend von den in den vorangegangenen
Klausuren ermittelten Item-Schwierigkeiten und Trennschärfen neue Klausuren
erstellt. Ab der ersten Testphase waren nur noch Klausurfragen inkludiert, die
eine Trennschärfe von ≥ 0,25 aufwiesen. Um den Schwierigkeitsgrad der
Klausuren zu standardisieren, wurden die Klausurfragen verschiedener Item-
Schwierigkeiten nach dem Schema aus Tabelle 1 für die E-Klausuren
zusammengestellt.
Item-Schwierigkeiten Anteil der gesamten Fragen (%)
0,85 - 1 15
0,65 - 0,849 49
0,45 - 0,649 25
0,25 - 0,449 10
0 - 0,249 1
Tabelle 1: Verteilung der verschiedenen Item-Schwierigkeiten in den E-Klausuren
162.2.2 Fragetypen
Die E-Klausuren beinhalteten folgende Fragetypen: Single Choice, Multiple
Choice, Zuordnungsfragen (Abb. 6), Hotspot/Imagemap (Abb. 7),
Lückentextfragen, Fehler/Wort markieren und Begriffe benennen.
Abb. 6: ILIAS-Zuordnungsfrage
Studierende müssen Zähne im Röntgenbild korrekt zuordnen.
Abb. 7: Hotspot/Imagemap-Frage in ILIAS
Die richtige Struktur (hier Nasion) im Bild muss angeklickt
werden. Die Punktezahl ist von der Treffsicherheit abhängig.
172.3 Durchführung der E-Klausuren
An den E-Klausuren nahmen Zahnmedizinstudierende aus dem siebten, achten
und neunten Semester der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf teil. Die
Durchführung der E-Klausuren erfolgte im Zentrum für Informations- und
Medientechnologie (ZIM) der Universität. Die Teilnehmenden konnten den
Prüfungscomputer nur im sogenannten Kioskmodus verwenden, in dem der
Internetzugang blockiert und die Informationssuche im Internet somit nicht
möglich war. Um Täuschungsversuche zu verhindern, wurde die
Fragenreihenfolge pro Teilnehmer randomisiert. Die Bearbeitungszeit der
Klausuren war auf 60 Minuten begrenzt. Innerhalb dieser Zeit konnten die
Klausurfragen bei Bedarf zurückgestellt und die Antworten abgeändert werden.
Nach Ablauf der 60-minütigen Bearbeitungszeit war eine Modifikation der
Antworten nicht mehr möglich.
Die Probanden mussten ihre persönlichen Gegenstände an einem gesonderten
Ort im Prüfungsraum ablegen, um so die Verwendung von Hilfsmitteln
auszuschließen. Nur der Studierenden- bzw. Personalausweis durfte während
der Klausur auf dem Tisch liegen. Alle Probanden mussten sich zu Beginn der
Klausur mit ihrer persönlichen ILIAS-Kennung einloggen. Dabei erschien der
Name des Teilnehmers auf dem Bildschirm und die Aufsichtspersonen konnten
während der Klausur die Identität der Klausurteilnehmenden überprüfen.
2.3.1 Eingangsklausur im Wintersemester 2016/17
Im Rahmen der Eingangsklausur des Wintersemesters 2016/17 waren pro
Klausur 60 Minuten veranschlagt. Die Anzahl der Klausurfragen war auf die
jeweiligen Semester folgendermaßen verteilt:
• Auscultando: 55 Fragen
• Practicando I: 41 Fragen
• Practicando II: 37 Fragen
18Für jede Klausurfrage war in der ILIAS-Klausurinstanz eine geschätzte
Bearbeitungszeit eingespeichert. Die Zusammenstellung der Fragen erfolgte
so, dass sich pro Klausur insgesamt eine Bearbeitungszeit von 60 Minuten
ergab. Aus diesem Grund kam es zu einer unterschiedlichen Anzahl an Fragen
pro Kurs.
2.3.2 Abschlussklausur im Wintersemester 2016/17
Auch für die Abschlussklausur des Wintersemesters 2016/17 wurden 60
Minuten für die Bearbeitung der Fragen veranschlagt. Da die Studierenden in
der Eingangsklausur jedoch weniger als die geschätzte Bearbeitungszeit zur
Beantwortung der Fragen benötigt hatten, wurde die Anzahl der Fragen erhöht.
Gleichzeitig wurden aus diesem Grund auch die Bearbeitungszeiten pro Frage
modifiziert. Dabei verteilten sich die Klausurfragen in den jeweiligen
Probandengruppen folgendermaßen:
• Auscultando: 61 Fragen
• Practicando I: 64 Fragen
• Practicando II: 64 Fragen
Die Abschussklausur enthielt sowohl Fragen, die sich bei der Eingangsklausur
durch eine ausreichende Trennschärfe (≥ 0,25) ausgezeichnet hatten, als auch
neue Fragen, die noch validiert werden mussten. Fragen, die bei der
Eingangsklausur eine niedrigere Trennschärfe aufwiesen, wurden aus dem
Fragenpool entfernt oder modifiziert.
2.3.3 Eingangsklausur im Sommersemester 2017
Die Dauer der Eingangsklausuren im Sommersemester 2017 war auf jeweils 60
Minuten festgelegt. Die Fragenanzahl für dieses Semester wurde herabgesetzt,
um den Studierenden genügend Zeit zur Beantwortung der Klausurfragen zu
geben und Antworten, die aufgrund von Zeitnot nach dem Zufallsprinzip gewählt
wurden, zu verhindern. Die Anzahl der Klausurfragen der einzelnen
Probandengruppen verteilte sich wie folgt:
19• Auscultando: 35 Fragen
• Practicando I: 35 Fragen
• Practicando II: 35 Fragen
Für die erste Testphase erwies sich diese Fragenanzahl als optimal. Die
Studierenden hatten genügend Zeit, alle Fragen zu beantworten, ohne
stressbedingte Flüchtigkeitsfehler zu machen oder Antworten nach dem
Zufallsprinzip zu wählen.
2.3.4 Abschlussklausur im Sommersemester 2017
Die Abschlussklausur im Sommersemester 2017 dauerte gleich wie die
Eingangsklausur 60 Minuten und enthielt die gleiche Anzahl an Fragen wie
diese.
2.4 Fragebögen
Zu Beginn des Wintersemesters 2016/17 füllten die Teilnehmenden an der
Studie zwei Fragebögen in Papierform aus: einen zur Teilnahme an den bereits
absolvierten Kursen (Anhang 1), um den Probanden sicher in das korrekte
Semester einordnen zu können. In einem weiteren Fragebogen mussten sie
Fragen zu ihrer Einstellung digitalen Medien gegenüber ausfüllen (Anhang 3).
Am Ende des Wintersemesters 2016/17 hatten die Studierenden drei
Fragebögen auszufüllen. Neben den beiden vorher genannten Fragebögen
mussten sie in einem dritten Fragebogen den Online-Atlas CONRAD evaluieren
(Anhang 2).
Zu Beginn und Ende des Sommersemesters 2017 wurden anstelle von
Fragebögen in Papierform elektronische Umfragen auf der ILIAS-Plattform
durchgeführt, in denen ebenfalls die bis dahin absolvierten Kurse, die
Einstellung zu digitalen Medien und die Zufriedenheit mit dem Online-Atlas
evaluiert wurden. Die Fragen wurden unverändert aus dem Wintersemester
2016/17 übernommen.
20Die Fragebögen bzw. elektronischen Umfragen wurden unmittelbar nach den
E-Klausuren von den Studierenden bearbeitet. Dabei gab es keine zeitlichen
Begrenzungen. Die Fragen bestanden aus einer Kombination negativer und
positiver Fragestellungen. Folgende Antwortalternativen waren möglich: „Ich
stimme voll und ganz zu“, „Ich stimme eher zu“, „Ich stimme nicht zu“, „Ich
stimme eher nicht zu“, „Ich stimme gar nicht zu“ oder „keine Angabe“.
Da die Umfragen der Pilotphase in Papierform durchgeführt wurden, mussten
sie im Anschluss in einer elektronischen Datei eingetragen werden. Die
verschiedenen Antwortaussagen („Ich stimme voll und ganz zu“ usw.) mussten
in Scores umgewandelt werden, um die Ergebnisse danach in Microsoft Excel
(Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA) weiter bearbeiten zu
können. Dieser Schritt entfiel ab dem Sommersemester 2017, da die Umfragen
in der ersten Testphase bereits ausschließlich elektronisch durchgeführt
worden waren.
2.5 Teilnehmende der Studie
Probanden dieser Studie waren Zahnmedizinstudierende, die zum Zeitpunkt
der Untersuchung die Kurse Auscultando, Practicando I oder Practicando II
belegten. In Regelstudienzeit wird der Kurs Auscultando für das siebte
Semester, Practicando I für das achte Semester und Practicando II für das
neunte Semester angeboten. In der Pilotphase im Wintersemester 2016/17 war
die Teilnahme an der E-Klausur nicht verpflichtend. Allerdings wurde die
Teilnahme als Übung empfohlen, denn im Sommersemester 2017 war die
E-Klausur als Teil der Kursordnung für die Studierenden verpflichtend.
Im Kurs Auscultando war lediglich die Teilnahme an der Eingangs- und
Abschlussklausur obligatorisch. Diese waren jedoch nicht bestehenspflichtig.
In den Kursen Practicando I und II war die Teilnahme an der Eingangs- und
Abschlussklausur obligatorisch. Dabei war allerdings nur die Abschlussklausur
bestehenspflichtig. Wenn die Teilnehmenden aber in der Eingangsklausur die
60 %-Grenze an richtigen Antworten erreichten, bekamen sie einen Bonus von
215 % auf die Abschlussklausur gutgeschrieben. In der Abschlussklausur war das
Erreichen der Bestehensgrenze von 60 % (bzw. 55 % bei erfolgreicher
Eingangsklausur) unter anderem Bedingung für die erfolgreiche Absolvierung
des Kurses.
Zur Auswertung der E-Klausur-Ergebnisse für Studienzwecke bedurfte es der
schriftlichen Einwilligung der Studierenden. Diese Einwilligung wurde von allen
Probanden erteilt. Sowohl in der freiwilligen Pilotphase als auch in der ersten
Testphase konnten alle Studienteilnehmenden bei der Auswertung
berücksichtigt werden.
2.5.1 Teilnehmende im Wintersemester 2016/17
An der Eingangsklausur des Wintersemesters 2016/17 nahmen insgesamt
64 Probanden teil. In den einzelnen Semesterkursen ergab sich die folgende
Geschlechterverteilung:
• Auscultando: 28 Teilnehmende (19 weiblich, 9 männlich)
• Practicando I: 9 Teilnehmende (4 weiblich, 5 männlich)
• Practicando II: 27 Teilnehmende (22 weiblich, 5 männlich)
Die Zahl der Teilnehmenden an der Abschlussklausur im Wintersemester
2016/17 betrug insgesamt 73. In den einzelnen Semestern ergab sich die
folgende Geschlechterverteilung:
• Auscultando: 26 Teilnehmende (16 weiblich, 10 männlich)
• Practicando I: 15 Teilnehmende (8 weiblich, 7 männlich)
• Practicando II: 32 Teilnehmende (28 weiblich, 4 männlich)
2.5.2 Teilnehmende im Sommersemester 2017
An der Eingangsklausur im Sommersemester 2017 nahmen insgesamt 62
Studierende teil. Dabei ergab sich in den einzelnen Semestern die folgende
Geschlechterverteilung:
22• Auscultando: 17 Teilnehmende (14 weiblich, 3 männlich)
• Practicando I: 31 Teilnehmende (20 weiblich, 11 männlich)
• Practicando II: 14 Teilnehmende (8 weiblich, 6 männlich)
Die Gruppe der Teilnehmenden an der Abschlussklausur im
Sommersemester 2017 umfasste insgesamt 63 Personen. In den einzelnen
Semestern ergab sich die folgende Geschlechterverteilung:
• Auscultando: 17 Teilnehmende (14 weiblich, 3 männlich)
• Practicando I: 31 Teilnehmende (21 weiblich, 10 männlich)
• Practicando II: 15 Teilnehmende (8 weiblich, 7 männlich)
2.6 Studienaufbau
Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine prospektive longitudinale
Kohortenstudie. Abbildung 8 zeigt den zeitlichen Ablauf dieses Projektes. Die
medizinische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf erteilte am
18.08.2016 das Ethikvotum (Aktenzeichen 5596). Die Lernplattform wurde den
Studierenden nach der Eingangsklausur im Wintersemester 2016/17 kostenlos,
zeit- und ortsunabhängig zur Verfügung gestellt (siehe Abb. 8, Zeitpunkt T1).
Zugang zum E-Atlas und zur ILIAS-Plattform erhielten ausschließlich
Studierende der Heinrich-Heine-Universität, da die Inhalte des Röntgenatlas auf
der SmartZoom®-Plattform nur nach Registrierung mit einer
@uni-duesseldorf.de oder @med.uni-duesseldorf.de-Adresse angezeigt
werden konnten. Die Nutzungsaktivität der Studierenden wurde mit Google
Analytics (Google LLC, Mountain View, Kalifornien, USA) auf der Plattform
aufgezeichnet (Abb. 9) und konnte im Administratorenbereich des Online-Atlas
abgerufen werden. Die Nutzungsaktivität wurde als maximale Anzahl an Klicks
pro Tag, wie in Abbildung 9 veranschaulicht, verzeichnet.
23Abb. 8: Zeitlicher Ablauf der Studie
Abb. 9: Aufzeichnung der täglichen Klicks auf der E-Plattform
Beispiel für die Aufzeichnung der Klicks durch Google Analytics im
Administratorenbereich des Online-Atlas CONRAD
242.7 Statistik
Alle benutzten Klausurfragen wurden über eine Itemanalyse validiert, indem ihre
Trennschärfe und Item-Schwierigkeit bestimmt wurde. Für die
Gesamtklausuren wurden Reliabilitäten bestimmt, um die Verlässlichkeit der
Klausuren für die Wissensüberprüfung zu messen.
Für die statistische Auswertung wurden die Open Source-Software R (13) und
das Psych-Paket (14) herangezogen.
Falls eine Normalverteilung der Daten vorlag, wurden die Eingangs- und
Abschlussklausuren mittels paired t-Test verglichen. Anderenfalls wurde der
Wilcoxon signed-rank test verwendet mit Signifikanzniveau α = 0,05.
Für die Itemanalyse der einzelnen Klausurfragen wurden die Trennschärfen und
Item-Schwierigkeiten mithilfe des Psych-Pakets (14) mit dem einseitigen t-Test
berechnet.
253 Ergebnisse
Wie in Kapitel 2 Material und Methoden dargestellt, wurden im Rahmen dieser
Dissertation der Lernerfolg und das Lernverhalten der Studierenden im WS
2016/17 (Pilotversion) und im SS 2017 (erste Testversion) vor und nach
Nutzung der CONRAD-Plattform evaluiert.
Bei der Ergebnisauswertung standen die Lernerfolge bei den E-Klausuren,
Nutzungsstatistiken der Plattform, Probandenzahlen sowie die Ergebnisse der
Fragebögen im Mittelpunkt der Untersuchung. Die folgenden Unterkapitel
stellen eine detaillierte Übersicht der Ergebnisse in den einzelnen
Untersuchungsbereichen dar.
3.1 Ergebnisse der E-Klausuren
Die Auswertung der E-Klausuren hatte zum Ziel, den Lernerfolg nach Nutzung
des hier untersuchten Lernmediums zu analysieren. Um die Zuverlässigkeit der
in dieser Studie gestellten E-Klausuren für die Messung des Lernerfolgs zu
verifizieren, wurde die Reliabilität zur genaueren Beschreibung der Ergebnisse
der E-Klausuren ermittelt.
Zur Überprüfung der Eignung der genutzten E-Klausurfragen wurde eine
Itemanalyse durchgeführt. Dabei wurden sowohl die Trennschärfe als auch die
Item-Schwierigkeit jedes einzelnen Items geprüft.
Hinsichtlich dieser Merkmale stellt Unterkapitel 3.1.1 die Ergebnisse des
Wintersemesters 2016/17 und Kapitel 3.1.2 die des Sommersemesters 2017
vor.
263.1.1 Ergebnisse Wintersemester 2016/17
Lernerfolg bei den E-Klausuren
In der Abschlussklausur des Wintersemesters 2016/17 schnitten die
Studierenden besser ab als in der Eingangsklausur. Trotz des besseren
Lernerfolgs waren diese Unterschiede nicht signifikant (paired t-Test, p ≥ 0,05)
(Abb 10).
Abb. 10: Darstellung der Ergebnisse im WS 2016/17 mittels Boxplots
Ergebnisse der E-Klausuren in der Pilotphase im Wintersemester 2016/17. Die
Unterschiede in den Eingangs- und Abschlussklausuren waren in allen Semestern nicht
signifikant (p ≥ 0,05).
Reliabilitäten
Die Reliabilitäten der Klausuren aller drei Semestern verbesserten sich von der
Eingangs- zur Abschlussklausur (Abb. 11, 12 und 13).
277. Semester WS 16/17
0,85
0,8
0,8
0,75
Reliabilität
0,7
0,65
0,6
0,6
0,55
0,5
Eingangsklausur Abschlussklausur
Abb. 11: Darstellung der Reliabilitäten im 7. Semester im WS 2016/17
Im Wintersemester 2016/17 verbesserten sich die Reliabilitäten der Eingangs- und
Abschlussklausuren im 7. Semester von 0,6 auf 0,8.
8. Semester WS 16/17
0,9
1
0,5
0
Reliabilität
-0,5
-1
-1
-1,5
Eingangsklausur Abschlussklausur
Abb. 12: Darstellung der Reliabilitäten im 8. Semester im WS 2016/17
Im Wintersemester 2016/17 verbesserten sich die Reliabilitäten der Eingangs- und
Abschlussklausuren im 8. Semester von -1 auf 0,9.
289. Semester WS 16/ 17
0,95
0,9
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,6
0,55
0,5
Eingangsklausur Abschlussklausur
Abb. 13: Darstellung der Reliabilitäten im 9. Semester im WS 2016/17
Im Wintersemester 2016/17 verbesserten sich die Reliabilitäten der Eingangs- und
Abschlussklausuren im 9. Semester von 0,6 auf 0,9.
Item-Schwierigkeiten
Die Item-Schwierigkeiten (MW±STD) veränderten sich, wie auch erwartet, bei
den Eingangs- und Abschlussklausuren nur wenig oder gar nicht. Tabelle 2
zeigt die Veränderung dieser Werte.
Eingangsklausur Abschlussklausur
WS 16/17 Item-Schwierigkeiten Item-Schwierigkeiten
7. Semester 0,6 ± 0,2 0,7 ± 0,2
8. Semester 0,5 ± 0,3 0,6 ± 0,2
9. Semester 0,6 ± 0,2 0,6 ± 0,2
Tabelle 2: Überblick über die Item-Schwierigkeiten (MW ± STD) im WS 2016/17
29Sie können auch lesen