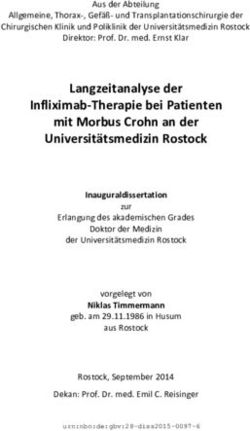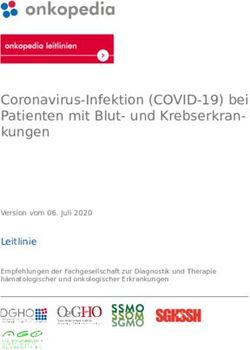Versorgung, Forschung und Lehre 2009 2013 - Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Marburg - UKGM
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Universitätsklinik
für Psychiatrie
und Psychotherapie
Marburg
Versorgung,
Forschung und Lehre
2009 - 2013Redaktion: Ina Kluge, Stephanie Mehl, Tilo Kircher Gestaltung: Annette Tittmar Alle Rechte vorbehalten Universitätsklinikum der Philipps-Universität Marburg Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Rudolf-Bultmann-Straße 8 35039 Marburg Tel.: 06421/58-65200, Fax: 06421/58-65197 Email: psychiat@med.uni-marburg.de www.uk-gm.de\psychiatrie
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Marburg Versorgung, Forschung und Lehre 2009 – 2013
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Klinische Versorgung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1 Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Stationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.1 Schwerpunktstation Affektive Störungen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.2 Schwerpunktstation Angst- & Zwangserkrankungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.3 Schwerpunktstation Psychosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.4 Schwerpunktstation Alterspsychiatrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.5 Schwerpunktstation Abhängigkeitserkrankungen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.6 Schwerpunktstation Akutstation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3 Ambulanzen und Konsiliardienst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4 Klinische Abteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4.1 Abteilung für Elektrokonvulsionstherapie (EKT).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4.2 Elektrophysiologie und Schlafphysiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4.3 Abteilung für klinische Neuropsychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.5 Pflegedienst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.6 Fachweiterbildung „Psychiatrische Pflege“ in Marburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.7 Sozialdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.8 Ergotherapie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.9 Physio- und Bewegungstherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.10 Klinikseelsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.11 Marburger Bündnis gegen Depression e.V. und ExIn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.12 Angehörigengruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.13 Versorgungsstruktur Landkreis Marburg-Biedenkopf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2. Versorgungsstatistik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3. Qualitätsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.1 Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2 Drittmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.3 Übersicht Impactfaktoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.4 Arbeitsgruppen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.4.1 Systemneurowissenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.4.2 Kognitive Neuropsychiatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.4.3 Imaging in Psychiatry.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.4.4 Multimodale Bildgebung in den Kognitiven Neurowissenschaften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.4.5 Neurobiologie und Genetik des Verhaltens.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.4.6 Soziale Neurowissenschaften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.4.7 Funktionale Psychopathologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.4.8 Core-Unit Brainimaging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.4.9 Core-Unit Neurobiologisches Labor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.4.10 DFG FOR 2107: Neurobiologie affektiver Störungen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.5 Publikationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5. Lehre, Fort- und Weiterbildung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.1 Lehre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.2 Weiterbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.3 Weiterbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.4 Institut für Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin (IVV).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.5 Fortbildung; Symposien und Workshops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Psychiatrisch-Psychotherapeutisches Kolloquium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.6 Promotionen und Habilitationen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.6.1 Promotionen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.6.2 Habilitationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.7 Berufungen, Herausgeberschaften, Preise, Stipendien, Ernennungen,
Funktionen, Mitgliedschaften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.8 Wissenschaftliche Mitarbeiter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6. Pinnwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3Klinische Versorgung
Vorwort
Der Ihnen vorliegende Bericht fasst wesentliche In der Lehre wurde für Medizinstudenten ein
Aktivitäten an der Universitätsklinik für Psychiat- zweiwöchiges Blockpraktikum auf den Stationen
rie und Psychotherapie Marburg in den Bereichen neu eingeführt, im Rahmen dessen sie Diagnos-
Krankenversorgung, Forschung und Lehre/Aus- tik und Behandlung in der Psychiatrie praktisch
bildung der Jahre 2009-2013 zusammen. Durch erlernen. Im ebenfalls neu strukturierten Untersu-
die störungsorientierte Schwerpunktbildung der chungskurs werden praxisorientierte Fähigkeiten
Stationen, die Neubesetzung von vier Professu- in Interview- und Anamnesetechnik erlernt und
ren und die Umstrukturierung der studentischen geübt. Im Jahr 2014 wird ein neuer Masterstu-
Lehre wie auch der Facharztausbildung gab es diengang Neurowissenschaften eingeführt, an
viele neue Entwicklungen, die jetzt einen zusam- dessen Planung die Klinik wesentlichen Anteil
menfassenden Rückblick lohnend machen. hat. Durch die strukturierte Facharztausbildung,
die Eröffnung der Fachkrankenpflegeschule für
In der stationären Patientenversorgung wurde
Psychiatrie sowie die regelmäßigen Workshops
durch die Einrichtung von Schwerpunktstatio-
und Fortbildungsveranstaltungen werden Mitar-
nen ein Fokus auf die störungsspezifische Psy-
beiter und externe Interessierte über die neues-
chotherapie gelegt. Das Konzept richtet sich
ten Entwicklungen in Klinik und Forschung infor-
nach einem störungsorientieren Diagnose- und
miert und weitergebildet.
Behandlungsangebot. Die sechs Stationen sind
jeweils spezialisiert auf bestimmte Erkrankungs- Im Jahr 2013 wurden erste Sanierungsarbeiten
gruppen, nämlich Psychosen, Depression, Angst- am Hauptgebäude der Klinik abgeschlossen, so
und Zwang, Alkohol-/Medikamentenabhängig- dass jetzt vier der sechs Stationen über einen neu
keit, Alterspsychiatrie und Krisenintervention. So renovierten, zeitgemäßen Unterbringungsstan-
werden Patienten aus dem gesamten Spektrum dard mit Nasszellen verfügen.
psychischer Erkrankungen bzw. Syndrome von
speziell geschulten therapeutischen Teams, die
besondere Kompetenzen und Erfahrungen in der Prof. Dr. med. T. Kircher
Therapie des jeweiligen Krankheitsbildes aufwei- Direktor der Klinik für Psychiatrie und
sen, behandelt. Auf jeder Station wird ein stö- Psychotherapie
rungsspezifisches Psychotherapiekonzept für die Universitätsklinik Marburg
jeweiligen Patienten angeboten. Die sehr gute
Patientenversorgung durch die Mitarbeiter zeigt
sich in Spitzenplätzen der Klinik im Ranking der
Zeitschrift „Focus“ für die Diagnosen Depression,
Angst und Zwang.
In der Forschung wurde die Vernetzung mit wis-
senschaftlichen Kooperationspartnern in Mar-
burg, national und international vorangetrieben.
Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie be-
legt den 2. Platz im Publikationsranking (Impact-
faktoren) des Fachbereiches Medizin Marburg.
Die Einwerbung eines 3-Tesla MRT-Kernspinto-
mographen, der Aufbau von MRT Strukturen und
Kompetenzen durch erfahrene wissenschaftliche
Mitarbeiter und die Förderung durch den Fachbe-
reich Medizin war die Grundlage dieses Erfolges.
Eine Reihe von großen Verbundforschungspro-
jekten (DFG, BMBF, LOEWE) konnte eingeworben
werden, insbesondere wurde die DFG Forscher-
gruppe 2107 „Neurobiology of Affective Disor-
ders“ im Jahr 2013 positiv begutachtet.
51 6
Klinische Versorgung
1. Klinische Versorgung
1.1 Einleitung
Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie ist Intensivstation: Krisenintervention, Kognitive Ver-
mit den anderen Universitätskliniken Marburg ein haltenstherapie (KVT)
Zentrum der Maximalversorgung. Das Behand-
lungskonzept ist mehrdimensional und umfasst Das komplexe diagnostische und therapeutische
störungsspezifische Psychotherapie, biologische Programm wird von Behandlerteams durchge-
Therapieverfahren, insbesondere Pharmakothe- führt, die verschiedene Berufsgruppen umfassen.
rapie und Soziotherapie. Die Angehörigen der So arbeiten Ärzte, Psychologen, Pflegepersonal,
Patienten werden wenn möglich in die Diagnos- Sozialarbeiter, Ergo-, Physio- und weitere The-
tik und Therapie miteinbezogen. rapeuten eng zusammen, damit alle therapeu-
tischen Notwendigkeiten abgedeckt und ge-
Das Konzept richtet sich nach einem störungsori- währleistet sind. Regelmäßige Einzelgespräche
entieren Diagnose- und Behandlungsangebot. werden von verschiedenen Gruppentherapiepro-
Die sechs Stationen sind jeweils spezialisiert auf grammen wie z. B. für Psychosen, Abstinenzmo-
bestimmte Erkrankungsgruppen. So wird das tivation, Angst- und Zwangsstörungen, Depres-
weite Spektrum psychischer Erkrankungen bzw. sion, Entspannungstraining, Schlafstörungen,
Syndrome von speziell geschulten therapeuti- Genusstraining und andere mehr ergänzt. Rund
schen Teams, die besondere Kompetenzen und ein Drittel der Patienten werden überregional zu-
Erfahrungen in der Therapie des jeweiligen Krank- gewiesen, insbesondere für Angst- und Zwangs-
heitsbildes aufweisen, diagnostiziert und behan- störungen, Psychosen und Depression. Die ärztli-
delt. Auf jeder Station wird ein störungsspezifi- che und psychologische Behandlung wird in der
sches Psychotherapiekonzept für die jeweiligen Klinik durch weitere Therapien wie Ergo-, Physio-,
Patienten angeboten. Auf allen Stationen wird Balneo- und Tanzterapie, Eutonie, Sport, Angehö-
Psychoedukation durchgeführt, das heißt die Pa- rigengruppen und Kognitives Training ergänzt.
tienten werden umfassend über ihre Erkrankung
informiert. Das tagesklinische Konzept beruht auf direkter
Behandlungskontinuität der stationären Versor-
Folgende spezialisierte Stationen sind an der Kli- gung. So werden Patienten, die stationär behan-
nik eingerichtet: delt wurden, auf der gleichen Station und von
den gleichen Therapeuten tagesklinisch weiter-
Station Depression: Cognitive Analsis System of behandelt.
Psychotherapy (CBASP), Interpersonelle Therapie
(IPT), Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) Die Klinik verfügt über komplementäre ambulan-
te Behandlungsangebote, darunter Spezialsprech-
Station Angst- und Zwangsstörungen: Kognitive stunden, eine Sprechstunde für Studierende in
Verhaltenstherapie (KVT), Schwerpunkt Expositi- der großen Hauptmensa mit niederschwelligem
onsbehandlung Zugang und ein ambulantes Richtlinen-Psycho-
therapieangebot über das “Institut für Verhal-
Station Psychosen (Schizophrenie, Bipolare Stö- tenstherapie und Verhaltensmedizin”. Über einen
rung): Kognitive Verhaltenstherapie bei Positiv- ärztlichen Konsildienst versorgt die Klinik statio-
symptomatik (CBT-P), Spezialangebot Emotions- näre Patienten in den somatischen Universitäts-
orientierte kognitive Verhaltenstherapie (CBT-E) kliniken.
und Metakognitives Training (MKT)
Station Alterspsychiatrie, Kognitive Störungen:
Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)
Station Qualifizierte Entgiftung: Motivierende Ge-
sprächsführung (nach Millner und Rollnik)
71
Struktur der Klinik
Station Station
(20 Betten) (22 Betten)
Depression Alter, Kognitive Störungen
Station
Station (14 Betten)
(20 Betten)
Qualifizierte Entgiftung
Angst- und Zwangsstörungen
Alkohol, Medikamente
Station Station
(20 Betten) (14 Betten)
Schizophrenie Intensivstation
Poliklinik, PIA, Sprechstunde für
Studierende, Psychotherapie IVV, Tagesklinik
Konsildienst
Die Klinik arbeitet eng mit gemeindenahen Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie stellt
Versorgungsangeboten zusammen, wodurch – somit ein Modell für die spezialisierte wie auch
wenn notwendig – Rehabilitationsmaßnahmen, gemeindenahe Versorgung dar, die ambulante,
Wohnungsfindung oder andere ambulante Wei- teilstationäre, stationäre sowie die Mitbehand-
terbehandlungsmaßnahmen rasch eingeleitet lung somatisch erkrankter Patienten gewährleis-
und umgesetzt werden können. Neben der ge- tet.
meindenahen Versorgung von Menschen mit
psychischen Erkrankungen aus Marburg und Um-
gebung (ca. 70% der Aufnahmen) behandelt die
Klinik auch überregional Patienten, die aus dem
gesamten Bundesgebiet zugewiesen werden (ca.
30% der Aufnahmen).
Durch die interdisziplinäre Kooperation mit den
anderen Fachgebieten der Universitätsmedizin
in Marburg wird eine umfassende psychiatrische
und somatische Behandlung gewährleistet.
8Klinische Versorgung
1.2 Stationen Trennung, Beendigung des Arbeitslebens, kon-
1.2.1 Schwerpunktstation flikthafte Beziehungen, und nur durch Verstehen
und Bearbeiten dieses Kontextes zu behandeln
Depression
ist. Die IPT wird bei den Patienten angewendet,
bei denen wir die Ursachen der Depression in den
Die Station hat 20 stationäre Behandlungsplät- aktuellen Lebensbezügen der Betroffenen sehen.
ze und ist Schwerpunktstation zur Depressions- Chronisch depressive Patienten werden mittels
behandlung. Es werden die diagnostischen und „Cognitive Behavioral Analysis System of Psycho-
therapeutischen Empfehlungen der S3-Leitlinie therapy“ (CBASP) behandelt. CBASP setzt an spe-
und Nationalen Versorgungsleitlinie Unipolare zifischen Denk- und Interaktionsmustern chro-
Depression und Bipolare Störungen in die Praxis nisch depressiver Menschen an und versucht,
umgesetzt. Demnach haben Psychotherapie und diese durch gezielte Interventionen positiv zu
medikamentöse Therapie einen gleich hohen verändern. Ein zertifiziertes Curriculum zur Aus-
Stellenwert in der Depressionsbehandlung, bei bildung in CBASP wird jährlich durchgeführt, um
mittelschweren und schweren Depressionen soll- Assistenzärzte, Psychologen und Kotherapeuten
ten beide Verfahren kombiniert werden. zu schulen.
Vor der Behandlung der Depression wird zu- Gleichbedeutend neben der Psychotherapie
nächst eine gründliche Diagnostik durchgeführt, werden Antidepressiva eingesetzt, hier vor al-
um Ursachen der Depression zu finden und eine lem moderne mit selektiven Rezeptorwirkungen.
spezifische und langfristig ausgerichtete Thera- Diese haben den Vorteil, dass sie spezifischer wir-
pie planen zu können. Wichtigstes Behandlungs- ken und in der Regel weniger Nebenwirkungen
ziel ist es, eine Vollremission der aktuellen depres- haben. Sollten diese Behandlungen alleine nicht
siven Episode zu erreichen. An die Remission greifen, hat die Augmentationstherapie mit Li-
schließt sich die Erhaltungstherapie für mehrere thium ihre Wirksamkeit bewiesen. Leichtere sai-
Monate und an diese die weitere Rückfallprophy- sonale Depressionsformen können mit Hilfe der
laxe an, die je nach Schweregrad und Häufigkeit Lichttherapie (siehe Bild unten rechts) behandelt
der vorangegangenen Episoden in ihrer Dauer werden. Auch der partielle Schlafentzug (Wacht-
variieren kann. herapie) kommt zum Einsatz.
In psychoedukativen Gruppen wird den Patienten Ergänzt wird das Angebot durch Elektrokonvul-
Wissen über ihre Erkrankung vermittelt. So erfah- sionstherapie für therapieresistente oder stark
ren sie u.a. wie die Depression sich über negative suizidale depressive Patienten. Die EKT-Einheit
Gedanken und sozialen Rückzug selber verstärkt besteht aus einem Behandlungsraum und einer
(Depressionsspirale) und mit welchen Mitteln Observationsstation mit vier Monitorplätzen. In
sie selber dagegen arbeiten können. Weiterhin Kooperation mit der Klinik für Anästhesiologie
werden Gruppen und Einzelgespräche in spezifi- werden dreimal wöchentliche Behandlungen an-
schen Psychotherapieverfahren angeboten. geboten.
Die Interpersonelle Psychotherapie (IPT) ist eine
evidenzbasierte depressionsspezifische Psycho-
therapie, die auf der Grundidee beruht, dass die
Depression sich aus dem psychosozialen Kontext
heraus entwickelt, z. B. Veränderungen durch Tod,.
91
1.2.2 Schwerpunktstation Außerdem findet einmal pro Woche eine Gruppe
Angst- & Zwangserkrankungen statt, die Patienten allein, ohne therapeutische
Begleitung, gestalten. Im Rahmen dieser Grup-
pe besprechen die Patienten ihre Probleme und
Auf der Station werden schwerpunktmäßig Erfolge bei den Expositionseinheiten und die.
Angst- und Zwangsstörungen behandelt. Im Jah- Betroffenen geben sich dabei wertvolle gegensei-
re 2013 fand ein klinikinterner Umzug statt, der tige Unterstützung. An dieser Gruppe können die
zum einem eine Vergrößerung der Station von Patientinnen und Patienten auch nach ihrer Ent-
16 auf 20 Betten mit sich brachte und zum an- lassung weiterhin teilnehmen. Alle vier Wochen
deren eine Modernisierung der Räumlichkeiten nimmt ein Psychotherapeut der Station an dieser
samt ihrer Ausstattung. 20 vollstationäre und Gruppe teil, um eventuell zwischenzeitlich auf-
vier teilstationäre Behandlungsplätze stehen nun getretene Probleme gemeinsam zu lösen und um
in einem hellen und freundlichen Ambiente zur den Informationsaustausch zwischen den Grup-
Verfügung. penteilnehmern und dem Behandlungsteam zu
Das Therapieangebot der Station verfolgt ei- gewährleisten
nen ganzheitlichen, mehrdimensionalen An- Einmal im Quartal lädt die Klinik zu einem Trialog
satz. Neben dem psychotherapeutischen Kern- zum Thema Zwangserkrankungen ein. Es handelt
programm mit Einzel- und Gruppensitzungen sich hierbei um eine öffentliche Veranstaltung, an
kommen hier spezifische kognitiv-verhaltens- der Betroffene, Angehörige und Experten teilneh-
therapeutische Behandlungsprogramme und men. Diese Veranstaltung dient dem Erfahrungs-
Pharmakotherapie zum Einsatz. Weiterhin und Informationsaustausch und hilft Behand-
werden unterschiedliche Therapiebausteine lungsbarrieren und Tabuisierung der Erkrankung
wie Physiotherapie, Bewegungstherapie, Er- abzubauen.
gotherapie, Bezugspflegegespräche, soziales
Kompetenztraining, Sporttherapie (in Form von
Frühsport, Ergometertraining, Laufgruppen,
therapeutischem Boxen, etc.), Entspannungs-
training und Eutonie angeboten, um eine in-
dividuell abgestimmte und bedarfsadaptierte.
Gesamtbehandlung zu gewährleisten.
In einer ambulanten Angst- und Zwangssprech-
stunde können sich die Betroffenen zunächst
informieren und beraten lassen. Diese hat in den
letzten Jahren eine starke Nachfrage erfahren
und wird auch überregional intensiv in Anspruch
genommen. Hier wird zunächst festgestellt, ob
eine Angst- und / oder Zwangsstörung vorliegt
und die Betroffenen werden in Bezug auf die Er-
krankung und die Therapiemöglichkeiten indivi-
duell beraten.
Ziel der stationären Behandlung ist die Reduk-
tion der Ängste und Zwänge, um wieder eine
weitgehende Symptomfreiheit und eigenstän-
dige Lebensführung zu erreichen. Alle Patienten
erhalten eine umfassende Psychoedukation, um
ihre Erkrankung verstehen zu können. Sie ler-
nen, die aufrechterhaltenden Faktoren im Alltag
selbst zu erkennen und zu beeinflussen und sich
somit über den stationären Aufenthalt hinaus zu
stabilisieren. Zusätzlich wird deshalb auch eine
tagesklinische Behandlung angeboten, um den
Übergang von der stationären Behandlung in das
häusliche Umfeld zu erleichtern.
10Klinische Versorgung
1.2.3 Schwerpunktstation verfolgt zu werden. Dies kann schließlich zu star-
Psychosen ken Ängsten oder auch zu ungewöhnlichen an-
mutenden Verhaltensweisen führen.
Bei akuten Psychosen sollte möglichst rasch eine
Der Begriff Psychose bezeichnet psychische Stö- psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung,
rungen unterschiedlicher Ätiologie, welche vor je nach Ausprägungsgrad ambulant oder statio-
allem mit Veränderungen der Wahrnehmung, des när, erfolgen. Initial sind vor allem eine genaue
Denkens und der Affektivität einhergehen und Be- diagnostische Abklärung und adäquate medika-
einträchtigungen in allen Lebensbereichen – von mentöse Therapie von Bedeutung. Schwerpunkt
der Arbeit über die Gestaltung sozialer Kontakte unserer Station sind ebenfalls psychotherapeuti-
bis hin zur eigenständigen Lebensführung – mit sche und soziotherapeutische Interventionen, die
sich bringen können, aber nicht müssen. die Probleme des Patienten in den Fokus nehmen,
Zu Beginn der Erkrankung bemerken die Betrof- den Behandlungserfolg sicherstellen und zu einer
fenen oft unspezifische Symptome wie Konzen individuellen Rückfallprävention beitragen.
trationsstörungen und Schlafstörungen oder Das Angebot der Schwerpunktstation „Psycho-
nehmen ihre Umwelt zunehmend als verändert sen“ richtet sich an Menschen mit akuten und
wahr. Sie werden häufig sensibler gegenüber. chronischen psychotischen Störungen (Schizo-
ihren Mitmenschen, sind weniger belastbar, an- phrenien, schizoaffektive Störungen, bipolare
fälliger für Stress und ziehen sich zunehmend aus Störungen). Es stehen insgesamt 20 vollstati-
ihrem sozialen Umfeld zurück. Charakteristisch onäre und 3 teilstationäre Behandlungsplätze
ist außerdem, dass manche Menschen mit Psy- zur Verfügung. Ein besonderer Schwerpunkt der
chosen alltägliche Erlebnisse, Nachrichten und Station liegt auf der frühen und subklinischen.
Ereignisse sehr stark auf sich beziehen und ihnen Erkrankungsphase. Das bestehende Angebot um-.
eine besondere Bedeutung beimessen. Im wei- fasst umfasst die Diagnostik bei Risikokon
teren Krankheitsverlauf können dann Wahrneh- stellationen, also beim Vorhandensein eher unspe-
mungsveränderungen in Form von Halluzinatio- zifischer Symptome und Verhaltensauffälligkeiten,
nen auftreten, die prinzipiell alle Sinnesqualitäten wie sie im Vorfeld der ersten Manifestation einer
betreffen können. Es können sich ungewöhnliche psychotischen Störung auftreten (z. B. attenuierte,
Überzeugungen herausbilden, zum Beispiel das d. h. abgeschwächte psychotische Symptomen,
Gefühl, von anderen beeinflusst, gesteuert oder kurz andauernde und spontan remittierende psy-
chotische Symptome (BLIPS= Brief Limitted In-
termittend Psychotic Symptoms)), die Diagnostik
und Therapie einer ersten psychotischen Episode
sowie Angebote für Patienten mit wiederkehren-
den Episoden.
Neben der leitliniengerechten medikamentösen
Therapie steht die psychotherapeutische Behand-
lung mit Einzel- und Gruppentherapiesitzungen
kognitiver Verhaltenstherapie im Vordergrund,
in der ein verbesserter Umgang mit belastenden
Emotionen und Problemen im Alltag erreicht
wird. Zusätzlich werden die Patienten durch Psy-
choedukationsgruppen, Metakognitives Training
(MKT) und das Training von Entspannungsverfah-
ren unterstützt. Komplementärtherapeutisch ste-
hen außerdem Ergotherapie zur Aktivierung kre-
ativer Ressourcen, computergestützte Verfahren
zur Förderung der Konzentrations-, Denk- und Ar-
beitsfähigkeiten, Physiotherapie, Bewegungsthe-
rapie und soziale Aktivitäten zur Verfügung. Die
Unterstützung bei sozialen Belangen sowie Ange-
hörigengruppen als wesentliche Teile des Behand-
lungskonzeptes runden das Therapieangebot ab.
111
1.2.4 Schwerpunktstation
Alterspsychiatrie - Supervidierte Einzelpsychotherapie mit kogni-
tiv-verhaltenstherapeutischem Schwerpunkt
Das Behandlungsangebot der Station richtet sich - Psychoedukation
an ältere Menschen mit seelischen Erkrankun- - Gruppentraining Soziale Kompetenzen (GSK)
gen und/oder kognitiven Störungen, die mit Hil- und Aktivitäten des täglichen Lebens
fe moderner Verfahren differentialdiagnostisch - Ergotherapie
eingeordnet und leitliniengerecht therapiert - Bewegungstherapie und Krankengymnastik
werden. Die Therapie umfasst medikamentöse, (Gruppen- oder Einzeltherapie)
psychotherapeutische, neuropsychologische, - Pflegerische Aktivierungsangebote zur Frei-
komplementärtherapeutische und psychosoziale zeitgestaltung (Außenaktivitäten, Zeitungs-
Behandlungsansätze und hat das Ziel, so lange runde)
wie möglich die Lebensqualität in gewohntem - Genuss- und Wahrnehmungstraining
Umfang aufrechtzuerhalten. Um das Leben in - Engmaschige pflegerische Betreuung im Rah-
der häuslichen Umgebung zu erleichtern und die men der Bezugspflege
Erfolge der stationären Behandlung zu festigen, - Entspannungsverfahren (Progressive Mus-
kann die Behandlung auch tagesklinisch durch- kelentspannung nach Jacobson)
geführt werden. - Angehörigengruppe
Das Behandlungskonzept der gerontopsychia-
trischen Station wurde in den letzten fünf Jah- Mit Hilfe des Sozialdienstes erfolgt eine umfang-
ren substantiell überarbeitet und entsprechend reiche Beratung und Vermittlung psychosozialer
der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse Unterstützungsmöglichkeiten. Daher wird stets
optimiert. Zur Steigerung der Versorgungsqua- eine enge Kooperation mit der Marburger Bür-
lität werden die Mitarbeiter der Station konti- gerinitiative Sozialpsychiatrie e.V., der Sozialen
nuierlich weitergebildet. Zu diesem Zweck wird Hilfe Marburg e.V. und den anderen psychosozia-
neben externen Veranstaltungen hausintern ein len Einrichtungen der Region gepflegt.
Weiterbildungskolloquium/Fallseminar für Ge-
rontopsychiatrie, -psychotherapie und Demenz- Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Stations-
diagnostik angeboten. Des Weiteren absolvier- arbeit ist die umfangreiche Beratung der Ange-
ten die ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiter hörigen, die bei Bedarf in unserer Angehörigen-
sowie die Mitarbeiter des Sozialdienstes und der gruppe erfolgen kann. Neben dem Austausch mit
Ergotherapie Hospitationen in anderen geronto- anderen Betroffenen werden hier Informationen
psychiatrischen Zentren Deutschlands. Fachärzte über die Erkrankungen und soziale Hilfsangebo-
für Psychiatrie und Psychotherapie können an der te vermittelt sowie Strategien zum Umgang mit
Klinik im Rahmen einer mindestens zweijährigen krankheitstypischem Verhalten von betroffenen
Weiterbildung die Zusatzbezeichnung „Geriatrie“ Angehörigen erlernt.
erwerben.
Zum Leitungsspektrum der Station zählen:
- Ärztliche Behandlung der psychiatrischen.
und ggf. der begleitenden körperlichen Erkran-
kungen
12Klinische Versorgung
1.2.5 Schwerpunktstation Team ihm beim Aufbau dieser Motivation und
Abhängigkeitserkrankungen entwickelt mit ihm gemeinsam Selbstwirksam-
keit, damit er abstinenzsichernde Maßnahmen
Das multiprofessionelle Behandlungsteam um- wie Besuch von Suchtberatungsstellen, Selbst-
fasst Ärzte, Psychologen, Krankenpflegepersonal, hilfegruppen und gegebenenfalls auch mehr-
Sozialarbeiter sowie Ergo- und Physiotherapeu- wöchige Entwöhnungsbehandlungen anstreben
ten. Die Patienten finden so ein breites Angebot kann.
aus themenzentrierten Einzel- und Gruppenthe-
Wichtig ist bei dieser Behandlung, dass von An-
rapien und weiterhin regelmäßige Möglichkeiten
fang an externe Therapeuten von Suchtbera-
für Sport, Gymnastik und Bewegungstherapie
tungsstellen oder Entwöhnungskliniken regel-
entsprechend ihrer körperlichen Verfassung so-
mäßig auf die Station kommen, die Patienten
wie ein breitgefächertes Angebot für Ergothera-
direkt ansprechen und auf die Therapieangebote
pie.
aufmerksam machen. Selbsthilfegruppen kom-
Zunächst erfolgt die körperliche Entgiftung von men wöchentlich auf die Station und stellen sich
Alkohol bzw. Beruhigungsmitteln (zumeist Ben- den Patienten vor. Einmal wöchentlich findet
zodiazepinen). Vor allem bei der Alkoholentgif- ein reguläres Treffen einer Selbsthilfegruppe auf
tung bewähren sich Scores, die unterschiedliche dem Klinikgelände statt und es besteht eine Zu-
Anteile des Entzugssyndroms erfassen, gewich- sammenarbeit mit Selbsthilfegruppen, die sich
ten und hierdurch eine angepasste möglichst im Umkreis von 1-2 km um die Klinik herum re-
niedrig-dosierte Medikation zur Behandlung gelmäßig treffen. Ziel ist es, die Schwelle für wei-
der Entzugssymptome ermöglichen. Bei Beruhi- terführende Beratungen und Behandlungen zu
gungsmitteln bewährt es sich, durch stetige, aber senken und die Weiterbehandlung unmittelbar
langsame Dosisreduktion das Medikament nach von der Station aus in die Wege zu leiten.
und nach abzusetzen.
Die psychotherapeutische Haltung auf der Sta-
An die körperliche Entgiftung anschließend tion basiert auf der „Motivierenden Gesprächs-
werden im Sinne des "Qualifizierten Entzuges" führung“. Diese hilft Patienten mit Autonomie-
gezielt Therapiegruppen und Einzelgespräche problemen oder Therapiewiderständen offener
angeboten. Dazu gehören Psychoedukations- oder versteckter Art zu einer aktiven und selbst-
gruppen, Sucht-Informationsgruppen und die bestimmten Motivation und Therapie zu führen.
Sucht-Kompetenzgruppe. Das wichtigste Ziel ist, Sie bewährt sich insbesondere in der Behandlung
mit den Patienten gemeinsam zu verstehen, wie von Menschen mit Abhängigkeiten, beispielswei-
das bisherige Leben durch Sucht beeinflusst ist se von Alkohol und Medikamenten.
und die überwiegend negativen Auswirkungen
Die Station ist mit 2-4-Bett-Zimmern, Aufent-
des Suchtmittels auf den Körper und die Psyche
halts- und Gruppenraum und einem Ergothera-
zur Kenntnis zu nehmen und nicht mehr zu ver-
pieraum ausgestattet. Soweit erforderlich, kann
leugnen. Anschließend wird mit dem Patienten
ein geschützter Rahmen eingerichtet werden,
danach gesucht, wie er in Zukunft mit dem Sucht-
der dazugehörige Garten gewährt dennoch Aus-
mittel umgehen will. Soweit eine Abstinenzmo-
weich- und Bewegungsmöglichkeiten.
tivation erkennbar ist, hilft das therapeutische
131
1.2.6 Schwerpunktstation Gruppentherapien, Bezugspflege, Psychoedu-
Akute Krisen kation, Angehörigengespräche, Ergotherapie,
Physiotherapie, Bewegungstherapie, Entspan-
Die Akutstation ist eine geschützte, allgemein- nungsverfahren, Beratung in sozialen Fragen und
psychiatrische Station mit 14 vollstationären Be- bedarfsadaptierte Planung der weiterführenden
handlungsplätzen und bis zu vier tagesklinischen ambulanten Behandlungsmaßnahmen, wozu z. B.
Plätzen. Der Behandlungsschwerpunkt liegt auf auch die Einrichtung von betreutem Wohnen
der Therapie akut erkrankter Patienten mit Krank-
heitsbildern aus dem gesamten Spektrum der
psychiatrischen Diagnosen. Um die Versorgung
optimal gewährleisten zu können, gibt es z. B.
Einzelzimmer zur Reizabschirmung und ein be-
sonderer Personalschlüssel beim Krankenpflege-
team, da häufig eine enge personelle Betreuung
bis hin zur 1:1 Betreuung erforderlich ist. Durch
eine durchgängige ärztliche Besetzung mit min-
destens zwei Stationsärzten und einem Oberarzt
ist auch auf dieser Ebene eine intensive Therapie
und bei Bedarf z. B. in akuten Krisensituationen
schnelle und flexible Versorgung möglich. Das
multiprofessionelle Team umfasst zudem Ergo- oder die Organisation eines Platzes in stationä-
therapeuten, Physiotherapeuten und eine Sozial- ren, betreuten Wohneinrichtungen zählt.
beratung, die mittels speziell auf die Erkrankung Weiterhin werden in Zusammenarbeit mit den
und die aktuelle Leistungsfähigkeit des einzelnen Kollegen der anderen Fachabteilungen auch
Patienten zugeschnittenen Einzel-und Gruppen- nichtpsychiatrische Begleiterkrankungen umfas-
therapien die Behandlung ergänzen. send diagnostisch abgeklärt und behandelt.
Nach der Aufnahme erfolgt eine ausführliche Einige Patienten benötigen den geschützten
psychiatrische und internistisch/neurologi- Rahmen der Station lediglich für eine kurze Zeit
sche Untersuchung, die im weiteren Verlauf je im Rahmen einer Krisenintervention und können
nach differentialdiagnostischen Erwägungen rasch auf eine der Schwerpunktstationen der Kli-
durch zusätzliche Untersuchungen wie EKG, nik verlegt oder auch ambulant weiterbehandelt
EEG, CT/MRT, neuropsychologische Verfahren werden. Bei anderen Patienten wird zusätzlich
und Lumbalpunktion ergänzt wird. Auf Basis zur Behandlung der akuten Krankheitssymp-
der anhand der verschiedenen Untersuchungs- tome, die meist psychopharmakologisch erfolgt,
befunde, erhobenen Diagnose wird für jeden durch das Etablieren einer guten, tragfähigen
Patienten ein individuelles Behandlungskon- therapeutischen Beziehung und das gemeinsa-
zept erarbeitet. Dieses umfasst psychopharma- me Erarbeiten und Vermitteln eines individuellen
kologische Behandlung, auf einem kognitiv-. Krankheits- und Behandlungskonzeptes durch
verhaltenstherapeutischen Konzept basierende das Stationsteam der wichtigste Grundstein für
individuelle psychotherapeutische Einzel- und die weitere Therapie gelegt.
14Klinische Versorgung
1.3 Ambulanzen und
Konsiliardienst
Die Ambulanz der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie gliedert sich in die Psychiatrische
Institutsambulanz (PIA), die Hochschulambulanz
(HSA) sowie den psychiatrischen Konsiliardienst
für das gesamte Marburger Universitätsklinikum.
Angegliedert ist weiterhin die psychotherapeu-
tische Ausbildungsambulanz des Institutes für
Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin (IVV)
und die Psychotherapeutische Beratungsstelle
für Studierende (PBS).
Fallzahlentwicklung Hochschulambulanz und
Institutsambulanz
2500
2000
Anzahl Patienten
1500
1000
500
0
2009 2010 2011 2012 2013
Hochschulambulanz
Jahre
Institutsambulanz
Abb. 2: Entwicklung der Scheinzahlen innerhalb der letzten Jahre für die
Psychiatrische Institutsambulanz sowie die Hochschulambulanz
151
Psychiatrische Institutsambulanz Konsiliardienst
Die Psychiatrische Institutsambulanz versorgt Pa- Der psychiatrische Konsiliardienst versorgt alle
tienten mit psychischen Störungen, die wegen klinischen Abteilungen der somatischen Fächer
der Art, Schwere oder Dauer ihrer Erkrankung am Marburger Universitätsklinikum. Dabei er-
einer intensiven, krankenhausnahen Behand- folgt zumeist ein aufsuchender Kontakt durch
lung bedürfen, welche nicht durch die anderen den Konsiliararzt auf der anfordernden Station.
vertragsärztlichen Versorgungsangebote abge- Somit bekommen auch intensivmedizinisch be-
deckt werden kann. Somit schließt sie die Ver- handelte oder andere schwerer erkrankte Patien-
sorgungslücke zwischen einerseits stationären ten Zugang zu einer integrativen psychiatrischen
bzw. teilstationären Behandlungsangeboten Mitbehandlung.
und andererseits Behandlungen von niederge-
lassenen Psychiatern, Psychotherapeuten sowie Psychotherapeutische Ausbildungsambulanz
Medizinischen Versorgungszentren. Die Psych- des IVV
iatrische Institutsambulanz soll hierdurch Kran- Die Hochschulambulanz arbeitet eng mit der
kenhausaufnahmen vermeiden und stationäre Psychotherapeutischen Ausbildungsambulanz
Behandlungszeiten verkürzen. Durch die enorm
des Instituts für Verhaltenstherapie und Verhal-
wichtige Behandlungskontinuität wird die psy-
tensmedizin (IVV) der Philipps-Universität Mar-
chische, körperliche sowie soziale Integration
burg zusammen. Hier wird ambulante Psycho-
der Patienten stabilisiert. Das Leistungsangebot
therapie für Erwachsene sowie auch Kinder und
der Psychiatrischen Institutsambulanz umfasst
Jugendliche durch angehende ärztliche und
das gesamte Spektrum einer multiprofessio-
psychologische Psychotherapeuten unter Su-
nellen, psychiatrisch-psychotherapeutischen
pervision durchgeführt. Die Behandlung erfolgt
Diagnostik und Therapie, einschließlich neuro-
vorwiegend durch die Ärzte der Klinik für Psych-
psychologischer sowie organischer Diagnostik,
iatrie und Psychotherapie in Form einer von den
Psychopharmakotherapie, Psychotherapie, An-
gesetzlichen Krankenkassen anerkannten Richt
gehörigenarbeit, ergotherapeutischen, physio-
linienpsychotherapie.
therapeutischen und soziotherapeutischen Maß-
nahmen.
Psychotherapeutische Beratungsstelle
Hochschulambulanz der Universität Marburg
Die Hochschulambulanz umfasst in erster Linie Die Psychotherapeutische Beratungsstelle der
eine Reihe von Spezialsprechstunden, die zum Universität Marburg besteht seit den siebziger
Teil an die störungsspezifischen Konzepte unse- Jahren. Sie wurde als niederschwellige Kontakt-
rer Schwerpunktstationen angeschlossen sind. stelle in den Räumen der großen Mensa (am Er-
Hierzu zählen die Psychose-Früherkennungsam- lenring) eingerichtet. Sie ist als erste Anlaufstelle
bulanz, die Spezialambulanz für Alterspsychiatrie für Studierende gedacht, wenn diese unter Stu-
sowie die Zwangssprechstunde. Darüber hinaus dienschwierigkeiten (Studienwahl, Lern- oder
existieren noch Spezialsprechstunden für ADHS Arbeitsschwierigkeiten, Prüfungsprobleme,
im Erwachsenenalter sowie Schlafstörungen. Fachwechsel), persönlichen Lebensproblemen
Zudem deckt die Hochschulambulanz die psych- (Partner- und Familienkonflikte, Kontaktschwie-
iatrische Notfallversorgung sowie die stationäre rigkeiten) oder anderen psychischen Problemen
Aufnahmeplanung ab, damit die Patienten zen- leiden. Die Beratungen finden im Rahmen einer
tral den Schwerpunktstationen bzw. speziellen offenen Sprechstunde (10 Stunden pro Woche)
ambulanten Versorgungsangeboten zugeführt ohne Formalitäten, Krankenschein oder Anmel-
werden können. dung, kostenlos und auf Wunsch auch anonym,
16Klinische Versorgung
Anzahl Beratungen in der PBS
600 571
550
480 493 484
500
400
300
200
100
0
2009 2010 2011 2012 2013
Abb. 3: Anzahl der Beratungen in der Psychologischen Beratungsstelle (PBS)
für Studierende pro Jahr
durch Mitarbeiter der Klinik für Psychiatrie und Im Jahr 2013 waren es nur etwa 5%. Die Abnah-
Psychotherapie statt. Die PBS ermöglicht den me der Empfehlungen einer stationären Thera-
Studierenden sich frühzeitig, auch bei vermeint- pie ist dadurch bedingt, dass sich Studierende
lich geringen Anlässen und vorübergehenden auf Grund der Veränderungen der Studienbedin-
Schwierigkeiten, an einem neutralen Ort beraten gungen auch bei schwerwiegenderen Störungen
zu lassen. Reicht ein Gespräch zur Klärung nicht kaum noch auf einen mehrwöchigen Ausfall im
aus, wird von den PBS-Mitarbeitern eine Empfeh- Studium einlassen wollen.
lung zur weiteren Behandlung gegeben und über
bestehende Möglichkeiten informiert.
Etwa ein Drittel der Ratsuchenden erhielt als Be-
ratungsergebnis die Empfehlung, eine weiter-
führende Therapie aufzunehmen. Im Jahr 2008
erhielten etwa 14 % der Ratsuchenden die Emp-
fehlung, eine stationäre Therapie aufzunehmen.
171
1.4 Klinische Abteilungen sert. Es wurde ein neues EKT-Gerät (Thymatron®
System IV, Somatics, LLC) angeschafft, das u.a.
1.4.1 Abteilung für Elektrokon- eine verbesserte Behandlungsanalyse sowie eine
vulsionstherapie (EKT) Kurzimpulstechnik zur nebenwirkungsärmeren
Behandlung ermöglicht. Im Mai 2013 erfolgte die
Aufgrund ihrer schnellen Wirkung und hohen Einweihung der räumlich neuen EKT-Abteilung
Remissionsraten wird die Elektrokonvulsionsthe- mit einem geräumigen Behandlungsraum sowie
rapie (EKT) entsprechend den deutschen und in- einem Aufwachraum mit vier Monitorplätzen.
ternationalen Behandlungsleitlinien zur Behand-
lung therapieresistenter depressiver Störungen Unter der Supervision des zuständigen Oberarz-
und schizophrener Psychosen äußerst erfolgreich tes werden die Assistenzärzte in der Durchfüh-
eingesetzt. Die EKT wurde im Laufe ihrer 75 jäh- rung der EKT ausgebildet.
rigen Geschichte durch technische Innovationen
und Verwendung von Kurznarkosen mit Muskel-
relaxation so weit optimiert, dass es sich um ein
sehr sicheres und nebenwirkungsarmes Behand-
lungsverfahren handelt.
Bereits seit vielen Jahrzehnten wird die Elek
trokonvulsionstherapie in der Universitätsklinik
für Psychiatrie und Psychotherapie erfolgreich
durchgeführt, wobei die jährliche Anwendungs-
anzahl in den letzten Jahren stetig zunahm und
derzeit über 450 elektrokonvulsive Einzelbe-
handlungen pro Jahr erfolgen. Da die Klinik als
einzige psychiatrische Universitätsklinik Hessens
diese höchst effektive Behandlungsform anbie-
tet, besteht eine stetig wachsende Nachfrage zur
Übernahme von Patienten, weshalb ein weiterer
Ausbau der EKT-Kapazitäten geplant ist.
In den letzten fünf Jahren wurde durch Heraus
arbeitung einer einheitlichen hausinternen Richt-
linie die Qualität der EKT- Behandlungen verbes-
EKT-Einzelnbehandlungen
EKT-Einzelbehandlungen pro Jahr
pro Jahr
500
500
453
453
450
400
400
338 338
344 344 342 342
350
300
300
250 250
250
214
200
200
150
100
100
50
0
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2009 2010 2011 2012 2013
Abb. Anzahl der EKT-Sitzungen pro Jahr
18Klinische Versorgung
1.4.2 Elektrophysiologie und Schlaf- det, bei Therapien mit bestimmten Psychophar-
physiologie maka auch wiederholt im Behandlungsverlauf.
Ende 2013 wurden zwei vollausgerüstete
Elektrophysiologische Untersuchungen Schlafableiteplätze zu polysomnographischen
(EEG und EKG) Untersuchungen incl. Videoüberwachung auf
Das Elektroenzephalogramm (EEG) erlaubt ohne Station 1B eingerichtet. In Zusammenarbeit mit
körperlichen Eingriff, lediglich durch Ableitung den Kollegen des pulmonologischen Schlaflabors
elektrischer Spannungen von der Kopfhaut, Auf- werden hier schlafmedizinische Untersuchun-
schlüsse über die Gehirntätigkeit des Menschen. gen zu verschiedenen diagnostischen Zwecken
Das Verfahren ist für den Patienten nebenwir- (z. B. Schlafstörungen im Rahmen von affekti-
kungsfrei. Ihm werden in standardisierter Anord- ven Erkrankungen oder Demenzen, Ausschluss
Anzahl EEG und EKG Ableitungen
1400
1234
1200
1002
1000
856
750 780
800
EEG
560 574 EKG
600 550 523
427 Abb. 4:
400
Anzahl
der abgeleiteten
200
EEGs und EKGs
0 pro Jahr
2009 2010 2011 2012 2013
nung flache Elektroden an die Kopfhaut gesetzt. organischer Schlafstörungen im Rahmen der In-
Nach Anbringen der Elektroden muss der Pati- somniediagnostik) aber auch für Forschungsfra-
ent möglichst ruhig sitzen/liegen und sich ent- gestellungen durchgeführt.
spannen. Die Ableitung nimmt 45-60 Minuten in Mittels Elektrokardiogramm (EKG) lässt sich in
Anspruch, die Auswertung insgesamt 15-30 Mi- ähnlicher Weise die elektrische Aktivität des Herz-
nuten. Für die Auswertung werden nach einem muskels feststellen. Dies ist einerseits wichtig, da-
standardisierten Verfahren die Geschwindigkeit mit begleitende Erkrankungen unserer Patienten
und die Verteilung der Hirnstromwellen beur- ausgeschlossen bzw. beurteilt werden können,
teilt. Fernerhin wird nach allgemeinen Verlangsa- andererseits aber auch um mögliche Nebenwir-
mungen, nach räumlich umschriebenen Verlang- kungen von Medikamenten, speziell Herzrhyth-
samungen sowie nach übermäßig synchroner musstörungen, frühzeitig feststellen zu können.
Aktivität gesucht. Die Auswertung erfolgt durch Diese Untersuchung wird bei jedem Patienten
ein Ärzteteam der Klinik unter Supervision von Dr. bei Aufnahme durchgeführt und bei Therapie
med. Schu. Mittels EEG lassen sich auf diese Weise mit Psychopharmaka auch im Behandlungsver-
Entzündungen des Gehirnes (Encephalitis) aus- lauf wiederholt.
schließen und Hinweise auf Epilepsie wie auch In der klinikeigenen Abteilung für EEGs und EKGs
auf andere Erkrankungen des Gehirnes finden werden jährlich etwa 500 EEGs und 800 – 1200
(Tumore, Schlaganfälle, Abbauprozesse wie bei EKGs abgeleitet. Die eigene Auswertung von EEG
Alzheimerscher Erkrankung). Ebenso lassen sich und EKG ist Teil der Ausbildung zum Facharzt für
hiermit für einzelne Psychopharmaka bestimmte Psychiatrie und Psychotherapie. Mittels dieser
Nebenwirkungen nachweisen. Daher wird diese eigenen EEG-Abteilung gewährleisten wir auch
Untersuchung für jeden Patienten durchgeführt, diesen Ausbildungsteil für die Weiterbildungsas-
der erstmalig eine psychische Erkrankung erlei- sistenten.
191
1.4.3 Abteilung für Klinische planung. Zusätzlich werden auch neuropsycholo-
Neuropsychologie gische Zusatzgutachten für die Gutachtenabtei-
lung an der Universitätsklinik für Psychiatrie und
Die Abteilung für Klinische Neuropsychologie Psychotherapie erstellt. Im Rahmen der Weiterbil-
führt die neuropsychologische und psychomet- dung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychothe-
rische Diagnostik für stationäre und ambulante rapie sowie zum Psychologischen Psychothera-
Patienten der Klinik durch. Es werden Standard- peuten werden Weiterbildungsveranstaltungen
verfahren der Neuropsychologie eingesetzt, re- zu neuropsychologischer und psychometrischer
gelmäßiges Qualitätsmanagement stellt sicher, Diagnostik angeboten.
dass die Verfahren höchsten Qualitätsstandards
entsprechen.
Folgende Aufgaben werden durch die Abteilung
im Rahmen der klinischen Versorgung übernom-
men:
- Neuropsychologische Diagnostik bei Verdacht
auf das Vorliegen einer Demenz, differential-
diagnostische Abgrenzung zwischen Demenz
und Depression, Demenzfrüherkennung
- Früherkennung von Prodromalsymptomatik
(Schizophrenie, bipolare Störung)
- Neuropsychologische Diagnostik bei Verdacht
auf Aufmerksamkeits- Defizit- (Hyperaktivitäts)
Störung, Objektivierung möglicher neuropsy-
chologischer Defizite
- Objektivierung von subjektiv durch Patienten
oder Behandler beobachteten neuropsycho-
logischen Defiziten im Bereich Gedächtnis,
Konzentration und Planen/ Problemlösen bei
psychischen oder hirnorganischen Störungen
(Substanzabhängikeit, Schädel-Hirn-Trauma,
entzündliche/vaskuläre Erkrankungen des Ge-
hirns etc.)
- Intelligenzdiagnostik
- Persönlichkeitsdiagnostik
- Beurteilung der Ausbildungsfähigkeit, Arbeits-
fähigkeit oder der psychischen Belastbarkeit
bei Fragen zur Berufs- oder Studierfähigkeit
aufgrund neuropsychologischer Defizite im
Rahmen psychischer oder hirnorganischer Stö-
rungsbilder.
Die überweisenden Abteilungen erhalten einen
detaillierten neuropsychologischen Befund sowie
Beratung hinsichtlich der weiteren Behandlungs-
20Klinische Versorgung
1.5 Pflegedienst Angebot für Angehörige unserer Patienten seit-
dem gemeinsam regelmäßig durch.
In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
arbeiten auf 72 Planstellen, in Voll -und Teilzeit, Zur Erhaltung und Optimierung der Qualität un-
Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger serer pflegerischen Arbeit wurde im Jahr 2013 ein
und Heilerziehungspfleger, für die pflegerische klinikspezifisches Einarbeitungskonzept für neue
Vorsorgung der stationären und teilstationären Mitarbeiter implementiert. Allen Mitarbeitern des
Patienten auf den Stationen sowie in der Ambu- Pflegedienstes steht ein Fortbildungsangebot in
lanz. Jede Station wird vor Ort pflegerisch durch Form von monatlich stattfindenden Arztvorträ-
eine Stationspflegeleitung, die in den Arbeitspro- gen einerseits und „Pflege für Pflege“-Veranstal-
zess eingebunden ist, geführt. tungen andererseits zur Verfügung. Hier besteht
Die Pflegeteams der Stationen betreuen und die Möglichkeit für alle Berufsgruppen der Klinik,
begleiten die Patienten im Bezugsbetreuungs- Kenntnisse zu aktualisieren, Erfahrungen auszu-
system. Dieses Konzept wurde im Jahr 2010 ak- tauschen und neue pflegespezifische Erkennt-
tualisiert. Die Sicherstellung einer individuell nisse zu kommunizieren. Komplettiert wird das
geplanten, sach- und fachkundigen Pflege, Be- Fortbildungsangebot durch die Angebote der
treuung und Beratung wird durch die obligatori- Fachweiterbildungsstätte Psychiatrie.
sche Erstellung von Pflegeplanungen unterstützt.
Seit 2011 stehen dazu klinikseigene, störungs-
spezifische Pflegeplanungsformulare, die den 1.6 Fachweiterbildung
Pflegeprozess dokumentieren, zur Verfügung.. „Psychiatrische Pflege“
Das oberste Ziel psychiatrischer Pflege ist die
Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Pati- In der neu konzipierten Weiterbildungsstätte
enten, insbesondere die Förderung der gesunden wird Mitarbeitern der Pflege – und Erziehungs-
Anteile der Patienten und die Unterstützung bei berufe die Möglichkeit angeboten, sich berufs-
der Erhaltung, Anpassung und Wiederherstellung begleitend für die zunehmend anspruchsvolle
der physischen, psychischen und sozialen Funk- Tätigkeit in der psychiatrischen Pflege weiter zu
tionen. Das pflegerische Angebot reicht von der qualifizieren.
Unterstützung therapeutischer Maßnahmen wie
Krisenintervention in Gefährdungssituationen, Die Weiterbildung „Psychiatrische Pflege“ ver-
Einzelbetreuung in Krisensituationen, Konflikt- mittelt theoretisches Wissen und praktische Fä-
und Selbstmanagement, Einzel- und Gruppenge- higkeiten zur Weiterentwicklung und den Erwerb
spräche oder Expositions- und Entspannungstrai- neuer Handlungskompetenzen der Fachkräfte in
nings über originär pflegerische Maßnahmen wie allen Arbeitsfeldern der psychiatrischen Pflege.
individueller, alltagspraktischer Unterstützung Besondere Schwerpunkte setzen wir in:
und Begleitung, Training von lebenspraktischen
Fähigkeiten, Selbständigkeit und Belastbarkeit - die Weiterentwicklung der sozialen Kompe
bis hin zu Aktivierung der Patienten in Form von tenzen
Außen- und Innenaktivitäten. - die Entwicklung eigener Denk- und Hand-
lungsweisen und die Fähigkeit, eigene Einstel-
Berufsgruppenübergreifende Kommunikation lungen und Haltungen bewusst und kritisch zu
und Kooperation ist selbstverständliche Grundla- hinterfragen
ge der gemeinsamen Arbeit mit den Patienten. In - die Erkenntnis eigener Möglichkeiten und
regelmäßig stattfindenden multiprofessionellen Grenzen
Teambesprechungen werden Therapiekonzepte - berufsspezifische Denk- und Handlungsweisen
und Maßnahmen entsprechend der individuellen zu verändern bzw. neu zu erlernen
Zielsetzungen der Patienten kommuniziert und
aufeinander abgestimmt. Für den theoretischen Unterricht stehen Dozen-
ten aus den Fachgebieten Pflege, Medizin, Psy-
Im Jahr 2010 wurden Gruppen für Angehörige chologie, Ethik, Recht, Betriebswirtschaft und
von Patienten mit Depression und Patienten mit Management zur Verfügung. Für die geforderten
Schizophrenie etabliert. Mitarbeiter des ärztli- 1800 Stunden berufspraktische Anteile in den
chen und pflegerischen Dienstes führen dieses Bereichen Psychosomatik, Rehabilitation, statio-
211
näre, ambulante und komplementäre psychiatri- 1.7 Sozialdienst
sche Versorgung unterstützen Fachpflegekräfte
und Praxisanleiter mit entsprechenden pädago- Die Mitarbeiter des Sozialdienstes der Klinik für
gischen Zusatzqualifikationen die Ausbildung. Psychiatrie und Psychotherapie arbeiten bera-
tend und bieten konkrete Hilfeleistungen für Pati
Der theoretische Unterricht umfasst 810 Unter- enten mit psychischen Erkrankungen und deren
richtsstunden, gegliedert in vier Grundmodule Angehörigen in sozialen, persönlichen, finanzi-
und fünf Fachmodule, die jeweils mit einer Mo- ellen und sozialrechtlichen Fragen an. Der Sozi-
dulprüfung abschließen. aldienst ergänzt die ärztliche und pflegerische
Versorgung der Patienten im Krankenhaus durch
Grundmodule (GM) individuelle Hilfs- und Beratungsangebote. Es ar-
GM 1: Pflegewissenschaft und Pflege- beiten vier Dipl./BA Sozialarbeiter/-pädagogen in
forschung Teilzeit. Ergänzt wird das Team zusätzlich durch
GM 2: Kommunikation, Anleitung und einen Sozialarbeiter/-pädagogen im Anerken-
Beratung nungsjahr.
GM 3: Gesundheitswissenschaft, Prävention
und Rehabilitation Psychiatrische Erkrankungen stellen viele Pati-
GM 4: Wirtschaftliche und . enten und deren Angehörige vor große Verän-
rechtliche Grundlagen derungen, die sie psychosozial und auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht nachhaltig beinträchtigen.
Fachmodule (FM) Auftrag des Sozialdienstes ist die Beratung von
FM 1: Spezifisches psychiatrisches Pflege-. stationären und ambulanten Patienten in sozia-
wissen len Fragestellungen, die Beantragung von Leis-
FM 2: Aufgaben und Rolle der psychiatrischen tungen im Sozialhilfebereich, bei Krankenkassen,
Pflege im psychosozialen Netzwerk Rentenversicherungsträgern etc. - sowie die Ver-
FM 3: Psychiatrische . mittlung in das nachstationäre Hilfssystem. Dazu
Erkrankungen und psychiatrische zählen stationäre Einrichtungen (z. B. störungs-
Pflegekonzepte spezifische Wohnheime, Pflegeheime) sowie am-
FM 4: Spezifische psychiatrische. bulante Hilfsangebote (Selbsthilfegruppen, Bera-
Pflege in unterschiedlichen tungsstellen, betreutes Wohnen, Pflegedienste,
Handlungsfeldern Tagesstätten etc.). Informationsvermittlung über
FM 5: Reflexionsverfahren in der diese Angebote, gemeinsame Besichtigungen
psychiatrischen Pflege z. B. von Wohnheimen oder Tagesstätten und
Beantragung/Kostenklärung dieser Maßnahmen
Wer alle Modulprüfungen erfolgreich absolviert nehmen einen wichtigen Stellenwert im tägli-
hat, wird zur staatlichen Abschlussprüfung zuge- chen Arbeitslauf des Sozialdienstes ein.
lassen und erhält, nach erfolgreichem Abschluss,
eine staatliche Erlaubnis zum Führen der Weiter- Durch die enge Vernetzung mit den sozialpsy-
bildungsbezeichnung „Fachpflegerin/Fachpfle- chiatrischen Anbietern im Landkreis Marburg-
ger für Psychiatrische Pflege“. Biedenkopf und darüber hinaus existiert ein
Erzieher und Heilerziehungspfleger erhalten ein breitgefächertes Spektrum an Hilfsangeboten.
entsprechendes Zertifikat der Weiterbildungs- Neben den geschilderten Angeboten werden im
stätte. Rahmen sozialtherapeutischer Arbeit Patienten-
Zusätzlich wird interessierten Teilnehmern nach und Angehörigengruppen (z. B. in den Bereichen
erfolgreichem Abschluss der Fachweiterbildung Sucht, Depression und Psychose) angeboten. Die
„Psychiatrische Pflege“ die Möglichkeit angebo- Sozialberatung der Klinik stellt eine entscheiden-
ten, die Zusatzqualifikation „Fachpfleger für psy- de Schnittstelle zwischen stationärer, teilstatio-
chiatrische Pflege und Kinder- und Jugendpsy- närer und ambulanter Behandlung und weiter-
chiatrie“ zu erwerben. Dazu werden noch einmal führenden Hilfsangeboten dar. Um dies optimal
90 Stunden spezifischer theoretischer Unterricht leisten zu können, erfolgt in- und extern eine
und 320 Stunden berufspraktische Anteile ange- enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den
boten. unterschiedlichen Berufsgruppen, die an der Be-
handlung der Patienten beteiligt sind.
22Sie können auch lesen