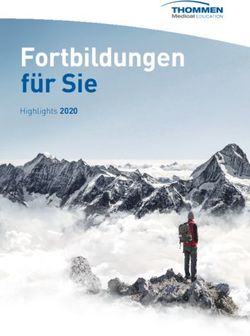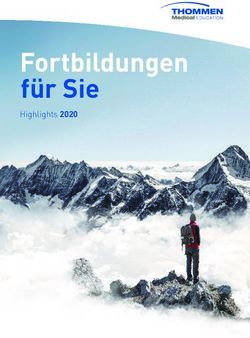Warum es bei der Risikokommunikation nicht nur auf Risiko-Zahlen ankommt! - Vortrag auf der Tagung der Herbsttagung der Deutschen Schutzkommission ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Warum es bei der
Risikokommunikation nicht nur auf
Risiko-Zahlen ankommt!
Vortrag auf der Tagung der Herbsttagung der Deutschen
Schutzkommission
2014
Peter M. Wiedemann
University of Wollongong, Australia
WF EMF BerlinRisiko ist ein Konstrukt Der Risikobegriff Risiko: Erwartung eines Schadens Risiko ist eine Prognose über das Auftreten zukünftiger Ereignisse (in Abhängigkeit von bestimmten Randbedingungen) • Wahrscheinlichkeit als Maß der Möglichkeit • Wahrscheinlichkeit x Schaden
Risikowahrnehmung Campos, J.J., et al. (1978). The emergence of fear on the visual cliff. In Michael Lewis and Leonard A. Rosenblum (Eds.). The development of affect. New York: Plenum.
Risikowahrnehmung?
Bezogen auf Produkte und Technologien sind wir
nicht in der Lage, Risiken wahrzunehmen!
Vorsicht: Gentechnik!
taz, 15.9.2014Risikowahrnehmung • Risikowahrnehmungen sind intuitive Urteile. • Sie können, müssen aber nicht auf „Wahrnehmung“ beruhen. • In vielen Fällen sind wir auf Risiko-Informationen aus der Wissenschaft und den Medien angewiesen.
Für das gleiche Risiko gibt es unterschiedliche
Risikozahlen.
„Jede zehnte Frau in Deutschland ist im Laufe
ihres Lebens von Brustkrebs betroffen.“
① Etwa 3 von 1000 Frauen, die 60 Jahre alt
sind, bekommen im nächsten Lebensjahr
Brustkrebs.
② Jedes 8. weibliche Neugeborene bekommt
im Laufe seines Lebens Brustkrebs.
③ 4 von 100 Frauen, die älter sind als 24
Jahre, bekommen bis zur Erreichung ihres
60. Lebensjahres Brustkrebs.Kr
Risiko an Brustkrebs
zu erkranken:
1 von 10 Frauen
1 von 8 Frauen
= Kumulative Risiko-
angabe
Nicht sinnvoll!
Für 50jährige Frau
Risiko im nächsten
Jahr an Brustkrebs
zu erkranken:
0,223%
2 von 1000 Frauen
Kürzl R: Evidenzbasierte Missverständnisse beim Mammakarzinom - Erkrankungsrisiko und
Mortalitätsreduktion. Dtsch Ärzteblatt (2004) 101: A 2387-2390Risikovergleiche, ein Versuch Risiken zu
vermittelnRisikovergleiche
• Risikovergleiche
– Ein unbekanntes Risiko wird mit einem bekannten Risiko
verglichen.
• Risikovergleiche dienen der Verständnissicherung sowie als
Bewertungshilfe.Risikovergleiche • Stimmen die Zahlen? • Kann man die Risiken vergleichen? • Hilft der Vergleich Laien? Dosis gleiches Risiko ( 5: 100 000) 1 mSv 200 km Motorradfahren 1 mSv 3750 km Autofahren 1 mSv 18000 km Fliegen 1 mSv 75 Zigaretten Rauchen 1 mSv 75 min Klettern 1 mSv 1-2 Jahre in einer Fabrik arbeiten 1 mSv 17 Stunden als 60-Jähriger zu leben Tabe Tabelle 1: Risiken im Vergleich zu einer Strahlendosis von 1 mSv. Quelle: Med. Universität Wien http://www.meduniwien.ac.at/nuklear/information/medizinischespersonal/strahlenrisikofuerdenpatienten.html
Befunde • Risikovergleiche werden akzeptiert. Sie haben einen positiven Einfluss auf das Risikoverständnis. • Vergleiche beeinflussen die Risikowahrnehmung nur wenig. • Vergleiche haben keine beruhigende Wirkungen. • Vergleiche beeinflussen kaum die Risikoakzeptanz.
Alle Vergleiche hinken. Handy-Telefonieren ist „möglicherweise krebserregend“ Selbst dann, wenn sich Risiken vergleichen lassen, sind sie sich nicht ähnlich! Schon gar nicht psychologisch!
Manchmal kommt es darauf an, wie gut man
etwas lesen kann.
Was ist riskanter: Aspirin oder Acetylsalicylsäure?
Die intuitive Risikobewertung kann durch
Lesbarkeit der Information beeinflusst werden.
H. Song & N. Schwarz (2006): If It’s Difficult to Pronounce, It Must Be
Risky. Psychological SciencesWas folgt daraus für die Risikokommunikation? • Risikovergleiche helfen zwar im Prinzip, nutzen aber nicht wirklich. • Es geht nicht nur um das Verständnis von Zahlen und Größenordnungen. • Offenbar spielen auch andere Kriterien eine Rolle.
Es geht nicht nur um Risikozahlen!
Risiko-Stories
Risikoinformationen kommen in Risiko-Stories
Risiko-Story
Wer hat welches Risiko
warum
für wen
in die Welt gebracht?
Und: Jede Geschichte hat eine
Moral.Story A Am 12.6.01 trat in der Fabrik der Xeno Gmbh in Weinrich aufgrund eines Unfalls Gase aus. Diese Gase beinhalteten den Stoff Fonotan. Es gibt einzelne Hinweise darauf, dass der Stoff möglicherweise krebserregend ist. Wissen- schaftlich gibt es dafür aber noch keinen schlüssigen Beweis. Nach dem Unfall gab es erhebliche Unruhe bei den Anwohnern, obwohl keine akuten Gesundheitsstörungen auftraten. Die Firma Xeno GmbH, eine kleines Familienunternehmen, das seit drei Gene- Rationen in Weinrich ansässig ist, hat nach dem Unfall sofort eine Pressekon- ferenz einberufen und sich bei allen Anwohnern entschuldigt, obwohl der Unfall durch eine Fremdfirma verursacht wurde. Die Firma hat weiterhin allen Anwohnern Unterstützung bei der medizinischen Vorsorgeuntersuchungen zugesichert.
Story B Am 12.6.01 trat in der Fabrik der Xeno Gmbh in Weinrich aufgrund eines Unfalls Gase aus. Diese Gase beinhalteten den Stoff Fonotan. Es gibt einzelne Hinweise darauf, dass der Stoff möglicherweise krebserregend ist. Wissen- schaftlich gibt es dafür aber noch keinen schlüssigen Beweis. Nach dem Unfall gab es erhebliche Unruhe bei den Anwohnern, obwohl keine akuten Gesundheitsstörungen auftraten. Die Firma Xeno GmbH gehört dem weltweit operierenden Konzern Axas, der alle Presseanfragen bislang mit Schweigen beantwortet hat. Die Geschäfts- leitung verweist darauf, dass sie nicht bereit ist, dazu eine Stellung zu beziehen, bis alle Ursachen geklärt sind. Allerdings gibt es offenbar Hinweise darauf, das der Unfall Folge der Einsparpolitik des Unternehmens ist. Die Firma lehnt bislang alle Forderungen der Anwohner auf Unterstützung ab.
Es kommt auf die Risiko-Story an! • Je nach Story werden verschiedene Emotionen induziert.
Was passiert, wenn unterschiedliche
Risikogeschichten erzählt werden
7.0
Empörung
Nachsicht
6.0
Risikowahrnehmung
5.0
4.0
N= 230 229 188 188 162 164
Pflanzenschutzmittel Störfall Handy
Wiedemann, Clauberg & Schuetz (2003)Der Kern der Risiko-Story:
Es kommt darauf an, ob ein Risiko moralisch
akzeptabel ist!
• Verstöße gegen Schutz und Fürsorge
– Man darf (ohne triftigen Grund) kein
Menschenleben riskieren!
• Verstöße gegen Fairness
– Man darf Risiken nicht einseitig Anderen
aufbürden!
• Verstöße gegen Loyalität
– Man darf Risiken nicht verschweigen oder
kleiner reden als sie sind.Was folgt daraus für die Risikokommunikation?
Die Risiko-Zahlen sollten stimmen.
Aber das ist nicht alles.
Es kommt darauf an,
– den Nutzen zu thematisieren,
– sich mit den wahrgenommen
Moralverstößen auseinanderzusetzen.
– und die richtige Risiko-Story zu
erzählen!Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Sie können auch lesen