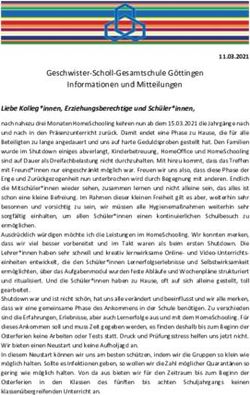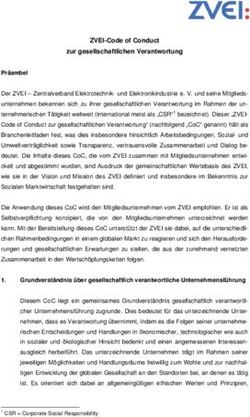Weiterbildungskonzept zum ORL-Facharzt Kantonsspital Olten
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kantonsspital Olten
Baslerstrasse 150
4600 Olten
Kantonsspital Olten | CH-4600 Olten
T 062 311 43 85
www.solothurnerspitaeler.ch
HNO-Klinik
Chefärztin
Dr. med. Silke Hasenclever
hno.kso@spital.so.ch
Weiterbildungskonzept zum ORL-Facharzt Kantonsspital Olten
Einleitung
An der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten des Kantonsspitals Olten (Solothurner
Spitäler AG) werden Kandidatinnen/Kandidaten für den Facharzttitel
Otorhinolaryngologie (ORL) weitergebildet. Zudem besteht die Möglichkeit,
Kandidatinnen/Kandidaten für den Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin
weiterzubilden, jeweils mit dem Ziel, das notwendige Wissen und Können im
Fachgebiet ORL zu vermitteln, angepasst an die Bedürfnisse des weiteren
Werdeganges.
Das Weiterbildungskonzept orientiert sich an der Weiterbildungsordnung des SIWF
vom 01.01.2011 (Revision: 05.07.2017).
1. Angaben zur Weiterbildungsstätte
1.1 Solothurner Spitäler AG, Kantonsspital Olten, HNO-Klinik, Baslerstrasse 150, 4600
Olten
1.2. Die Weiterbildungsstätte ist als Weiterbildungsstätte der Kategorie C von der FMH
anerkannt.
1.3. Das Kantonsspital Olten ist ein Spital der erweiterten Grundversorgung und einer
der Hauptstandorte der Solothurner Spitäler AG.
1.4. Im Fachgebiet Otorhinolaryngologie werden pro Jahr ca. 450 bis 500 stationäre
Patienten betreut. Die ambulanten Konsultationen betragen jährlich zwischen
7'000 bis 8'000. Im grossen Ambulatorium wird ein breites Spektrum an HNO-
Diagnostik angeboten. Es bestehen Spezialsprechstunden für Schwindel
(Otoneurologie), Stimme, Schlucken, Allergologie, Onkologie, sowie Schnarchen,
teilweise im Rahmen von interdisziplinären Kooperationen. Das operative
Spektrum erstreckt sich auf die gesamte Kopf-/Halschirurgie (mit Ausnahme von
Cochlear Implants, der Fronto- und Laterobasischirurgie und der ausgedehnten
Tumorchirurgie): Mittelohrchirurgie, Nasen- und Nasennebenhöhlenchirurgie,
endoskopische Eingriffe, Halschirurgie incl. Schilddrüse, Tumorchirurgie
endoskopisch und mit externen Zugängen, Traumatologie, plastische und
rekonstruktive Kopf-/Halschirurgie.1.5. Die HNO-Klinik des Kantonsspitals Olten ist dem Weiterbildungsnetzwerk
Otorhinolaryngologie Basel-Aarau-Liestal-Olten (ORL BAL) angeschlossen.
Hiermit wird garantiert, dass ein Anwärter für die Weiterbildung in
Otorhinolaryngologie innert nützlicher Zeit das gesamte Curriculum, verteilt auf
verschiedene Standorte, absolvieren kann. Zudem finden gemeinsame
Weiterbildungsveranstaltungen statt und die Kandidatenauswahl für zukünftige
Assistenzärzte innerhalb des Netzwerkes wird ebenfalls durch die
Weiterbildungsverantwortlichen der vier Kliniken gemeinsam getätigt.
Die verantwortliche Ansprechperson für das Weiterbildungsnetzwerk ist Prof. Dr.
Daniel Bodmer, Universitätsspital Basel.
1.6. Im Fachgebiet Otorhinolaryngologie existiert eine Stelle für Assistenzärzte
(Arbeitspensum 100 %), für die Weiterbildung als Allgemeinmediziner existiert eine
Stelle zu 100 %.
2. Ärzteteam
2.1. Leiter der WBS (für die Weiterbildung verantwortlicher Arzt)
- Hasenclever Silke, Dr. med., silke.hasenclever@spital.so.ch, 100 %.
2.2 Stellvertreter des Leiters
- Wales Philipp, Dr. med. univ., philipp.wales@spital.sol.ch, 80 %.
2.3 Andere an der Weiterbildung beteiligte Kaderärzte
- Roushan Kourosh, Dr. med., kourosh.roushan@spital.so.ch, 90 %.
- Listyo Alwin, Dr. med., alwin.listyo@spital.so.ch, 80 %.
- Rothschild Uta, uta.rothschild@spital.so.ch, 80 %.
2.4. Somit beträgt das Verhältnis Weiterzubildende zu Lehrärzten 200 % zu 430 %.
3. Einführung beim Stellenantritt
3.1 Persönliche Begleitung
In der Einführungsphase wird ein Oberarzt als Tutor des neu eintretenden
Assistenzarztes bestimmt.
3.2 Notfalldienst/Bereitschaftsdienst
Die zeitliche Belastung mit Notfalldienst oder Bereitschaftsdienst beträgt pro Monat
bei einem 100 %-Pensum ca. acht bis neun Tage, davon ein Wochenendblock
(Freitag, Samstag, Sonntag). Die neuen Assistenzärzte werden formell eingeführt,
und es existiert immer ein erfahrener Kollege im Hintergrund, der innert maximal
30 Minuten am Patientenbett zur Unterstützung des Assistenzarztes anwesend
sein kann.
3.3 Administration, Qualitätssicherung
Die Einführung der neuen Assistenzärzte in administrative Belange (z.B. KISIM)
sowie Belange der Qualitätssicherungsmassnahmen und Patientensicherheit (z.B.
CIRS) erfolgt im Rahmen der zweitägigen Einführung für alle neu eintretendenÄrzte der soH. Zudem werden die neuen Assistenzärzte Klinik-intern durch die
Leitungen des Sekretariats sowie der Pflege eingewiesen.
3.4 Klinikspezifische Richtlinien
Beim Eintrittsgespräch mit dem Weiterbildungsleiter wird dem neuen Assistenzarzt
eine Checkliste ausgehändigt und erläutert. Diese benennt den zuständigen Tutor,
sowie für verschiedenste Belange die nötigen Ansprechpersonen, die innert der
ersten zwei bis maximal vier Wochen den neuen Assistenzarzt einführen. Die
klinikspezifischen Richtlinien sind in übersichtlichen Dokumenten im Prozessportal
hinterlegt. Der Assistenzarzt wird in die Informatikmittel und in die virtuelle
Bibliothek eingewiesen, in der zahlreiche Bücher, Zeitschriften und sonstige online-
Informationsmittel verfügbar sind.
4. Weiterbildungsinhalt (gemäss Ziffer 3 des Weiterbildungsprogramms)
4.1 Die Weiterbildung der Assistenten soll gemäss ihrer zukünftig gewählten
Fachrichtung und dem Weiterbildungsstand bei Eintritt ins Kantonsspital
differenziert gehandhabt werden. Allerdings ist die HNO-Klinik so knapp besetzt,
dass alle ärztlichen Mitarbeiter sich, wenn nötig, gegenseitig vertreten können
müssen und daher ein fixes Curriculum für jede einzelne Weiterbildungsstufe nicht
ausformuliert werden kann.
Nicht HNO-Assistentinnen/Assistenten streben in der Regel den Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin an. Der Schwerpunkt der Weiterbildung liegt daher im
Ambulatorium, sie kommen aber auch auf Station und als Assistenz im
Operationssaal zum Einsatz. Ziel ist das Erlernen sämtlicher an der Klinik üblichen
Untersuchungstechniken und konservativen Behandlungsmethoden.
Assistenzärzte in Weiterbildung für ORL befinden sich meist am Anfang ihrer
Weiterbildung zum Facharzt ORL. Einsatz gleichermassen im Ambulatorium und
im Operationssaal sowie auf der Station. Das Ziel ist das Erlernen sämtlicher an
der Klinik üblichen Untersuchungstechniken und konservativen
Behandlungsmethoden, sowie das Erlernen der kleinen und mittleren Operationen
des Fachgebiets unter Anleitung eines Ober- oder Kaderarztes. In der Regel
erfolgt ein Wechsel an eine Weiterbildungsstätte höherer Kategorie innerhalb des
Netzwerkes ORL BAL nach Ablauf von ein bis zwei Jahren.
Die Assistenz bei operativen Eingriffen wie auch das Studium weiterführender
Literatur sind für alle Assistenten integrierende Bestandteile der Weiterbildung,
ebenfalls die Mitwirkung an der Planung und Durchführung der
Fortbildungsveranstaltungen der HNO-Klinik (HNO-intern wöchentlich Journal Club
und Fallbesprechungen im Dienstagsrapport, jährlich MoMo-Konferenz, ORL-BAL-
Weiterbildungsanlass in Olten). Es wird den Assistenten ermöglicht, möglichst
viele der anderen ORL-BAL-Veranstaltungen, die an den Kliniken Basel, Aarau
und Liestal über das Jahr stattfinden, zu besuchen. Auch allfällige weitere
Veranstaltungen werden unterstützt (z.B. Jahreskongresse und Sommerschule der
Fachgesellschaft).
Zudem erlernen die Assistenten die Prinzipien und Anwendungen des
Qualitätsmanagement-Systems der HNO-Klinik. Eine aktive Mitarbeit im Rahmender internen organisatorischen Besprechungen und konstruktive
Verbesserungsvorschläge sind sehr erwünscht. Die Weiterbildung wird durch die
Chefärztin bzw. ihren Vertreter oder den designierten Tutor überwacht. Festlegung
und Überprüfung der jeweiligen Weiterbildungsziele mindestens einmal jährlich im
Mitarbeiter-Beurteilungsgespräch.
4.2 Prüfen der Weiterbildungsziele
Es existiert eine Checkliste zur Orientierung, welche Tätigkeiten bei welchem
Weiterbildungsstand gelernt sein sollen bzw. erwartet werden können. Diese
Checkliste wird beim Eintrittsgespräch mit der Chefärztin besprochen, ggf. können
gemäss den Wünschen des Assistenten Ergänzungen vorgenommen bzw.
Schwerpunkte gesetzt werden. Wegen der kleinen Grösse des Teams ist jedoch
kein Anspruch auf punktgenau fristgerechtes Erreichen dieser Ziele gegeben. Die
Assistenzärzte/Assistenzärztinnen sollten selbständig überprüfen, welche
Fertigkeiten noch erlernt werden sollten, und die Weiterbilder auf entsprechende
Lücken oder spezielle Interessensgebiete hinweisen. Die
Assistenzärzte/Assistenzärztinnen führen über die erreichten Ziele selbständig
Buch. Die Chefärztin bzw. der designierte Tutor testiert die Kataloge im
Assistenten-Logbuch jeweils anlässlich der Mitarbeiter-Beurteilungsgespräche.
4.3 Strukturierte theoretische Weiterbildung intern:
- 3 Stunden pro Woche:
- Röntgen-Rapport
- Tumorboard
- Journal Club
4.4 Strukturierte Weiterbildung extern
Diese werden begrüsst und gefördert. Eine Beteiligung an Kurskosten kann zu
Händen der Chefärztin aus dem HNO-internen Pool beantragt werden. Zusätzliche
freie Tage zu Weiterbildungszwecken sind ebenfalls nach Absprache möglich.
4.5 Bibliothek
Die soH-interne virtuelle Bibliothek steht allen Assistenzärzten zur Verfügung. Hier
finden sich Zeitschriften (Fulltext-Online) im Fach Otorhinolaryngologie, andere
Fachzeitschriften, sowie Online Datenbanken (z.B. UpToDate und Dynamed). Eine
Fernleihe für lokal nicht verfügbare Artikel/Bücher ist ebenfalls möglich.
Zudem besteht in der HNO-Klinik eine kleine Bibliothek mit HNO-Fachbüchern.
5. Evaluationen
5.1 Arbeitsplatz-basierte Assessments AbA's: Mini-CEX / DOPS
Die Arbeitsplatz-basierten Assessments erfolgen gemäss Vorschriften des SIWF,
viermal jährlich. Dabei ist der Assistenzarzt/Assistenzärztin dafür verantwortlich,
zusammen mit seinem Tutor entsprechende Gelegenheiten wahrzunehmen.
5.2 Eintrittsgespräch / Verlaufsgespräch
Das Eintrittsgespräch erfolgt innerhalb von einer Woche nach dem ersten
Arbeitstag mit der Chefärztin. Nach Ablauf von knapp drei Monaten erfolgt das
erste Verlaufsgespräch. Anschliessend folgen die jährlichen Evaluationen gemäss
Logbuch, wobei in der Regel die jährliche Evaluation bei einem einjährigen
Assistenzarzt-Weiterbildungsvertrag mit dem Austrittsgespräch übereinstimmt.6. Bewerbung
6.1 Die Assistenzärzte/Assistenzärztinnen in Weiterbildung für Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde werden im Rahmen des Weiterbildungsnetzwerkes ORL-BAL durch die
Gruppe der Weiterbildungsleiter ausgewählt.
6.2 Bewerbungen sind daher zu richten an das Netzwerk ORL-BAL, zu Händen Prof.
Dr. Daniel Bodmer, Hals-, Nasen-, Ohrenklinik Universitätsspital Basel.
6.3 Notwendige Unterlagen für die Bewerbung:
- Begleitbrief mit Begründung des Berufszieles
- Curriculum vitae mit tabellarischer Aufstellung der bisherigen Weiterbildung
- Liste der fest geplanten und der beabsichtigten Weiterbildung
- Zeugnisse (Staatsexamen, SIWF-Zeugnisse der bisherigen Weiterbildung)
- Liste absolvierter zusätzlicher Weiterbildung (z.B. Sonographiekurs)
- Operations-/Interventionskatalog etc.
- Liste der Publikationen, sofern vorhanden
- Angabe von Referenzen
6.4 In Basel wird zweimal im Jahr eine Bewerbungsrunde durchgeführt, bei der dann
auch geplant wird, welche Kandidaten an der Hals-Nasen-Ohren-Klinik
Kantonsspital Olten eine Stelle angeboten bekommen. Anschliessend wird der
Kandidat noch einmal für eine persönliche Besprechung und zum Kennenlernen
der Klinik nach Olten eingeladen, bevor der definitive Vertrag ausgestellt wird.
6.5 Die Kandidaten für Allgemeinmedizin werden im Sinne eines Rotationsverfahrens
aus den Assistenzärzten der Medizinischen Klinik des Kantonsspitals Olten
rekrutiert und wechseln in der Regel im halbjährlichen Abstand. Hier erfolgt die
Anstellung primär über die Medizinische Klinik, es wird jedoch jeder Kandidat in
einem persönlichen Gespräch noch einmal bezüglich der Option eines
Fremdhalbjahres auf der HNO-Klinik durch die Chefärztin informiert.
Olten, 20.06.2021Sie können auch lesen