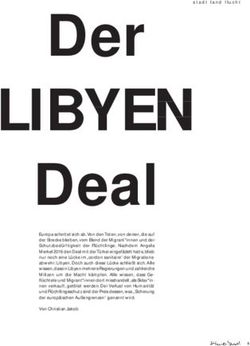Zeitenwende in der Lyrik Paul Celans - Klaus Manger
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
362 77-82 Manger 21.12.1999 14:30 Uhr Seite 77
Die
politische
Nr. 362/Januar 2000 Meinung
„Von Schwelle zu Schwelle“
Zeitenwende in der Lyrik
Paul Celans
Klaus Manger
Paul Celans Gedichte begleiten uns schon traut, dann bleiben das „Brandmal“, das
ein halbes Jahrhundert und sind doch weit- „Grab in den Lüften“, der Tod als „ein Mei-
gehend fremd geblieben. Manchen An- ster aus Deutschland“, der „herz- / förmige
strengungen zum Trotz haben sie ihre Wi- Krater“ noch in Erinnerung, selbst wenn der
derständigkeit bewahrt und befremden letzte Bombentrichter beseitigt sein sollte.
noch immer, sind also im Sinne von Harald Die „Verbrannte[n]“, „Alle die mit- / ver-
Weinrich imagines agentes par excellence. brannten / Namen“, „die Leiber / zu Schwel-
Ihre ebenso herausfordernde wie leise an- len getürmt“, „Die Tode und alles / aus ih-
klopfende Poetik ist wenig erkannt, ge- nen Geborene“; „unsterblich von soviel / auf
schweige verstanden worden. Dabei frap- Morgenwegen gestorbenen Toden“ verhin-
piert dieser Dichter mit seiner Aufforde- dern, auf dieses Jahrhundert zurückzubli-
rung: „Machs Wort aus.“ Ob dieser impera- cken, als sei nichts gewesen.
tivischen Zumutung möchte es einem bei- „Beim Tode! Lebendig!“ Die unerhörte Her-
nahe die Sprache verschlagen. Doch be- ausforderung der menschenfeindlichen,
merkt man dann vielleicht, dass es nur an menschenvernichtenden Maschinerie des
einem selbst liegt, sie wiederzuerlangen Todes hat Celans Gedichte stigmatisiert, hat
und das Wort von neuem auszumachen. dem Dichter seine neue Poetik abgezwun-
Zu einer solchen Neubestimmung des Wor- gen.
tes und der Sprache fordern Celans Ge-
dichte auf, seit die großen Verheerungen
„Das Gedicht spricht“
und Verwerfungen dieses zu Ende gehen-
den zwanzigsten Jahrhunderts über die Bei Martin Buber heißt es: „Das Gedicht
Menschen hereingebrochen sind. Zu keiner spricht.“ Celan betont das, wenn er dies in
früheren Zeit sind sie von so systematischer seiner Büchnerpreisrede von 1960, ver-
Vernichtung heimgesucht worden wie in öffentlicht als „Der Meridian“, aufnimmt
diesem Jahrhundert. Wenn da ein Dichter und sagt: „Aber das Gedicht spricht ja!“ Er
Zuflucht in der Sprache, der Sprache des Ge- fügt jedoch hinzu: „Es bleibt seiner Daten
dichts, sucht, ihr den Schmerz angesichts eingedenk, aber – es spricht. Gewiss, es
der Ungeheuerlichkeiten der Geschichte spricht immer nur in seiner eigenen, aller-
und des Ausmaßes der Vernichtung anver- eigensten Sache.“ Ja, „aber – es spricht“.
77362 77-82 Manger 21.12.1999 14:30 Uhr Seite 78
Die
politische
Meinung Klaus Manger
Diese bedeutende Aussage müssen wir uns schürzt“ aus dem Band Von Schwelle zu
verdeutlichten, da soviel von Verstummen Schwelle (1955) heißt: „Ein Wort – du weißt:
die Rede ist und Celan selbst sagt, das Ge- / eine Leiche“, so ist das wohl die schroffste
dicht neige zum Verstummen. Entgegnung auf die Theodizee, da sie dem
Er weiß, dass die Besinnung auf Ge- fleischgewordenen Wort, dem Lógos, den
schichte, insbesondere die Geschichte des Ausblick auf Erlösung und Auferstehung ab-
zwanzigsten Jahrhunderts, einem „den spricht. Aus dieser anthropozentrischen
Atem und das Wort“ verschlagen kann. Er Sicht lassen sich weder auf Golgatha noch
sagt: „Dichtung: Das kann eine Atemwende auf Stalingrad noch auf die Lager am Bug
bedeuten.“ Das aber heißt, das Gedicht oder Buchenwald noch auf Hiroshima ir-
kann die Gestalt einer solchen Atemwende gendwelche Hoffnungen bauen. Über den
annehmen, und so lautet der Titel des Ban- Brandstätten der Verheerungen öffnen sich
des von 1967 Atemwende. Es ist also nicht keine Himmel. Vielmehr werden diese
so, dass hier die Sprache zerschlagen, in die Brandstätten dem Dichter selbst zu Patmos,
Zerstörungen nachahmender Weise ir- aus denen er seine unheimlichen Offenba-
gendetwas kaputt gemacht wird. Es sind rungen gewinnt.
nicht Celans Gedichte, die „mit mimeti- Celans Gedichte haben es auf sich genom-
scher Panzerfaustklaue“, wie es im voraus- men, jedes für sich, Kunde „Von Dunkel zu
liegenden Band Die Niemandsrose (1963) Dunkel“ zu geben. Wie das Gedicht „Mit
heißt, es sind vielmehr diejenigen selbst, wechselndem Schlüssel“ durch die Ge-
die den „Schwarzhagel“ säten, die ihn jetzt schichte hindurch bis zu den „wechselnden
wegschreiben mit dieser fürchterlichen Schlüsseln“ bei Parmenides zurückgreift,
Klaue. Wenn Dichtung eine Atemwende um zu veranschaulichen, dass „das Haus,
bedeuten kann, dann ist ihr aufgegeben, zu darin der Schnee des Verschwiegenen
zeigen und dadurch zu erinnern, wie es ei- treibt“, nur um den Preis drohenden Le-
nem den Atem und das Wort verschlägt, bensverlustes zu öffnen ist und damit das
aber eben nicht zu verstummen. Denn es Lichtreich der Wahrheit, wohin das antike
spricht ja. „Wahr spricht, wer Schatten Lehrgedicht des Parmenides vordringt, ver-
spricht.“ schlossen bleibt. Weder theologische noch
philosophische Refugien tun sich da auf:
„ich höre, sie nennen das Leben / die ein-
Der Schatten eingedenk
zige Zuflucht.“, heißt es im Band „Schnee-
Unter den finsteren Himmeln dieses Jahr- part“ (1971).
hunderts bleiben uns keine Ausflüchte, Denken und Sein, so lässt sich am Ende die-
keine Hilfskonstruktionen, keine sie ka- ses Jahrhunderts bilanzieren, sind nicht das-
schierenden Glaubensakte. Auch wenn selbe. Das einzelne Gedicht kann eine
diese Himmel sich erfreulicherweise vor Atemwende bedeuten. Wir können sie von
zehn Jahren aufgehellt haben: das Gesche- Gedicht zu Gedicht, von Schwelle zu
hene ist nicht ungeschehen zu machen. Das Schwelle, auf der sie sich ereignet, verfol-
wahre Wort des Dichters ist und bleibt der gen. Und das Gedicht, das, durch die Ge-
Schatten eingedenk, liegen sie über Golga- schichte hindurchgreifend, seiner Daten
tha, über dem Bug, über der Spree oder der eingedenk bleibt, läßt seinen Leser schwer-
Seine. Wenn es im Gedicht „Nächtlich ge- lich unbeteiligt. Sein imperativischer Gestus
78362 77-82 Manger 21.12.1999 14:30 Uhr Seite 79
Die
politische
Zeitenwende in der Lyrik Paul Celans Meinung
ist offensichtlich von der Hoffnung ge- mete Nein“. Nicht die Seele, sondern ein
tragen, auf einen Menschen zu treffen, der Seelenfortsatz ist hier ausgehaucht, etwas
sich von ihm ansprechen lässt. Ein Beispiel Unnützes, allerdings als Fortsatz und An-
aus Sprachgitter (1959) möge das verdeut- hängsel noch auf Satz, Sprache, Atem Ver-
lichen: weisendes. Dieser minimalisierte Rest er-
SCHUTTKAHN reicht das hellgeatmete Nein. In dieser
Wasserstunde, der Schuttkahn Form, verkürzt, reduziert, nimmt der Seelen-
fährt uns zu Abend, wir haben, fortsatz die Richtung eines massiven Wider-
wie er, keine Eile, ein totes spruchs, nämlich den des hellgeatmeten,
Warum steht am Heck. vom Körper gelösten und als letztes Wort
Geleichtert. Die Lunge, die Qualle diesem Gedicht überantworteten Neins.
bläht sich zur Glocke, ein brauner Dieses Gegenwort erhebt leise dröhnenden
Seelenfortsatz erreicht Protest, in den Diminutiv vergrößerten Wi-
das hellgeatmete Nein. derstand.
Es ist „Wasserstunde“. Keines der anderen Die erste Fassung des Gedichts hatte noch
Elemente bietet Zuflucht, wo doch Leben nicht die gepunktete Linie, die dann im Ge-
einzige Zuflucht ist. Menschen haben so nur dichtband Sprachgitter die beiden Strophen
ihr Leben und das, was sie daraus machen. trennt und mit der zeitlichen Distanz der
Der Schuttkahn fährt ohne Eile, ziellos, Strophen zugleich so etwas wie eine Was-
grundlos „uns zu Abend“. Die Wasserstunde serlinie zwischen dem Schuttkahn in der
ist wie bei Rimbaud Spätzeit, da in seinem ersten und dem Seelenfortsatz in der zwei-
von Celan übertragenen „Bateau îvre“ alles ten Strophe markiert. Sie ist zugleich die Mit-
versinkt, oder wie bei Trakl, „wo hinüber- tellinie des ganzen Bandes.
starben Liebende“, die eines Totenschiffs. Da mit dem toten Warum jede Fragemög-
Trakls Gedicht heißt „Abendland“. Es legt lichkeit erstorben ist, bleibt allein der
nahe, in dem „zu Abend“ fahrenden Schutt- braune Seelenfortsatz als Indiz. Er verweist
kahn über das Spätzeitliche hinaus eine auf die Herkunft des Schreckensgesche-
Spätkultur, ja einen Reflex auch auf Unkul- hens, gegen das sich – „Beim Tode! Leben-
tur zu erkennen. Jede Frage, selbst die Ur- dig!“ – das im Tod hellgeatmete Nein wehrt.
sprungs- beziehungsweise Grundfrage, ist Das Gedicht erschien zuerst am 30. Januar
erstorben: „Ein totes / Warum steht am 1958 in der Zeit, als die Leitartikel der da-
Heck“ dieses manövrierunfähigen Gefährts. mals 25 Jahre zurückliegenden „Macht-
Die zweite Strophe beginnt: „Geleichtert.“ ergreifung“ von 1933 gedachten.
Zwischen den Strophen liegt ein zeitlicher
Einschnitt. Jetzt ist Ballast unter Wasser. Ein
„einsam und unterwegs“
Rest von materialisiertem Leben, Teil jenes
Schutts, „Die Lunge“, jetzt einer Qualle Diese Gedichte sind tatsächlich ihrer Daten
gleich, bläht sich zur Glocke. Als das für eingedenk. Sie sind „einsam und unter-
Atem – und aus diesem Atem hervor- wegs“ und stehen, wie Celan gleichfalls im
gehende Wort – zuständige Organ geht die Meridian sagt, „im Geheimnis der Begeg-
Lunge in dieser Wasserstunde unter. Ein nung“, weil sie auf ein Gegenüber zuhalten
den Tentakeln der Quallen ähnlicher „brau- und das Gespräch suchen. Der das Nein und
ner / Seelenfortsatz erreicht / das hellgeat- damit den Widerspruch erreichende See-
79362 77-82 Manger 21.12.1999 14:30 Uhr Seite 80
Die
politische
Meinung Klaus Manger
lenfortsatz zeugt von menschlicher Gegen- Psalmen und die Apokalypse bis in die Ge-
wart. Da wird, wie das Celan für Büchner genwart geführt. Die Kulturgeschichte
in Anspruch genommen hat, keiner Mo- reicht von der Wurzel Jesse über Pallas
narchie oder totalitären Macht, auch kei- Athene, von Eden, Babel, Ghetto zu Kolum-
nem zu konservierenden Gestern gehuldigt. bus, der Warschowjanka, in die rue de
„Gehuldigt wird hier der für die Gegenwart Longchamp, rue Tournefort zum Platz La
des Menschlichen zeugenden Majestät des Contrescarpe in Paris. Von Jerusalem, Rom,
Absurden.“ Odessa, Lyon, Hamburg, Krakau, Berlin,
Bevor auf das „Geheimnis der Begegnung“ Prag, auch von Czernowitz über Bukarest,
zurückzukommen ist, das Celan im „Meri- Wien nach Paris, also auf Celans Lebens-
dian“ emphatisch betont und das das Herz- weg und in seinen Gedichten, sind die Orte
stück seiner Poetik bildet, sei knapp ver- der mythischen und historischen Welt ge-
gegenwärtigt, was das schon erwähnte Hin- genwärtig. Die technische Moderne hat von
durchgreifen durch die Geschichte bedeu- der „ins Pflaster gewummerten Ilias“ über
tet. Für eine Verständigung darüber wäre „Elektronenidioten“, „Bugradgesang mit
auf die zahlreichen Namensnennungen Corona“ bis hin zu „Fertigungshalle“ oder
hinzuweisen, die sich in den Gedichtbän- „Gebetssilos“ Eingang in seine Gedichte ge-
den vom verworfenen Der Sand aus den Ur- funden.
nen (1948) bis zum postum erschienenen
Zeitgehöft (1976) finden. Explizit und impli-
Das ansprechbare Du
zit sagen sie von Odysseus und Parmenides
über Petrarca, Hölderlins Tübingen, Heine In der „Großsekunde Gedächtnis“ dieser
bis hin zu Ossip Mandelstamm, Rilke, Paul Gedichte ist alles vorhanden. Ihrer „Au-
Eluard, Edgar Jené, Heideggers Todtnau- genschlitz-Krypta“ entgeht nichts: „dich be-
berg, Nelly Sachs, Brecht oder René Char, redet / die Welt ohne Zunge“. Mit einer win-
von den mannigfaltigen Übersetzungen gar zigen Manipulation wird das nicht bloß in
nicht zu reden, jedoch nur, dass ihre im- Korrespondenz gesetzt, sondern zu einer
mense Welthaltigkeit den Gedanken an ir- „Cor-respondenz“ erhoben (zu cor, das
gendwelchen Hermetismus gar nicht erst Herz). So wird es zu einer Herzensantwort.
aufkommen lässt. Im Gegenteil zeugen die Sie lenkt auf jenes „Geheimnis der Begeg-
Gedichte von einer Sprachbewusstheit, die nung“ zurück, mit dem die Gedichte hoffen,
sich selbstverständlich des Sprachschatzes auf ein ansprechbares Du zu stoßen. Celan
und seiner Geschichte erinnert, auch wenn bedient sich, das zu verdeutlichen, auch
sich uns die zahlreichen Termini nicht im- des Bildes der „Flaschenpost“. Als Flaschen-
mer auf Anhieb erschließen: „in der Flüs- post setzt er sein Gedicht ab, dass es an
tertüte buddelt Geschichte“. Die bud- Land, „an Herzland vielleicht“, gespült
delnde Geschichte betreibt ihre eigene Ar- werde.
chäologie und Sinnsuche – wieso aber in Schon Mandelstamm sagt: „Der Brief, den
der Flüstertüte? In ihren Verlautbarungen die Flasche in sich barg, war an den adres-
scheint menschliches Leben verschüttet, siert, der sie findet.“ Der Adressatenkreis der
aus dem sich bestenfalls Hinweise auf Le- als Flaschenpost ausgesetzten Gedichte ist
ben zu Tage fördern lassen. Die Literatur- offen. Wer sie aber findet, wer für das, was
geschichte wird von Homers Troja über die sie sagen, zugänglich ist, dem teilen sie al-
80362 77-82 Manger 21.12.1999 14:30 Uhr Seite 81
Die
politische
Zeitenwende in der Lyrik Paul Celans Meinung
les mit, was sie wissen. Und sie wissen oder Gleichwohl bleibt die Begegnung ein Ge-
erinnern viel. heimnis.
Voraussetzung dieser Poetik ist der Indivi- Im Gedicht „Anabasis“ im Band Die Nie-
duationsakt des Gedichts. Die „gestaltge- mandsrose heißt es: „Hinauf und Zurück /
wordene Sprache eines Einzelnen“, seine in die herzhelle Zukunft.“ Das Zitat stammt
Wirklichkeit und ihre Daten birgt das Ge- aus der Eröffnungsstrophe des Gedichts:
dicht. Da ihm alles mitgegeben ist, was für Dieses
sein Gegenüber bedeutsam werden kann, schmal zwischen Mauern geschriebne
bedarf es nur desjenigen, der verständig unwegsam – wahre
aufnimmt und demgegenüber es alles ihm Hinauf und Zurück
mitgegebene Mitteilsame auch freisetzen in die herzhelle Zukunft.
kann. Was ihm vom Dichter unter „dem Nei- Hinauf und Zurück klingen wie eine Gegen-
gungswinkel seiner Kreatürlichkeit“ anver- bewegung und meinen offenbar beide eine
traut ist, wird im transitorischen Augenblick Heimkehr. Die Begegnung auf der Schwelle
seines Anlandens und seiner verständigen dieses Gedichts erinnert an den Zug zehn-
Aufnahme aktualisiert. Das Gedicht wird so tausend griechischer Söldner unter Xeno-
im Augenblick seiner Entdeckung „aktuali- phons Leitung, wie er ihn in seiner Anaba-
sierte Sprache“. Und dank der „Individua- sis beschreibt. Schon Saint-John Perses
tion“ kommt es in die Lage, uns anzuspre- „Anabase“ (1924) ist, da es den Aufbruch ei-
chen, ganz ähnlich einem Menschen, der ei- nes Eroberers ins Innere eines fremden Lan-
nen anspricht. Deshalb sieht Celan keinen des zum Gegenstand hat, kein historisches
prinzipiellen Unterschied zwischen einem Gedicht mehr, ebenso wenig Celans „Ana-
Händedruck und einem Gedicht. basis“. Es erinnert aber an jenen Aufstieg der
Griechen und die in ihnen aufwallende
Freude über die nahe Heimkehr, da sie das
Erinnerndes Offenbaren
Meer erblicken. Schon in Celans Gedicht
Auch in Zukunft hoffen diese Gedichte auf- „Ein Lied in der Wüste“ verendet ein Ritter
genommen zu werden. Und vorausgesetzt, in der Gegend von Akra, wohl einer jener
das neue Jahrhundert stehe unter glück- Kreuzritter vor Jerusalem. Die Entstehung
licheren Vorzeichen als das zu Ende gegan- des Gedichts reicht in Celans Bukarester
gene, so werden auch künftigen Generatio- Zeit um 1945 zurück, als die Alliierten unter
nen diese Gedichte offenbaren, warnend, General Eisenhower gerade Europa dem
mahnend, erinnernd offenbaren, weil Men- Nationalsozialismus wieder entreißen.
schen vergesslich sind, was sie in Erinne- Diese Befreiungsaktion steht unter der
rung behalten sollten. Auf diese Weise wer- Flagge „The Crusaders“.
den sie auch künftigen Generationen ein Celans gereimte Langverse erinnern an krie-
Zeichen übermitteln, dass es angesichts gerische Eroberungs- und Befreiungsaktio-
der Verbrechen dieses zwanzigsten Jahr- nen wie das spätere Gedicht „Anabasis“
hunderts ein entschiedenes „hellgeat- auch. Es hat einige Aufmerksamkeit auf sich
mete[s] Nein“ gab und gibt. Diese Kunde gezogen, weil sich darin das Zitat „unde
macht das „Geheimnis der Begegnung“ suspirat / cor“ aus Mozarts Solomotette „Ex-
zwischen individuiertem Gedicht und sei- sultate, jubilate“ findet. Auch die Musik ge-
nem offenen Adressaten so bedeutsam. hört zu diesem Raum der Geschichte, durch
81362 77-82 Manger 21.12.1999 14:30 Uhr Seite 82
Die
politische
Meinung Klaus Manger
den die ihn aktualisierenden Gedichte hin- des Menschlichen zeugenden Akt der Frei-
durchgreifen. Im Unterschied zum mittel- heit entgegenzusetzen. Er markiert eine
alterlichen lateinischen Text der Motette, Schwelle. Celan wird dadurch zu einem
der an Maria, die Gottesmutter, gerichtet ist, Schwellendichter des zwanzigsten Jahr-
sagt das Zitat jetzt nur, dass aus welchem hunderts. Im Gedächtnisraum des Gedich-
Grund auch immer das Herz aufseufzt. Da- tes, wenn auch tief aufseufzend, bleibt – wie
mit tritt es zur „herzhelle[n] Zukunft“ in Kor- das „hellgeatmete Nein“ – dieses „Mitsam-
respondenz. men“ als intensivierte Gemeinschaft spiri-
Der Weg dieser Anabasis führt „weit / ins Un- tualiter erhalten.
befahrne hinaus“, eine maritime Welt, wo Die unserem kulturellen Gedächtnis zuge-
das aufseufzende Herz zum „Kummerbo- hörigen Gedichte stiften Gedächtnis, zeu-
jen-Spalier“ gehört. Das Gedicht gibt zwar gen von Akten der Freiheit und sind selbst
die Richtung „in die herzhelle Zukunft“ an. Akte der Freiheit.
Sie scheint aber, wie das „Kummerbojen- So wenig tröstlich sie uns scheinen mögen,
Spalier“ andeutet, anders als der historische so wahr sind sie. Aber sie bauen auch auf
Text keine freudvolle oder tröstliche Heim- die Hoffnung, es möge jemand, der ihnen
kehr zu sein. Vielmehr ist es die Anabasis ei- begegnet, sich dazu aufgefordert sehen, das
nes tief aufseufzenden Herzens. Am Ende Wort neu auszumachen. Eigene Räume der
steht: Geschichte begleiten sie – von Schwelle zu
Sichtbares, Hörbares, das Schwelle – auf maritimem Wege wie auf
frei- Sternenbahnen, auf Flugbahnen durch den
werdende Zeltwort: Raum der Geschichte.
Mitsammen. Wenn „Die Winzer“ aus „Von Schwelle zu
Das, was sich hier diesem Aufseufzen ent- Schwelle“ den Wein ihrer Augen „herb-
windet, ist das „frei- / werdende Zeltwort“; sten“, alles Geweinte keltern und das Sik-
es erinnert an das „hellgeatmete Nein“; hier kernde, das Geweinte, einkellern „im Son-
bietet das Zeltwort letzte Zuflucht und weist nengrab“, dann lässt sich ermessen, wel-
auf den Ort jener „herzhelle[n] Zukunft“. cher Anstrengungen es bedurfte, diese un-
Das freiwerdende Zeltwort ist in das Gedicht heimlichen Offenbarungen gestalteten Ge-
übergegangen. Es beschließt jetzt das Ge- dichten anzuvertrauen. In beispiellosen In-
dicht: „Mitsammen.“ Das „Hinauf und Zu- dividuationsakten greifen sie durch die Ge-
rück / in die herzhelle Zukunft“ mündet in schichte hindurch und aktualisieren das
den Gedächtnisort dieses Gedichtes, den den Einzelnen anrührende Geschehen. Es
das Schlusswort „Mitsammen“ benennt. Er- fällt schwer, ihr genaues Zeugnis nicht von
neut hat es der Dichter unternommen, den der Hoffnung begleitet zu sehen, auch in
Ungeheuerlichkeiten einen für die Majestät Zukunft Menschen zu begegnen.
Schwinden der Angst
„Erstaunlich, dass das Schwinden der Angst, der früher bei vielen stets gegenwärti-
gen, in der Nachwendezeit als Befreiung überhaupt nicht registriert wird.“
(Henryk Bereska, Ausgewählte Werke, Aphorismen 1999)
82Sie können auch lesen