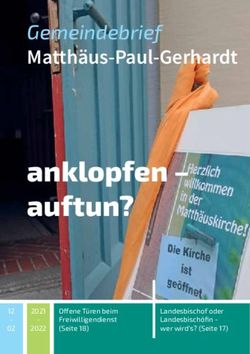Anmerkungen zum chronologischen Verhältnis von Hiob erzählung und Hiob dichtung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ZAW 2022; 134(1): 68–84 Walter Bührer* Anmerkungen zum chronologischen Verhältnis von Hioberzählung und Hiob dichtung https://doi.org/10.1515/zaw-2022-0001 Die These der Eigenständigkeit der Hiobdichtung (Hi 3,1–42,6) gegenüber der Hioberzählung (Hi 1,1–2,13; 42,7–17) wird in jüngerer Zeit besonders im deutsch- sprachigen Kontext zunehmend vertreten.1 Vertreter dieser These unterscheiden sich v. a. in ihrer Einschätzung, ob die Hioberzählung von Anfang an als Rahmung 1 Vgl. etwa Markus Witte, Vom Leiden zur Lehre. Der dritte Redegang (Hiob 21–27) und die Redak- tionsgeschichte des Hiobbuches, BZAW 230 (Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1994), 192 mit Anm. 66; Ders., »Das Hiobbuch (Ijob)«, in Grundinformation Altes Testament. Eine Einführung in Li- teratur, Religion und Geschichte des Alten Testaments, Hg. Jan Christian Gertz u. a. (Göttingen: Van- denhoeck & Ruprecht, 62019 [12006]) 432–445: 440 f.; Ders., Das Buch Hiob, ATD 13 (Göttingen: Van- denhoeck & Ruprecht, 2021), bes. 45–59; Wolf-Dieter Syring, Hiob und sein Anwalt. Die Prosatexte des Hiobbuches und ihre Rolle in seiner Redaktions- und Rezeptionsgeschichte, BZAW 336 (Berlin/ New York: Walter de Gruyter, 2004), bes. 131–133; 151–173; Otto Kaiser, Das Buch Hiob. Übersetzt und eingeleitet (Stuttgart: Radius, 2006; hier zitiert nach der Ausgabe von 2014), bes. 110–116; Jürgen van Oorschot, »Die Entstehung des Hiobbuches«, in Das Buch Hiob und seine Interpretationen. Bei- träge zum Hiob-Symposium auf dem Monte Verità vom 14.–19. August 2005, Hg. Thomas Krüger u. a., AThANT 88 (Zürich: TVZ, 2007) 165–184: 171–175; Martin Leuenberger, Segen und Segenstheologien im alten Israel. Untersuchungen zu ihren religions- und theologiegeschichtlichen Konstellationen und Transformationen, AThANT 90 (Zürich: TVZ, 2008), 419–422; Raik Heckl, Hiob – vom Gottesfürch- tigen zum Repräsentanten Israels. Studien zur Buchwerdung des Hiobbuches und zu seinen Quel- len, FAT 70 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010), bes. 1–8; 17–30; 341–376; 473 f.; Roger Marcel Wanke, Praesentia Dei. Die Vorstellungen von der Gegenwart Gottes im Hiobbuch, BZAW 421 (Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2013) (vgl. den Überblick auf S. 430). Vorausgesetzt ist die These auch in der Arbeit von Urmas Nõmmik, Die Freundesreden des ursprünglichen Hiobdialogs. Eine form- und tra- ditionsgeschichtliche Studie, BZAW 410 (Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2010) (vgl. etwa S. 2). Von den Genannten gehören lediglich Leuenberger und Heckl nicht zum (erweiterten) Schülerkreis Kaisers. An Vorläufern im 20. Jh. sind etwa zu nennen Curt Kuhl, »Neuere Literarkritik des Buches Hiob«, ThR 21 (1953) 163–205; 257–317: 192–195; Victor Maag, Hiob. Wandlung und Verarbeitung des Problems in Novelle, Dialogdichtung und Spätfassungen, FRLANT 128 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982), bes. 13–19; 91–96. Außerhalb des deutschsprachigen Kontextes ist aus jüngerer Zeit zumindest auf die kurzen Bemerkungen hinzuweisen von Zachary Margulies, »Oh That One Would Hear Me! The Dialogue of Job, Unanswered«, CBQ 82 (2020) 582–604: 583; 602–604. *Kontakt: Walter Bührer, Ruhr-Universität Bochum, Evangelisch-Theologische Fakultät, Univer- sitätsstr. 150, 44780 Bochum, Deutschland, E-Mail: walter.buehrer@ruhr-uni-bochum.de Open Access. © 2022 Bührer, published by De Gruyter. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Anmerkungen zum chronologischen Verhältnis 69
um die Hiobdichtung entstanden ist (Heckl), oder ob die Hioberzählung und die
Hiobdichtung auf eine »im Einzelnen nicht mehr rekonstruierbare Hioblegende«2
zurückgehen und zunächst je selbständig überliefert wurden, ehe sie redak-
tionell miteinander verbunden wurden (Kaiser, Witte, Syring, van Oorschot,
Wanke). Können sich Vertreter dieser These zwar auf Vorgänger berufen,3 steht
ihnen die im deutschsprachigen Kontext seit J.G. Eichhorn klassische, im interna-
tionalen Kontext, sofern diachron gearbeitet wird, die Mehrheits-Lösung entge-
gen, wonach die Hiobdichtung mindestens Teile der Hioberzählung voraussetzt,
letztere also älter als oder gleichursprünglich mit erstere(r) sein muss.4
Im Folgenden sollen in einem ersten Schritt die wichtigsten Argumente der
Vertreter der These der Eigenständigkeit der Hiobdichtung gegenüber der Hiob
erzählung dargestellt und evaluiert werden (1.). In einem zweiten Schritt soll
eine kurze redaktionsgeschichtliche Analyse der Hioberzählung zeigen, dass
und vor allem wie die klassische Lösung den Textbefund besser zu erklären ver-
mag (2.).
1 A
rgumente gegen die These der Eigenständigkeit der Hiob
dichtung gegenüber der Hioberzählung
1.) Dass im Hiobbild zwischen dem gottesfürchtigen Dulder der Hioberzählung
und dem seinen Gott anklagenden Rebellen der Hiobdichtung zu unterschei-
den ist,5 lässt sich nicht per se diachron, geschweige denn relativ-chronologisch
2 Witte, »Hiobbuch«: 440. Die Hiobdichtung wird dabei tendenziell älter als die Hioberzählung
eingestuft; vgl. ebd.; Ders., Buch Hiob, 52. Dagegen weist Kuhl, »Literarkritik«: 194 eine dia-
chrone Relationierung zurück, und Maag, Hiob, 19; 97; 215 sieht die Hioberzählung als älter an.
3 Vgl. die Angaben bei Witte, Leiden, 36, Anm. 164; 192, Anm. 66; Syring, Hiob, 25–30; 131–133;
Jürgen van Oorschot, »Tendenzen der Hiobforschung II (1995–2020)«, ThR 85 (2020) 197–247:
203–205.
4 Vgl. etwa die Darstellung bei Syring, Hiob, 30–50 und als aktuelle Vertreter dieser im Einzel-
nen unterschiedlich konturierten These Hermann Spieckermann, »Die Satanisierung Gottes. Das
Buch Hiob (1994)«, in Lebenskunst und Gotteslob in Israel. Anregungen aus Psalter und Weisheit
für die Theologie, Ders., FAT 91 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2014), 80–92; Melanie Köhlmoos, Das
Auge Gottes. Textstrategie im Hiobbuch, FAT 25 (Tübingen: Mohr Siebeck, 1999), bes. 46–55; 71–
73; Konrad Schmid, Hiob als biblisches und antikes Buch. Historische und intellektuelle Kontexte
seiner Theologie, SBS 219 (Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 2010), bes. 11–18; 20 f. (wobei S. 18
unvermittelt eine Offenheit für die hier zurückgewiesene These aufscheinen lässt); Jacques Ver-
meylen, Métamorphoses. Les rédactions successives du livre de Job, BEThL 276 (Leuven: Peeters,
2015).
5 Die ersten vier hier evaluierten Punkte entstammen der »[l]iterar- und forschungsgeschicht
liche[n] Problemanzeige« bei Witte, »Hiobbuch«: 437 f.70 Walter Bührer hinsichtlich einer Abhängigkeitsrichtung auswerten. Das überlieferte Hiobbuch vermittelt auf jeden Fall gekonnt zwischen beiden Hiobbildern6 – etwa indem Hiobs Frau ihm durch ihre kurze und zunächst zurückgewiesene Rede (Hi 2,9.10) letztlich dazu verhilft, sprachfähig zu werden in seinem Leid,7 indem das sieben- tägige Schweigen von Hiobs Freunden (Hi 2,11–13) eine Erwiderung Hiobs nach- gerade herausfordert,8 und indem ihm schließlich die Gottesreden (Hi *38–42) wieder eine positive(re) Perspektive auf seine Gottesbeziehung aufzeigen.9 2.) Die Figuren des Satans und der Göttersöhne sind lediglich in der vorderen Hioberzählung belegt (Hi 1,6–12; 2,1–7). Da sie hier jedoch nur den Leserinnen und Lesern des Hiobbuches präsentiert werden, nicht aber den im Buch agie- renden Figuren, lässt sich ihr »Fehlen« in der Hiobdichtung und in der hinteren Hioberzählung ebenso wenig diachron, geschweige denn relativ-chronologisch auswerten. Während in den Himmels- oder Satansszenen YHWH und der Satan in Tateinheit agieren,10 stellt sich Hiob und seiner Familie in der Hiobdichtung und im zweiten Teil der Hioberzählung YHWH allein als Urheber »all des Schlechten« dar, das über Hiob gekommen ist (Hi 42,11; vgl. Hi 1,21). Die Nachzeichnung der Himmelsszenen in der Erzählung von Hiobs Restitution in Hi 42 ist in erzähleri- scher Hinsicht schlicht unnötig.11 3.) Die Verteilung der unterschiedlichen Gottesbezeichnungen zwischen Hiob erzählung und Hiobdichtung ist in der Tat bemerkenswert,12 lässt eine dia- chrone, geschweige denn relativ-chronologische Auswertung indes nicht zu.13 Die Identifikation Gottes14 mit YHWH ist für die Leserinnen und Leser der 6 Vgl. Schmid, Hiob, 12; 16. 7 Vgl. Manfred Oeming, »Die Dialoge mit Frau und Freunden«, in Hiobs Weg. Stationen von Men- schen im Leid, Hg. Manfred Oeming und Konrad Schmid, BThSt 45 (Neukirchen-Vluyn: Neukir- chener, 2001) 35–56: 42–45. 8 Vgl. Köhlmoos, Auge, 100: »Auch die Freunde haben die dramaturgische Aufgabe, Hiob zum Reden zu bringen.« 9 Vgl. Manfred Oeming, »Die Begegnung mit Gott«, in Hiobs Weg. Stationen von Menschen im Leid, Hg. Manfred Oeming und Konrad Schmid, BThSt 45 (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2001) 95–119: 114–119. 10 Vgl. Spieckermann, »Satanisierung«. 11 Vgl. Köhlmoos, Auge, 346 f.; Syring, Hiob, 95. 12 Vgl. die Übersicht bei Syring, Hiob, 99–101. 13 Vgl. Schmid, Hiob, 12; 17. 14 Vgl. )ה(אלהיםin Erzählerrede in Hi 1,1.6.16.22; 2,1; 32,2 und im Munde von Erzählfiguren in Hi 1,5.8.9; 2,3.9.10; 5,8; 20,29; 28,23; 34,9; 38,7. Dabei sind die Belege von » )ה(אלהיםüberwiegend in gefügte Begriffe eingebunden« (Syring, Hiob, 99, Anm. 224).
Anmerkungen zum chronologischen Verhältnis 71 Hiobdichtung durch Hi 38,1; 40,1.3.6; 42,115 auf jeden Fall genauso deutlich wie für die Leserinnen und Leser der Hiob erzählung durch Hi 1,6.7bis.8.9.12bis; 2,1bis.2bis.3.4.6.7; 42,7bis.9bis.10bis.11.12. Im Munde Hiobs wird YHWH lediglich in Hi 1,21ter genannt. Ansonsten führen Hiob und seine Freunde, die allesamt als Nicht-Israeliten vorgestellt werden (vgl. bes. Hi 1,1–3; 2,11), die Gottesbezeich- nungen אלוה, אל, ׁשדיund )ה(אלהיםim Mund. In Hi 28,28, als dessen Sprecher Hiob auch im masoretischen Text nicht ausgeschlossen ist, ist zudem אדניbelegt. Hiob wird in Hi 1,21 mithin als YHWH-Verehrer der Völker16 dargestellt, der wie Jitro (Ex 18,10 f.), Rahab (Jos 2,9–13) und Naaman (II Reg 5,[11.]17 f.) den Namen YHWHs nennt und der wie Jitro in Ex 18,10 YHWH segnet.17 4.) »Erzählt der Prolog vom Tod der Kinder Hiobs, so setzt die Klage Hiobs in Kap. 19 voraus, dass diese noch am Leben sind.«18 Ersteres ist unstrittig (vgl. Hi 1,18 f.), Letzteres jedoch hängt an der strittigen Deutung von בני בטניin Hi 19,17:19 Handelt es sich um die eigenen Kinder Hiobs, die entsprechend dem ersten Teil der Hioberzählung in der Tat tot sein müssten,20 oder handelt es sich 15 Bei dem Beleg in Hi 12,9 dürfte es sich um eine Aufnahme von Jes 41,20 handeln (jeweils » כי יד־יהוה עׂשתה זאתdass die Hand YHWHs dies getan hat«), wie gerade die unklare Referenz von » זאתdies« in Hi 12,9 im Unterschied zum Jesajabeleg zeigt (vgl. Samuel Terrien, Job, CAT 13 [Genève: Labor et Fides, 22005 (11963)], 159; vgl. auch ausführlich zur Frage, jedoch mit anderer Auswertung JiSeong James Kwon, Scribal Culture and Intertextuality. Literary and Historical Re- lationships between Job and Deutero-Isaiah, FAT II/85 [Tübingen: Mohr Siebeck, 2016], 66–68). Hi 19,21 bezeugt auf jeden Fall die Rede von der »Hand Gottes« ( )יד־אלוהfür die Hiobdichtung, die Formulierung » יד־יהוהHand YHWHs« ist damit keineswegs alternativlos. 16 Die Terminologie folgt Volker Haarmann, JHWH-Verehrer der Völker. Die Hinwendung von Nichtisraeliten zum Gott Israels in alttestamentlichen Überlieferungen, AThANT 91 (Zürich: TVZ, 2008), der (das) Hiob(buch) indes nicht behandelt. Mit der »Einholung Hiobs ins Judentum« (Markus Witte, »Hiob und seine Frau in jüdischen Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit [2009]«, in Hiobs viele Gesichter. Studien zur Komposition, Tradition und frühen Rezeption des Hiobbuches, Ders., FRLANT 267 [Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018], 133–164: 152) in der frühen Rezeptionsgeschichte des Hiobbuches, allen voran durch den Appendix der Septuaginta und das Testament Hiobs, werden die Parallelen zwischen Hiob und den weiteren YHWH-Vereh- rern der Völker ungleich enger. 17 Vgl. weiter I Reg 8,41–43; Jes 56,1–8; Jon 1,16. 18 Witte, »Hiobbuch«: 437. 19 Vgl. zu folgenden Überlegungen und zu Hiobs Kindern insgesamt Walter Bührer, »La famille de Job dans les différents livres de Job. Le texte hébreu, la Septante et le Testament de Job en comparaison«, ThZ 77 (2021) 290–307: 292–300, bes. 298. Die Septuaginta deutet בני בטניals die »Söhne meiner Nebenfrauen« (υἱοὺς παλλακίδων μου), Symmachos spricht von Hiobs Enkelkin- dern (υἱοὺς παίδων μου). 20 Vgl. etwa Kaiser, Buch, 37; Witte, »Hiob und seine Frau«: 136; Ders., Buch Hiob, 304; Heckl, Hiob, 116 f.; 351 f.; Margulies, »Dialogue«: 585.
72 Walter Bührer
um die Kinder des Leibes, der auch Hiob geboren hat, also um seine Brüder?21 בטן
bezeichnet in der Tat an verschiedenen Stellen die Fruchtbarkeit (oder deren Ab-
wesenheit) eines Mannes oder einer mindestens partiell maskulin konnotierten
Größe (vgl. Dtn 7,13; 28,4.11.18.53; 30,9; Mi 6,7; Ps 132,11; Hos 9,16). In der Mehrzahl
der Belegstellen bezeichnet בטןjedoch die Fruchtbarkeit (oder deren Abwesen-
heit) einer Frau22 – die stets mit im Blick ist auch bei den zuvor genannten Stellen.
Entscheidend für die Deutung von בני בטניin Hi 19,17 ist einerseits, dass die zwei
Belegstellen, die Hi 19,17 am ähnlichsten formulieren, explizit vom Leib einer
Frau sprechen (Jes 49,15 [ ;]בן־בטנהProv 31,2 [ ;בר־בטניvgl. 31,1]), und dass ande-
rerseits sämtliche Belegstellen von בטןinnerhalb des Hiobbuches nebst Hi 19,17,
die auf Fruchtbarkeit abzielen, ebenso explizit auf Frauen bezogen sind – und
zwar in der Mehrheit der Fälle auf Hiobs Mutter.23 Die Deutung von בני בטניin
Hi 19,17 auf Hiobs Brüder ist damit insgesamt wahrscheinlicher24 – und stimmt
damit mit drei weiteren Belegen von Hiobs Kindern in der Hiobdichtung überein,
die den Tod von Hiobs Kindern entsprechend dem ersten Teil der Hioberzählung
voraussetzen:
In Hi 8,1–7 bezieht sich Bildad deutend auf Pro- und Epilog des Hiobbuches
unter Verwendung der dort belegten Lexeme: Seines Erachtens sind es mitnich-
ten Hiobs eigene Sünden (Hi 7,20 f.; )פׁשע ;חטא, sondern die Sünden seiner Kinder,
genauer seiner Söhne ()בניך, denen Gott sie ausgeliefert hat (Hi 8,4; )פׁשע ;חטא.
Bildad leitet aus dem Tod von Hiobs Kindern aus Hi 1,18 f. folglich ab, dass die
21 Vgl. etwa Terrien, Job, 66; 193 f.; Georg Fohrer, Das Buch Hiob, KAT 16 (Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, 21988 [11963]), 307 f.; 315; Vermeylen, Métamorphoses, 58; 128 f.; 280; 299 (der in
dem Vers jedoch einen Nachtrag vermutet).
22 Vgl. Gen 25,23 f.; 30,2; 38,27; Num 5,21 f.27; Jdc 13,5.7; 16,17; Jes 13,18; 44,2.24; 46,3; 48,8;
49,1.5.15; Jer 1,5; Hos 9,11; 12,4; Hi 1,21; 3,10 f.; 10,19; 31,15.18; Ps 22,10 f.; 58,4; 71,6; 127,3; 139,13;
Prov 31,2; Qoh 5,14; 11,5; Cant 7,3.
23 Vgl. die in voranstehender Anm. genannten Belege. Darüber hinaus bezeichnet בטןin Hi 38,29
die Mutterschaft Gottes bezüglich des Eis (nach den Bildern der Vaterschaft Gottes in Hi 38,28).
24 Eine bemerkenswerte Parallele findet sich in den Sprüchen Achiqars: C1.1 VIII 139 f. be-
schreibt, wie das auf Achiqar transparente Unheil von seinem eigenen Haus ausging, und nennt
explizit den »Sohn meines Schoßes« ( ;בר בטניZ.139; vgl. den Text in Bezalel Porten und Ada Yar-
deni, Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt. Newly Copied, Edited and Translated
into Hebrew and English. Vol. 3. Literature – Accounts – Lists [Winona Lake: Eisenbrauns, 1993],
24–53). Wie die Erzählung über Achiqar zeigt, ist Nadin keineswegs Achiqars eigener Sohn, son-
dern sein Neffe. בר בטניbezeichnet hier damit lediglich eine enge verwandtschaftliche Verbin-
dung. Vgl. die Behandlung der Passage durch Michael Weigl, Die aramäischen Achikar-Sprüche
aus Elephantine und die alttestamentliche Weisheitsliteratur, BZAW 399 (Berlin/New York: Walter
de Gruyter, 2010), 325–339; 696–699 und knapp Reinhard G. Kratz, »Mille Aḥiqar: ›The Words
of Aḥiqar‹ and the Literature of the Jewish Diaspora in Ancient Egypt«, Al-Abhath 60–61 (2012–
2013) 39–58: 48 f.Anmerkungen zum chronologischen Verhältnis 73
von Hiob lediglich imaginierte Sünde (Hi 1,5; )חטאseiner Kinder, genauer seiner
Söhne (Hi 1,5; )בני, eine reelle Sünde war. Würde sich Hiob dagegen Gott wieder
zuwenden, würde er sich als aufrecht erweisen ( ;יׁשרvgl. Hi 1,1), würde sich auch
Gott Hiob wieder zuwenden (Hi 8,6). In diesem Falle würde Hiobs Anfang gering,
sein Ende jedoch sehr groß sein ( ;והיה ראׁשיתך מצער ואחריתך יׂשגה מאדHi 8,7), was
nach Hi 42,12 genau der Fall ist (» ויהוה ברך את־אחרית איוב מראׁשתוYHWH aber
segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang«).
In Hi 29 wünscht sich Hiob sein früheres Leben zurück. Hi 29,5 spricht dabei
von seinen Kindern, die ihn früher umgaben. Der hebräische Text verwendet
hierfür » נעריmeine Jungen«, womit in Hi 1,19 die Söhne und Töchter Hiobs be-
zeichnet werden, der griechische Text οἱ παῖδες »die Kinder«.
Hi 17,5 verbleibt etwas enigmatisch im hebräischen Text. In der ältesten
Fassung der Septuaginta spielt Hiob in HiLXX 17,1.2.3a.5b jedoch an den Ver-
lust seiner Besitztümer und Kinder entsprechend Hi 1 an:25 »Meine Augen aber
sind über meine Söhne zerflossen« (ὀφθαλμοὶ δέ μου ἐφ᾽ υἱοῖς ἐτάκησαν; HiLXX
17,5b).
Die Belege von Hiobs Kindern bereiten damit keine Spannungen zwischen
Hioberzählung und Hiobdichtung.26 Hi 8,1–7; 17,5LXX; 29,5 legen vielmehr nahe,
dass zumindest diese Teile der Hiobdichtung die Hioberzählung voraussetzen.
5.) Entscheidend für die These der Eigenständigkeit der Hiobdichtung ist die
Einschätzung, »daß alles, was der Leser zum Verständnis [der Hiobdichtung]
braucht, in den Monologen gesagt ist«.27 Dass »die umfängliche Eingangs-
klage des Protagonisten in Hiob 3*« »dem Leser das Grundproblem der Dich-
tung« mitteilt und »deren zentrale Person« einführt,28 trifft zu. Die Situation
eines Dialoges von einem Leidenden (Hiob) und drei Freunden ist indes ohne
Hi 2,11–13 nicht hinreichend eingeführt:29 Hiob spricht in seiner Reaktion auf die
erste Freundesrede (Hi 4 f.) in Hi 6,(15–20.)21–30 eine Pluralgröße direkt an. Eine
solche ist in Hi 3 ff. jedoch nicht eingeführt. Ohne die Einführung von Hiobs
drei Freunden in Hi 2,11–13 sind in Hi 3–7 lediglich der Leidende (Hiob nach
Hi 3,1 f.; 6,1) und ein Gesprächspartner (Elifaz von Teman nach Hi 4,1) mitein-
25 HiLXX 17,3b.4.5a sind asterisiert in der Ausgabe von Origenes.
26 Vgl. auch Kuhl, »Literarkritik«: 188.
27 Ebd.: 194.
28 Van Oorschot, »Entstehung«: 173. Zu möglichen Einschränkungen hinsichtlich der Einfüh-
rung der zentralen Person s. u.
29 Vgl. in jüngerer Zeit etwa Susanne Rudnig-Zelt, »Der Teufel und der alttestamentliche Mono-
theismus«, Das Böse, der Teufel und Dämonen – Evil, the Devil, and Demons, Hg. Jan Dochhorn
u. a., WUNT II/412 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2016), 1–20: 12, Anm. 53.74 Walter Bührer
ander im Dialog, die pluralischen Anreden in Hi 6,(15–20.)21–30 somit unvor-
bereitet.30
Wenn einige Vertreter der These der Eigenständigkeit der Hiob dichtung
darüber hinaus annehmen, dass die prosaischen Einleitungen Hiobs und der
Freunde innerhalb der Hiobdichtung (Hi 3,1.2.; 4,1 etc.) sekundär sind oder zu-
mindest redaktionell überarbeitet wurden,31 ist eine Unterscheidung von Hiobs
Gesprächspartnern (zumindest nach formalen Kriterien)32 letztlich gänzlich un-
möglich.33 In der »Auseinandersetzung zwischen einem namenlosen Leidenden
und seinen namenlosen Freunden«34 bleibt die Anzahl der Gesprächspartner
genauso offen wie die Komposition ihrer Reden. Dass die supponierte redakti-
onelle Verbindung von Hiobdichtung und Hioberzählung durch Hi 2,11–1335 drei
Freunde eingeführt und durch die prosaischen Redeeinleitungen drei (nach
hinten ausfransende!) Redegänge konstruiert hat, lässt sich allein aus den poeti-
schen Passagen der Hiobdichtung auf jeden Fall kaum herleiten.36
30 Das vereinzelte »Wir« in den Freundesreden des ersten Redeganges, Hi 5,27 (statt ְׁש ָמ ֶעּנָ ה
»höre es« ist in Analogie zu נּוהָ » ֲח ַק ְרwir haben es erforscht« und mit LXX » ְׁש ַמ ֲענֻ ָהwir haben
es gehört« zu lesen); 8,9 (11,3 [» מתיםMänner«]), meint kaum ein konkretes Gegenüber Hiobs
(das auf jeden Fall nicht weiter definiert wäre), sondern vielmehr die weisheitliche Tradition,
die Weisheitslehrer insgesamt. Vgl. Choon Leong Seow, Job 1–21. Interpretation and Commentary,
Illuminations (Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans, 2013), 426 f. (zu Hi 5,27).
31 Vgl. Syring, Hiob, 129–131; 168; Kaiser, Buch (vgl. bes. S. 115.125 f.); Nõmmik, Freundesreden,
22 f. u. ö.; Wanke, Praesentia, 8; 115 f.; 430. Vgl. bereits die Erwägung von Kuhl, »Literarkritik«:
195 mit Blick auf Hiob.
32 Bemerkenswert ist immerhin, dass Versuche, die Elifas-, Bildad- und Zofar-Reden jeweils
für sich und in Abgrenzung zu den anderen Freundesreden inhaltlich zu konturieren, selbstver-
ständlich von der Unterscheidung der Freunde durch Hi 2,11–13 und die prosaischen Redeeinlei-
tungen ausgehen. Vgl. etwa Nõmmik, Freundesreden, 235 f.
33 Syring, Hiob, 131, Anm. 377 hält immerhin fest: »Eine unterscheidende Kennzeichnung der
drei Freunde Hiobs scheint für den Dialog notwendig zu sein.« Und Maag, Hiob, 13–19; 91–96
weist seiner ehedem eigenständigen Hiobdichtung von Anfang an die narrative Rahmung durch
Hi 2,11–13; 3,1; 42,7–9 zu, die aber ihrerseits fragmentarisch und damit auf weiteren Text ange-
wiesen ist (vgl. S. 92) – und zwar Text, der sich in der Substanz bezeichnenderweise in der über-
lieferten Fassung des Hiobbuches findet, nämlich »daß der Leser Hiob schon kennt und daß
er zudem auch bereits vernommen hat, wie der fromme Mann ins Elend gekommen ist« (ebd.),
dazu eine Form der Restitution, allenfalls Hi 42,10b (vgl. S. 32 f.; 92; 95 f.). Witte, Buch Hiob, 54;
57 f. rechnet nun auch explizit mit der Ursprünglichkeit der Überschriften im Rahmen der ur-
sprünglichen Hiobdichtung.
34 Wanke, Praesentia, 430; vgl. 8; 115 f.
35 Vgl. Kuhl, »Literarkritik«: 201 f.; Syring, Hiob, 95–98; van Oorschot, »Entstehung«: 175–177;
Wanke, Praesentia, 111–120; Witte, Buch Hiob, 54 f.; 58; 82.
36 Dann bleibt auch offen, weshalb »[d]ie namenlosen Gesprächpartner aus der ursprünglichen
Dichtung […] in diesem Verknüpfungsprozess des Hiobbuches nun eingeleitet und vorgestelltAnmerkungen zum chronologischen Verhältnis 75 6.) Eng mit dem vorangehenden Punkt zusammen gehört der Verweis auf alt- testamentliche und altorientalische Analogien, die »ohne Einleitung ein poeti- sches Korpus eröffnen«37 oder die erst eine sekundäre Rahmung eines poetischen Korpus aufweisen. Genannt werden hierfür das Buch Qohelet, das »erst sekundär mit einer einleitenden Überschrift (Koh 1,1 f.) und einem Abschluss (Koh 12,9– 11.12–14) versehen« wurde,38 die beiden mesopotamischen Weisheitstexte Ludlul bēl nēmeqi und die sog. Babylonische Theodizee sowie die aramäische Achiqar- Komposition, bei der ausweislich der unterschiedlichen Sprachstufen die alt aramäischen Sprüche erst nachträglich in reichsaramäischer Sprache narrativ mindestens eingeleitet, möglicherweise auch gerahmt wurden.39 Bei diesen Ana- logien, denen freilich unschwer solche an die Seite gestellt werden können, die von Anfang an eine narrative Rahmung oder zumindest eine narrative Einleitung einer weisheitlichen Komposition aufweisen,40 stellt sich jedoch »die Frage, wie sprechend diese Beispiele wirklich sind, da sie bezüglich Inhalt und redender Per- sonen sehr viel weniger komplex strukturiert sind als das Hiobbuch.«41 Die auf- werden [»müssen«], um den Dialog in dieser Fassung des Hiobbuches verständlich zu machen« (Wanke, Praesentia, 115; Hervorhebung d. Vf.). Ist der Dialog im Anschluss an einen (wie auch immer konturierten) Grundbestand der Hioberzählung unverständlich, gilt dies erst recht für einen Dialog ohne vorangehende Einführung in die Hiob-Problematik. 37 Syring, Hiob, 169. 38 Van Oorschot, »Entstehung«: 173. Vgl. Wanke, Praesentia, 8. 39 Vgl. Witte, Leiden, 192; Syring, Hiob, 18; 133; 169; Kaiser, Buch, 115; van Oorschot, »Entste- hung«: 173; Leuenberger, Segen, 419 f. mit Anm. 916; Heckl, Hiob, 25–29; 473; Wanke, Praesentia, 7 f. Zuweilen werden auch andere Texte angeführt. So verweist etwa Kuhl, »Literarkritik«: 194 auf die sekundären Psalmenüberschriften und Heckl, ebd. zusätzlich auf die Einfügung des Hanna- Psalmes in I Sam 2 in seinen Kontext und auf die ägyptische Prophezeiung des Neferti. 40 Vgl. nur die Hinweise auf einige Texte bei Kuhl, »Literarkritik«: 188; van Oorschot, »Entste- hung«: 173. Auch Maag, Hiob, 91 verweist für seine ehedem eigenständige Hiobdichtung mit narrativem Rahmen in Hi 2,11–13; 3,1; 42,7–9 auf ägyptische Weisheitstexte (vgl. S. 13; 97). Aus- führliche Vergleiche des Hiobbuches mit ausgewählten Analogien bieten zuletzt (mit Nennung älterer Literatur) Annette Schellenberg, »Hiob und Ipuwer. Zum Vergleich des alttestamentlichen Hiobbuchs mit ägyptischen Texten im Allgemeinen und den Admonitions im Besonderen«, in Das Buch Hiob und seine Interpretationen. Beiträge zum Hiob-Symposium auf dem Monte Verità vom 14.–19. August 2005, Hg. Thomas Krüger u. a., AThANT 88 (Zürich: TVZ, 2007), 55–79; Chris- toph Uehlinger, »Das Hiob-Buch im Kontext der altorientalischen Literatur- und Religionsge- schichte«, in Das Buch Hiob und seine Interpretationen. Beiträge zum Hiob-Symposium auf dem Monte Verità vom 14.–19. August 2005, Hg. Thomas Krüger u. a., AThANT 88 (Zürich: TVZ, 2007), 97–163; Franz Sedlmeier, »Ijob und die Auseinandersetzungsliteratur im alten Mesopotamien«, in Das Buch Ijob. Gesamtdeutungen – Einzeltexte – Zentrale Themen, Hg. Theodor Seidl und Ste- phanie Ernst, ÖBS 31 (Frankfurt am Main: Lang, 2007), 85–136. Vgl. auch Schmid, Hiob, 13 f.; 56–62; Seow, Job, 51–61. 41 Schmid, Hiob, 13. Vgl. Vermeylen, Métamorphoses, 60 f. mit Anm. 22.
76 Walter Bührer grund ihrer Dialogstruktur in formaler Hinsicht der Hiobdichtung am nächsten stehende Parallele, die sog. Babylonische Theodizee,42 stellt auf jeden Fall einen deutlich schematischer aufgebauten und von der Gesprächssituation wesentlich weniger komplexen Dialog zwischen einem Leidenden und einem Freund dar: Die Dialogdichtung ist in 27 Strophen zu je 11 Zeilen gegliedert, der Leidende und sein Gesprächspartner wechseln sich von Strophe zu Strophe ab, beginnend und endend mit dem Leidenden (darin Hi 3–31 vergleichbar). Durch die akrostichi- sche Gestaltung des Gedichtes, wonach alle 11 Zeilen je Strophe mit demselben Silbenzeichen beginnen, springen die Gliederung des Textes und der damit ange- zeigte Sprecherwechsel förmlich ins Auge. Darüber hinaus ist der Sprecherwech- sel in vielen Fällen durch Redeeinleitungen und Anreden deutlich markiert.43 Obwohl der Freund gar nicht und der Leidende nur mittelbar durch das Akrosti- chon benannt werden,44 ist die Gesprächssituation damit stets klar – anders als bei einem mit Hi *3 einsetzenden Hiob-»Buch«, bei dem die in Hi 6,(15–20.)21–30 adressierte Pluralgröße und, werden zusätzlich die prosaischen Redeeinleitun- gen für nachgetragen erachtet, die Anzahl der Gesprächspartner sowie die Kom- position ihrer Reden unbestimmt bleiben. Die von Vertretern der These der Eigen- ständigkeit der Hiobdichtung angeführten Analogien zeigen damit vielmehr die Schwierigkeiten der These auf. Die bisherigen Anmerkungen versuchten zu zeigen, dass die diskutierten Diffe- renzen zwischen der Hioberzählung und der Hiobdichtung keine diachrone, ge- schweige denn relativ-chronologische Auswertung erlauben (1.–3.), dass die Er- wähnungen von Hiobs Kindern in der Hiobdichtung ihren Tod entsprechend dem ersten Teil der Hioberzählung voraussetzen (4.), dass eine von Hi 2,11–13 unab- hängige Hiobdichtung die Gesprächssituation mindestens in Hi 3–7 im Unklaren ließe (5.), und dass die für die These der Eigenständigkeit der Hiobdichtung an- geführten Analogien vielmehr die Schwierigkeiten der These aufzeigen (6.). Eine von der Hioberzählung unabhängige Entstehung der Hiobdichtung erscheint somit wenig wahrscheinlich zu sein. 42 Vgl. Text und Analysen bei Wilfred G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature (Winona Lake: Eisenbrauns, 1996 [= Nachdruck der Ausgabe Oxford: University Press, 1960]), 63–89; Takayoshi Oshima, Babylonian Poems of Pious Sufferers. Ludlul Bēl Nēmeqi and the Babylonian Theodicy, ORA 14 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2014), 115–168; 343–375; 439–464 sowie die Vergleiche mit dem Hiobbuch bei Uehlinger, »Hiob«: 146–159; Sedlmeier, »Ijob«: 118–124. 43 Vgl. Uehlinger, »Hiob«: 148–150. Zu den Anreden innerhalb der Hiobdichtung vgl. Köhlmoos, Auge, 112–116; Klaudia Engljähringer, Theologie im Streitgespräch. Studien zur Dynamik der Dia- loge des Buches Ijob, SBS 198 (Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 2003). 44 Das Akrostichon lautet: »Ich (bin) Sangil-kīnam-ubbib (=Esangila, reinige den Aufrichtigen), der Beschwörer, der den Gott und den König grüßt/segnet.« Vgl. Oshima, Poems, 121–125.
Anmerkungen zum chronologischen Verhältnis 77
Dies heißt nun mitnichten, dass Hioberzählung und Hiobdichtung ein und
demselben Autor zugewiesen werden können. Vielmehr zeigt die Redaktionsge-
schichte der Hioberzählung, wie das überlieferte Hiobbuch als Buch bestehend
aus Hioberzählung und Hiob dichtung entstanden ist. Da die Redaktionsge-
schichte der Hioberzählung von den meisten Vertretern der oben zurückgewie-
senen These ähnlich rekonstruiert wird wie hier, kann die Argumentation hier
knapp erfolgen:45
2 A
nmerkungen zur Redaktionsgeschichte der Hioberzählung
Wie Hi 2,11–13 die Freunde Hiobs narrativ einführt und damit die Hiobdichtung
einleitet, so bringt Hi 42,7–10 die Hiobdichtung narrativ an ihr Ende und lässt die
Freunde Hiobs die Bühne des Geschehens verlassen. Die in Hi 42,10 berichtete
Restitution Hiobs nimmt dabei Hi 42,11–17 systematisierend, jedoch unpräzise
vorweg und knüpft damit redaktionell an den älteren Bericht von Hiobs Restitu-
tion an:46 Die doppelte Erstattung aus Hi 42,10 bezieht sich lediglich auf die Ver-
doppelung von Hiobs Besitz in Hi 42,12 (vgl. Hi 1,3), nicht aber auf seine Familie
in Hi 42,13 (vgl. Hi 1,2). Hiobs ursprüngliche Restitution in Hi 42,11–17 erfolgt
vielmehr in zwei Schritten: Seine Resozialisierung durch »alle seine Brüder und
alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten«, die sich ihm tröstend
zuwenden und ihm ökonomisch erste Hilfe leisten (Hi 42,11; nach Hi 42,10 wirkt
dieser Vers reichlich überflüssig), und seine Segnung durch YHWH, die seinen ur-
sprünglichen Besitz verdoppeln lässt (Hi 42,12; vgl. Hi 1,3), ihm wieder eine große
Familie schenkt (Hi 42,13–16; vgl. Hi 1,2) und ein erfülltes Leben gibt (Hi 42,16 f.).
Hi 42,11–17 »weiß nichts von Hiobs drei Freunden und vor allem auch nichts von
seiner Krankheit […] In Wirklichkeit hat diese Aufzählung nur Hiobs Besitzver-
luste aus 1,13–19 im Auge und ist in den Angaben über ihre Wiedergutmachung
auch nahezu vollständig«.47
Wie zu Hi 42,7–10, so steht Hi 42,11–17 auch zu Hi 2,11–13 in Spannung, inso-
fern Hi 42,11 eine Doppelung zu Hi 2,11 darstellt: Die Beileidsbekundung ( )נודund
45 Zu verweisen ist besonders auf die eingehende Analyse der Hioberzählung durch Syring,
Hiob. Anders als dort und hier sieht Heckl, Hiob die Hioberzählung als einheitlich an.
46 Vgl. Ludwig Schmidt, »De Deo«. Studien zur Literarkritik und Theologie des Buches Jona, des
Gesprächs zwischen Abraham und Jahwe in Gen 18,22 ff. und von Hi 1, BZAW 143 (Berlin/New York:
Walter de Gruyter, 1976), 172 f.; Michael Rohde, Der Knecht Hiob im Gespräch mit Mose. Eine tra-
ditions- und redaktionsgeschichtliche Studie zum Hiobbuch, ABG 26 (Leipzig: Evangelische Ver-
lagsanstalt, 2007), 118–120.
47 Albrecht Alt, »Zur Vorgeschichte des Buches Hiob«, ZAW 55 (1937) 265–268: 267.78 Walter Bührer
das Trösten ( )נחםdurch die Freunde in Hi 2,11 sind indes auf eine Fortsetzung hin
angelegt, die sich in der Hiobdichtung findet. Die Beileidsbekundung ( )נודund
das Trösten ( )נחםdurch die Brüder, Schwestern und Bekannten Hiobs in Hi 42,11
stehen dagegen für sich. Mit der sich daran anschließenden Restitution durch
YHWH in Hi 42,12–17 wird die Hioberzählung abgeschlossen. Der Besuch der
Freunde (Hi 2,11–13) dürfte damit nach dem Besuch der Brüder, Schwestern und
Bekannten (Hi 42,11) gestaltet sein.48
Die narrative Ein- und Ausleitung der Hiobdichtung, Hi 2,11–13 und Hi 42,7–
10, sind damit jünger als die ursprüngliche Hioberzählung.
Entsprechend der oben begründeten Einschätzung, dass die Hiobdichtung
auf die Einführung von Hiobs Freunden in Hi 2,11–13 angewiesen ist und Teile
der ursprünglichen Hioberzählung voraussetzt, dürfte Hi 2,11–13 damit dem Autor
der Hiobdichtung zugewiesen werden:49 Zur Vorstellung der Dialogpartner über-
nimmt er einerseits die Präsentation Hiobs und dessen Geschick in der Form der
ursprünglichen Hioberzählung und bildet andererseits die Einführung von drei
Freunden Hiobs neu. Die Eröffnung seiner langen Ergänzung (Hi 2,11) bildet er
dabei in Analogie zur Eröffnung des ursprünglichen Berichtes von Hiobs Resti-
tution (Hi 42,11).
Ist Hi 2,11–13 damit notwendiges Bindeglied zwischen der älteren Hiob
erzählung und der jüngeren, mit Hi 2,11–13 gleichursprünglichen, Hiobdichtung,
48 Vgl. Kuhl, »Literarkritik«: 201; Georg Fohrer, »Überlieferung und Wandlung der Hioblegende
(1959)«, in Studien zum Buche Hiob (1956–1979), Ders., BZAW 159 (Berlin/New York: Walter de
Gruyter, 21983) 37–59: 38 (allerdings mit der Annahme weitreichender Textumstellungen und
-umarbeitungen); Schmidt, De Deo, 169; 176 f.; Syring, Hiob, 97; 116–118.
49 Vgl. Schmidt, De Deo, 176; Vermeylen, Métamorphoses, 69–71; 75; 180–182; 191; 214 f. Auf
diese Weise erklärt sich auch die konkrete Gestaltung von Hi 3,1.2 und muss nicht als redak
tionelle Überarbeitung interpretiert werden. Hi 3,1.2 ist deutlich auf Vorkontext angewiesen.
Die relative Zeitbestimmung » אחרי־כןdanach« in Hi 3,1 setzt einen Vergleichspunkt voraus; die
Beschreibung, dass Hiob seinen Mund öffnet (Hi 3,1), setzt einen deutlichen Kontrast zu dem
unmittelbar davor beschriebenen auf sieben Tage terminierten Schweigen Hiobs und seiner
Freunde (Hi 2,13); die schematisch gestaltete Einführung der Rede in Hi 3,2 durch ויאמר … ויען
»und … antwortete und sprach« ergibt nur Sinn als Erwiderung auf etwas Vorheriges. In den
weiteren Belegen dieser Redeeinleitung handelt es sich um eine Erwiderung auf die jeweils vo-
rangehende Rede (vgl. Hi 4,1 etc.), in Hi 3,2 handelt es sich (im vorliegenden Buch) um eine Er-
widerung auf sein und seiner Freunde Schweigen, auf seine und seiner Frau kurze(n) Rede(n),
handelt es sich schließlich um eine Reaktion auf sein in Hi 1 f. beschriebenes Ergehen insgesamt.
Dass » ענהantworten« hierfür ein auffälliger Begriff ist, hat bereits die Septuaginta gesehen und
das Wort entsprechend nicht übersetzt. Durch das Zusammenziehen von Hi 3,1.2 macht die Sep-
tuaginta aber erst recht deutlich, dass die danach folgende Rede das davor berichtete Ergehen
Hiobs voraussetzt: »(1) Danach öffnete Hiob seinen Mund (2) und verfluchte seinen Tag indem
er sprach« (μετὰ τοῦτο ἤνοιξεν Ἰὼβ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ κατηράσατο τὴν ἡμέραν αὐτοῦ λέγων).Anmerkungen zum chronologischen Verhältnis 79
ist Hi 42,7–10 dagegen kaum als notwendige Überleitung von der Hiobdichtung
zum Schluss der Hioberzählung zu qualifizieren: Nach den Gottesreden und der
damit gegebenen Gottesbegegnung Hiobs sind die Freunde Hiobs (genauso wie
im vorliegenden Buch der Satan und Hiobs Frau) eine quantité négligeable, er-
scheint ihre explizite Verurteilung durch Hi 42,7–10, die die Septuaginta durch
die Betonung der Sünde der Freunde nochmals steigert,50 aufgrund ihrer Margi-
nalisierung durch die (Elihu-Reden und die) Gottesreden schlicht unnötig. Der
Bericht von Hiobs Restitution der ursprünglichen Hioberzählung, Hi 42,11–17,
schließt (anders als Hi 42,7–10) auf jeden Fall gut an Hiobs Erwiderung an YHWH
in Hi *42,1–6 an.51 Auch in der unterschiedlichen Darstellung der Freunde un-
terscheiden sich Ein- und Ausleitung der Freunde: Hi 2,11–13 weist das negative
Freundesbild von Hi 42,7–10 nicht auf, vielmehr werden die Freunde hier als
mitleidend und mitfühlend dargestellt;52 dass ihr versuchter Trost (Hi 2,11) für
Hiob schließlich leidiger Trost ist, teilt ihnen Hiob selbst mit (Hi 16,2; 21,2.34).53
Eine theologische Fundamentalkritik wie in Hi 42,7–10 ist dies nicht. Es ist
daher zu erwägen, Ein- und Ausleitung der Freunde unterschiedlichen Autoren
zuzuweisen:54
Die mit der expliziten Verurteilung der Freunde einhergehende zusätzliche
Aufwertung Hiobs als erfolgreicher Fürbitter55 und »Knecht« YHWHs geht be-
zeichnenderweise mit der Charakterisierung Hiobs als »Knecht« YHWHs in den
beiden Himmelsszenen, aber an keiner weiteren Stelle im Buch, parallel (vgl.,
jeweils in YHWH-Rede, » עבדיmein Knecht« in Hi 1,8; 2,3; 42,7.8ter).56 Die beiden
Himmelsszenen dürften ihrerseits jünger als die ursprüngliche Hioberzählung,
50 Vgl. HiLXX 42,7 (vgl. TestHi 42,5[f.]), HiLXX 42,9 (vgl. 11QtgHi; TestHi 42,8 [vgl. TestHi 43,1.4.17])
und HiLXX 42,10. Hiermit wird gleichzeitig Hiob weiter hervorgehoben, um dessentwillen Gott die
Sünden der Freunde vergibt. Vgl. Bernd Janowski, »Sündenvergebung ›um Hiobs willen‹. Für-
bitte und Vergebung in 11QtgJob 38,2 f. und Hi 42,9 f. LXX«, ZNW 73 (1982) 251–280.
51 Zur Redaktions- und Theologiegeschichte der Gottesreden vgl. Jürgen van Oorschot, Gott
als Grenze. Eine literar- und redaktionsgeschichtliche Studie zu den Gottesreden des Hiobbuches,
BZAW 170 (Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1987).
52 Vgl. Oeming, »Dialoge«: 46–48; Vermeylen, Métamorphoses, 69–71; 75; 214 f.
53 Engljähringer, Theologie, 96 verweist darauf, dass sich Hiob in seinen Reden ab dem zweiten
Redegang auf unterschiedliche Weise stets auf Hi 2,11–13 bezieht.
54 Vgl. Rohde, Knecht, 120–123; Vermeylen, Métamorphoses, 69–71; 180–182 sowie, im Detail
deutlich anders als hier, Schmidt, De Deo, 169–177; Peter Weimar, »Literarkritisches zur Ijobno-
velle«, BN 12 (1980) 62–80: 63 f.; 70; 75 f. Damit soll hier »der am häufigsten vertretenen These zur
Genese von 2,11–13 und 42,7–9, daß beide Abschnitte als Verbindungstexte zwischen Erzählung
und Dichtung geschaffen worden seien« (Syring, Hiob, 111), widersprochen werden.
55 In Hi 42,8–10 ist Hiob Fürbitter, nicht aber derjenige, der das Opfer darbringt wie in Hi 1,5.
56 Zum inhaltlichen Zusammenhang und zur ähnlichen Strukturierung von Himmelsszenen
und Hi 42,7–10 vgl. auch Köhlmoos, Auge, 347 f.80 Walter Bührer
die aus Hi 1,1–5.13–22; 42,11–17 bestanden haben dürfte,57 sein:58 Die erste Him-
melsszene, Hi 1,6–12, ist ausweislich der Pronominalsuffixe in » ובניו ובנתיוseine
Söhne und seine Töchter« in Hi 1,13, die sich direkt auf Hi 1,4 f. zurückbeziehen,
nach Hi 1,12 inhaltlich jedoch ins Leere gehen, nachgetragen. Die literarkritische
Einschätzung wird durch den textgeschichtlichen Befund bestätigt, da die Sep-
tuaginta »Hiob« explizit hinzufügt (οἱ υἱοὶ Ἰὼβ καὶ αἱ θυγατέρες αὐτοῦ). Der Ein-
schub wird in Hi 1,6 (vgl. Hi 2,1) durch » ויהי היוםund es geschah eines Tages«
genauso eröffnet wie die ursprüngliche Fortsetzung von Hi 1,5 in Hi 1,13 ()ויהי היום.
Ist die erste Himmelsszene nachgetragen, muss es die darauf aufbauende zweite
Himmelsszene, Hi 2,1–8, ebenso sein. Da schließlich Hiobs Frau in ihrer kurzen
Rede sowohl YHWH (Hi 2,9aβ / Hi 2,3bα) als auch den Satan (Hi 2,9b / 1,11b; 2,5b)
zitiert, gehört auch Hi 2,9 f. zum Nachtrag.
Die beiden Himmelsszenen exkulpieren (mehr schlecht als recht)59 Gott ex-
plizit, während die ursprüngliche Hioberzählung YHWH klar als Urheber »all des
Schlechten« benennen kann, das über Hiob gekommen ist (Hi 42,11; vgl. Hi 1,21),
und die Hiobdichtung in den Gottesreden die Frage nach dem ungerechtfertigten
57 Da die Qualifikation Hiobs aus Hi 1,1b in den Himmelsszenen gerade zur Disposition gestellt,
seine Frömmigkeit hinterfragt wird (vgl. Hi 1,8bβ.9b; 2,3), muss der Vers, der keine literarischen
Bruchlinien aufweist, in Gänze als einheitlich betrachtet werden (vgl. Schmidt, De Deo, 166; 182;
Rohde, Knecht, 105). »Der Vers muss weiterhin schon immer zur Hioberzählung gehört haben,
weil sie nur sinnvoll ist, wenn es um das Leiden eines Gerechten geht« (Rudnig-Zelt, »Teufel«: 12,
Anm. 52). Ähnliches gilt für Hi 1,4 f.: Hier wird nach Hi 1,1 einerseits ein Beispiel für Hiobs Fröm-
migkeit geliefert (und durch die iterativen Verbformen als übliches Handeln Hiobs dargestellt),
und andererseits die Szenerie für die weitreichenden Verluste Hiobs in Hi 1,13–19 eingeführt (vgl.
Rohde, Knecht, 106 f.); dabei stellt Hiobs »stellvertretend[e]« »Opferprophylaxe« wohl »eine
theologische Absurdität« dar (Schmid, Hiob, 28), wird aber von der Erzählung positiv betrach-
tet – und von der Septuaginta in noch positiverem Licht dargestellt (vgl. Bührer, »Famille«, 293);
erst der Satan hinterfragt die Aufrichtigkeit von Hiobs Frömmigkeit (vgl. Hi 1,9–11). In Hi 1,20–22
bestätigt sich Hiobs Frömmigkeit, auch in seinem Leid; wie Hiobs Brüder, Schwestern und frü-
heren Bekannten gemäß Hi 42,11 wissen, von wem »all das Schlechte« stammt, das über Hiob
gekommen ist, weiß auch Hiob, dass niemand anderes denn YHWH »gibt« und »nimmt« (Hi 1,21;
zur Integrität dieses Verses vgl. auch Rohde, Knecht, 107–110; Rudnig-Zelt, »Teufel«: 12, Anm. 54).
In Hi 42,14 f. schließlich geht es nur vordergründig »um die märchenhafte Schönheit junger Mäd-
chen«, die »durch nichts in der Grundschicht motiviert« wäre (Ulrich Berges, »Der Ijobrahmen
[Ijob 1,1–2,10; 42,7–17]. Theologische Versuche angesichts unschuldigen Leidens«, BZ 39 [1995]
225–245: 233); vielmehr dienen auch diese Verse der Betonung von Hiobs Renommee (vgl. Büh-
rer, »Famille«, 295–297).
58 Vgl. zum Folgenden etwa Kuhl, »Literarkritik«: 195–198; Schmidt, De Deo, 166–168; Ludger
Schwienhorst-Schönberger und Georg Steins, »Zur Entstehung, Gestalt und Bedeutung der Ijob-
Erzählung (Ijob 1 f; 42)«, BZ 33 (1989) 1–24: 4–6; Rudnig-Zelt, »Teufel«: 13 f.; Witte, Buch Hiob,
80–82.
59 Vgl. Spieckermann, »Satanisierung«.Anmerkungen zum chronologischen Verhältnis 81 Leiden in einem größeren schöpfungstheologischen Kontext verortet. Die Him- melsszenen unterscheiden sich damit in ihrer Zielsetzung sowohl von der Hiob erzählung als auch von der Hiobdichtung. Beide sind dabei nicht auf die Him- melsszenen angewiesen – auch nicht Hi 2,11–13:60 »All das / dieses Schlechte« bezieht sich in Hi 2,11 ebenso wie in Hi 42,11, wonach Hi 2,11 gestaltet ist, auf die Verluste Hiobs in Hi 1,13–19 (oder lässt sich zumindest darauf beziehen). Dass die herannahenden Freunde Hiob von Ferne nicht erkennen können (Hi 2,12aα), bedeutet nicht, dass sie ihn aufgrund von Hiobs ihn entstellender Krankheit nicht identifizieren könnten, denn sie beklagen ihn ja sogleich (Hi 2,12aβb.13).61 Vielmehr geht es darum, dass der einst größte unter den Söhnen des Ostens (Hi 1,3b), der mit einer großen Familie und zahlreichen Reichtümern gesegnete Hiob (Hi 1,2.3a), nach dem Verlust all dessen nur mehr ein Schatten seines frühe- ren Selbst ist; wie später seine Frau in der erweiterten griechischen Fassung ihrer Rede in HiLXX 2,9b ihm mitteilt, ist »mit dem Tod seiner Kinder auch die Erinne- rung an ihn auf Erden ausgelöscht« (ἠφάνισταί σου τὸ μνημόσυνον ἀπὸ τῆς γῆς), ist »er mithin bereits jetzt den sozialen und kommemorativen Tod gestorben«, stellt »der leibliche Tod somit nur noch die logische Konsequenz« dar.62 Dass die Freunde sieben Tage und sieben Nächte nicht mit ihm reden (Hi 2,13), ist kaum mit physischen Schmerzen Hiobs infolge seiner Krankheit zu erklären; der »sehr groß 60 Anders als seine Schüler und Schülersschüler ordnet Kaiser, Buch, 115; 125 Hi 2,11–13 (»Buch- redaktor«) den Himmelsszenen (»späte Bearbeiter« / »späte Einfügung«) chronologisch vor, weist jedoch Hi 2,11–13 zusammen mit Hi 42,7–10 dem Buchredaktor zu (vgl. S. 127). In anderen Publikationen unterscheidet er in Hi 2 indes nicht zwischen dem Buchredaktor und späten Be- arbeitern (vgl. etwa Otto Kaiser, Der eine Gott Israels und die Mächte der Welt. Der Weg Gottes im Alten Testament vom Herrn seines Volkes zum Herrn der ganzen Welt, FRLANT 249 [Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013], 276). 61 Die Zusammenstellung von »Stimme Erheben« und »Weinen« ( ;ויׂשאו קולם ויבכוHi 2,12aβ; vgl. Gen 21,16; 27,38; 29,11; Num 14,1; Jdc 2,4; 21,2; I Sam 11,4; 24,17; 30,4; II Sam 3,32; 13,36; Ruth 1,9.14), von »Zerreißen des Obergewandes« ( ;ויקרעו איׁש מעלוHi 2,12bα; vgl. Hi 1,20; Esr 9,3.5) bzw. von »Zerreißen« von Kleidungsstücken allgemein (vgl. Gen 37,29.34; 44,13; Num 14,6; Jos 7,6; Jdc 11,35; I Sam 4,12; II Sam 1,2.11; 3,31; 13,19.31; 15,32; I Reg 21,27; II Reg 2,12; 5,7 f.; 6,30; 11,14; 18,37; 19,1; 22,11.19; Jes 36,22; 37,1; Jer 36,24; 41,5; Joel 2,13; II Chr 23,13; 34,19.27; Est 4,1) und von »Staub auf die Häupter Werfen gen Himmel« ( ;ויזרקו עפר על־ראׁשיהם הׁשמימהHi 2,12bβ; vgl., mit unterschiedlicher Diktion im Einzelnen, Jos 7,6; I Sam 4,12; II Sam 1,2; 13,19; 15,32; Ez 27,30; Thr 2,10; die Richtungsangabe » הׁשמימהgen Himmel« findet sich in den genannten Vergleichs- stellen sowie in HiLXX 2,12 nicht) zeigt hinreichend deutlich, dass es hier um Klagerituale, nicht aber um apotropäische Riten oder um eine rituelle Identifikation der Freunde mit Hiob geht (vgl. zu solchen Deutungen Seow, Job, 298 f.; 308 f.). An mehreren der genannten Vergleichsstellen ist zudem vom Aufenthalt der Klagenden auf dem Boden und / oder von ihrem Schweigen in Analogie zu Hi 2,13 die Rede, vgl. etwa Thr 2,10. 62 Walter Bührer, »›Ich will mir einen Namen machen!‹ Alttestamentliche und Altorientalische Verewigungsstrategien«, Bib. 98 (2017) 481–503: 489.
82 Walter Bührer
gewordene Schmerz« ( )גדל הכאב מאדHiobs in Hi 2,13 ist vielmehr im Sinne von
»Herzeleid (Jes 65,14) oder Seelenschmerz (Sir 4,6)«63 auf die Verluste Hiobs in
Hi 1,13–19 zu beziehen. Die »üblen Geschwüre von seiner Fußsohle bis zu seinem
Scheitel«, mit denen Hiob »geschlagen« wird (ויך את־איוב בׁשחין רע מכף רגלו עד
;קדקדוHi 2,7b), spielen in Hi 2,11–13 damit ebenso wenig eine Rolle wie in der
Hiobdichtung. Sie entstammen vielmehr dem Segens- und Fluchkatalog Dtn 28,
wonach YHWH den Ungehorsamen »mit üblen Geschwüren« »von der Fuß-
sohle bis zum Scheitel« »schlägt« (יככה יהוה בׁשחין רע על־הברכים ועל־הׁשקים אׁשר
; לא־תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדךDtn 28,35). Die zweite Himmelsszene »genera-
lisiert« damit die divergenten Verweise auf Hiobs Krankheit in der Hiobdichtung
und »spitzt« sie »auf eine extreme Erkrankung« Hiobs zu.64 Indem sie dies tut,
legitimiert sie vorderhand die kritischen Rückfragen der Freunde an Hiob in der
Hiobdichtung, da »Hiobs Erkrankung« aufgrund des Zitates von Dtn 28,35 »nach
ihrer äußeren Erscheinung auf Ungehorsam gegenüber den Geboten zurückge-
führt werden muß«,65 bereitet jedoch für die Leserinnen und Leser des Buches
die explizite Disqualifizierung der Freunde in Hi 42,7–10 bereits vor, da in Hi 2,7
im Unterschied zu Dtn 28,35 nicht ein Ungehorsamer von YHWH, sondern ein
überaus Frommer vom Satan »geschlagen« wird.
Trifft die Zuweisung von Hi 2,11–13 und Hi 42,7–10 an unterschiedliche Au
toren zu, gestaltete sich die Buchwerdung des Hiobbuches in folgenden Schrit-
ten:
Die ursprüngliche Hioberzählung, Hi 1,1–5.13–22; 42,11–17, handelt vom Segen,
Segensentzug und neu erlangten Segen des nicht-israelitischen YHWH-Verehrers
Hiob, der als überragender Frommer ein exemplum darstellt (vgl. Ez 14,13–23;
Jak 5,11) für einen gottgefälligen, weisen bzw. weisheitlichen Umgang mit Leid.
Da YHWH auch als Ursprung des Segensentzuges klar benannt wird (Hi 1,21;
42,11), und die Verluste Hiobs in Hi 1,13–19 auf YHWH als ihre Ursache durchsich-
tig sind,66 ist diese Erzählung mitnichten theologisch belanglos.67
Diese Lehrerzählung wird in einem zweiten Schritt um die ursprüngliche
Hiobdichtung erweitert, in der über das Woher, Warum und Wozu von Leid und
letztlich um die Gottheit Gottes gestritten wird. Die in den vorliegenden Anmer-
kungen nicht thematisierte Redaktionsgeschichte der Hiobdichtung zeigt, dass
63 Fohrer, Hiob, 285 (mit Bezug auf » כאבSchmerz« in Hi 16,6)
64 Heckl, Hiob, 350; vgl. 348–350.
65 Syring, Hiob, 86.
66 Auf jeden Fall weisen das »Feuer Gottes« ( )אׁש אלהיםin Hi 1,16 und der »große Wind, der
von jenseits der Wüste kommt« ( )רוח גדולה באה מעבר המדברin Hi 1,19 (vgl. etwa Ex 10,13; 14,21;
Hos 13,15; Jon 1,4; 4,8; Ps 48,8) auf einen göttlichen Ursprung hin.
67 Etwa gegen Spieckermann, »Satanisierung«: 82 f.; Schmid, Hiob, 14 f.Anmerkungen zum chronologischen Verhältnis 83
der Redebedarf hierzu nicht gering war.68 In die Hioberzählung eingebunden
wird die Hiobdichtung mittels der narrativen Einführung der drei Freunde Hiobs
in Hi 2,11–13 durch den Autor der Hiobdichtung.
In einem dritten Schritt wurde die Hioberzählung durch Hi 1,6–12; 2,1–10;
42,7–10 ergänzt. In diesen Texten wird Hiob noch näher an YHWH herangerückt,
so dass Hiobs Freunde explizit verurteilt werden müssen, wird YHWH (zumindest
vordergründig) exkulpiert, und wird den Leserinnen und Lesern des Hiobbuches
die Erklärung des Hiobproblems von Anfang an mitgeteilt. Gelöst ist es damit
freilich nicht.69
Abstract: In the first part, the paper critically evaluates the increasingly advo-
cated thesis of the independence of the poetic parts of the Book of Job from its
narrative parts and evaluates it as improbable. The second part offers a brief
redaction-critical analysis of the narrative parts of the Book of Job in order to
present the main stages of the formation of the Book of Job: The original narrative
was expanded in a second step by Job 2:11–13 and the original poetic parts of the
Book of Job, and in a third step by Job 1:6–12, 2:1–10, 42:7–10.
Keywords: Book of Job, prose tale of Job, poetic parts of Job, Job 2:11–13, Job 42:7–10
Zusammenfassung: Der Aufsatz evaluiert im ersten Teil die zunehmend vertre-
tene These der Eigenständigkeit der Hiobdichtung gegenüber der Hioberzählung
kritisch und bewertet sie als unwahrscheinlich. Der zweite Teil bietet eine knappe
redaktionsgeschichtliche Analyse der Hioberzählung, um die Grundzüge der
Buchwerdung des Hiobbuches darzustellen: Die ursprüngliche Hioberzählung
wurde in einem zweiten Schritt um Hi 2,11–13 und die ursprüngliche Hiobdichtung
erweitert und in einem dritten Schritt durch Hi 1,6–12; 2,1–10; 42,7–10 ergänzt.
Schlagwörter: Buch Hiob, Hioberzählung, Hiobdichtung, Hi 2,11–13, Hi 42,7–10
Résumé: Dans la première partie, l’article examine la thèse – de plus en plus ré-
pandue – de l’indépendance des parties poétiques du livre de Job par rapport au
cadre narratif de Job et l’évalue comme improbable. La deuxième partie offre une
analyse rédactionnelle de la narration du livre de Job afin de présenter les prin-
cipales étapes de la formation du livre: la narration originale de Job a été élargi
68 Entscheidende Impulse für die Bearbeitung der Redaktions- und Theologiegeschichte der
Hiobdichtung hat Witte ausgehend von einer Analyse des sog. dritten Redeganges geliefert. Vgl.
Witte, Leiden; Ders., Buch Hiob, bes. 45–59.
69 Vgl. Spieckermann, »Satanisierung«: 92.Sie können auch lesen