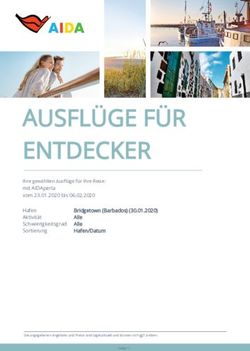Anti-Bias-Ansatz im Elementarbereich - Prof. Dr. Steffen Brockmann 24.05.2021 - Soke eV
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Entstehungsgeschichte des Ansatzes In den 80er Jahren wurde der Ansatz für das frühpädagogische Arbeitsfeld u.a. von Louise Derman-Sparks entwickelt Bedeutung der Sensibilisierung von pädagogischem Fachpersonal Sowohl in der Arbeit mit Kindern, wie auch Erwachsenen hat der Anti-Bias-Ansatz Bedeutung In den 90er Jahren wird der Ansatz in Südafrika weiterentwickelt In den 2000ern kommt er nach Deutschland. (vgl. Schmidt 2009) In einigen Bundesländern in das Curriculum der Ausbildung zur Erzieher*in verankert
Was ist Anti-Bias-Arbeit? Bias: Vorurteile/ Einseitigkeiten - Ansatz der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung „Alle Kinder sind gleich. Jedes Kind ist verschieden.“ (KiWe o.J.) Der Elementarbereich besitzt gegenüber anderen Bildungsbereichen (auch zur Hochschule) für eine inklusive / diversitätsbewusste Pädagogik bessere Voraussetzungen
Aspekte von Vielfalt / Differenzlinien sind: Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Religion, Geschlecht, sozial-ökonomischer Status, sexuelle Orientierung, Alter und Behinderung/Beeinträchtigungen (Wagner 2017, S. 28ff.) Aspekte von Vielfalt / Differenzlinien werden in ihrem Wirkungszusammenhang gedacht Intersektionalität
Anti-Bias-Ansatz ist demokratischen, menschen- und kinderrechtlichen Forderungen verpflichtet Das Gegenteil von Diskriminierungen sind Privilegien Machtkritischer Ansatz (Schmidt 2010) Machtkritik beinhaltet auch eine Kritik an Adultzentrismus (Liebel 2020)
Es gibt keine neutrale Pädagogik (Freire 1998) Berücksichtigt die politische Dimension von Bildung und entwirft gemeinsam Vorstellung einer gerechten und demokratischen Gesellschaft in der Kinder mit ihren Lebenswelten anerkannt werden (Derman Sparks 2020; Freire 2017)
Ziel 1: Alle Kinder in ihren Identitäten stärken Ziel 2: Allen Kindern Erfahrungen mit Vielfalt ermöglichen Ziel 3: Kritisches Denken über Gerechtigkeit und Fairness anregen Ziel 4: Aktiv werden gegen Unrecht und Diskriminierungen (Wagner 2017, S.30f.).
Widerstände / Schwierigkeiten bei der Umsetzung Eigene Erfahrungen mit Aussagen von Fachkräften bei Vorträgen und Fort- Weiterbildungen, warum sie Anti-Bias-Arbeit nicht umsetzen können/ wollen: „Bei uns sind alle Kinder gleich“ „Das machen wir schon alles“ „Wie sollen wir das bei den Rahmenbedingungen machen und vor allem wann?“
„Bei uns sind alle Kinder gleich“ In einer eigen Forschungsarbeit im Elementarbereich wurden folgende sozial konstruierte Differenzlinien von Kindern (4 -6 Jahre) herausgearbeitet: Familienkultur, Religion, Sprache, Alter, Fähigkeiten, Beeinträchtigungen / Behinderungen, Ethnie, Krankheiten/ Allergien, sexuelle Orientierung, Körpergewicht, Aussehen, Gender und soziale Klasse Darüber hinaus entfalten emotionale Kontrolle und Spielideen eine große Wirkung (Brockmann 2019). Identität
Beelmann und Raabe kommen nach einer Meta-Analyse in der sie 113 internationale Studien zur Entwicklung von Vorurteilen von Kindern der letzten 90 Jahre ausgewertet haben zu dem Schluss, dass sich schon Vorurteile in der Altersgruppe der 2-4 jährigen Vorurteile feststellen lassen (Beelmann und Raabe 2011) Vor-Vorurteile (Derman – Sparks 2020)
Unterschiedliche Ebenen die beachtet werden müssen: Einstellungen und Haltungen (Mikroebene) Material etc. (Mesoebene) Gesamtgesellschaftliche Strukturen / institutionelle Strukturen (Makroebene) Mit dem Ziel allen Kindern in der Einrichtung ein gutes aufwachsen zu ermöglichen ohne Höherwertigkeits- und Minderwertigkeitvorstellungen zu fördern (Derman-Sparks 2020) Empowerment von Kindern
„Das machen wir schon alles“ Ziel 1: Alle Kinder in ihren Identitäten stärken Qualitätsmerkmale für dieses Ziel sind u.a.: Pädagogische Fachkräfte achten darauf, dass der Name jedes Kind korrekt ausgesprochen wird (ISTA 2016, S. 25) Pädagogische Fachkräfte achten bei der Materialauswahl darauf, dass die Aspekte der sozialen Wirklichkeit repräsentiert werden (Wohnung, Hautfarben etc.) und die Lebenswelten der Kinder korrekt wiedergegeben werden (ebd., S. 26)
Darstellungen von Familien in Büchern Unterschied zwischen Geburtsort der Eltern, Geburtsort der Großeltern und Kinder (ebd., S. 27). Beispiel Praxisbesuch
Pädagogische Fachkräfte sorgen dafür, dass die Familiensprachen und Dialekte der Kinder im Alltag zu hören und zu sehen sind Pädagogische Fachkräfte helfen Kindern bei der Eingewöhnung, indem sie Rituale von Zuhause übernehmen, wie z.B. beim Essen und Einschlafen.“ (ISTA 2016, S. 25) Beispiel Film
„Spurensuchen“ Spuren der Kinder in der Einrichtung mit einer Kamera festhalten (KiWe o.J.) Reflexionsfragen aus den Bildungs- und Lerngeschichten: Kann ich dir vertrauen? Kennst du meine Interessen? Gibst du mir Gelegenheit und ermunterst mich, mich in etwas zu vertiefen? Hörst du mir zu? Auf welche Art und Weise unterstützt Du meine Bemühungen, Teil der Gruppe zu sein? (Leu et al. 2007)
Ziel 2: Allen Kindern Erfahrungen mit Vielfalt ermöglichen Fachkräfte thematisieren besonders mit den jüngeren Kindern die Unterschiede, in Bezug auf ihren Körper, ihre Familien und Übergangsobjekte und bieten sachlich korrekte Beschreibungen an Spielmaterialien, Bücher und Ausstattung spiegelt die soziale Vielfalt der Gruppe wieder (ISTA 2016, S. 31f.). Familienkulturen
Familienwände ein konfliktreiches Thema Eigene Identitätsentwürfe von Kindern ernstnehmen Beispiel Marwin Familienwände Familienwände über den Betten, um Sicherheit zu geben, allerdings kann auch das Gegenteil erreicht werden (Brockmann 2014)
Derman Sparks verweist auf die Gefahr sozialer Vielfalt nur durch eine Puppe oder durch einseitigen Darstellungen von Menschen mit Behinderungen/ besonderen Bedürfnissen aufzugreifen (Derman Sparks 2020). „Alibidarstellungen“
Familienmemory (mit den Familien der Einrichtung) Fotos von Ohren der Kinder/ bei jüngeren Kindern die Hände Mobiles mit Spiegeln und Fotos der Kinder aus der Gruppe Der Raum und das Material als dritte/r Erzieher*in, unter Berücksichtigung von der Bedeutung der Interaktion zwischen Kindern und Kindern und Fachkräften für Bildungsprozesse
Raum für Eltern schaffen in dem sie sich über unterschiedliche Erziehungsvorstellungen austauschen können Eltern daran beteiligen das Kinder Erfahrungen mit Vielfalt machen (ISTA 2016, S. 33f.) Vorsicht vor dem interkulturellen Frühstück: Beispiel A. Kalpaka (2010) Eigenes Beispiel türkisches Essen auf dem Familienfest in der Kita
Bezogen auf das Team: Fachkräfte überlegen wie sie die Unterschiede im Team nutzen können, um Kindern Erfahrungen mit sozialer Vielfalt zu ermöglichen Gefahr der Reduzierung auf Vielfaltsaspekte Fachkräfte reflektieren welche Vielfaltsaspekte sie leicht mit Kindern besprechen können und bei welchen sie sich schwer tun Fachkräfte machen sich die Auswirkungen einer abwertenden Sprache über Kinder und Familien bewusst und vermeiden Familien als „anders“ / „Andersartig“ zu bezeichnen (ISTA 2016, S.34f.)
Ziel 3: Kritisches Nachdenken über Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen, folkloristische / touristische Darstellungen und Einseitigkeiten Fachkräfte (ggf. mit den Kindern zusammen, je nach Entwicklungsstand) überprüfen die verwenden Materialen danach welche Gruppen fehlen oder Stereotyp (folkloristisch, schwach, hilfsbedürftig) dargestellt werden Fachkräfte überprüfen Kinderlieder, Reime, Spiele auf stereotype / folkloristische / rassistische Darstellungen.
Fachkräfte suchen mit Kindern eine gemeinsame Sprache um Ungerechtigkeiten zu thematisieren Fachkräfte üben mit Kindern ihre Absichten und Anliegen auszudrücken ohne andere Kinder abzuwerten Fachkräfte geben positive Rückmeldungen, wenn Kinder prosoziales Verhalten zeigen Fachkräfte bewerten es nicht als „Petzen“, wenn sich Kinder Unterstützung holen (ISTA 2016, S. 38) Kritisches Nachdenken über stereotype Vorstellungen im Team Beispiele von muslimischen Studierenden an der Ev. Fachschule für Sozialpädagogik
Ziel 4: Vorgehen gegen Ungerechtigkeiten/ Einseitigkeiten Fachkräfte suchen Geschichten und Beispiele in denen Widerstand gegen Ungerechtigkeiten geleistet wird Fachkräfte stellen mit den Kindern sachlich korrekte / gerechte Materialien her. Beispiel Barbiepuppen (Preissing/ Wagner 2003) Fachkräfte greifen bei Ungerechtigkeiten/ Ausgrenzungen etc. ein und thematisieren diese ohne die betroffenen Kinder zu beschämen (ISTA 2016, S. 43) Entwickeln mit Kindern Handlungsstrategien gegen Ausgrenzung
Ebene Team: Fachkräfte reflektieren ihre eigenen Erfahrungen mit Widerstand und welche Botschaften sie als Kind zum Thema Widerstand erhalten haben Fachkräfte trainieren ihre Handlungsstrategien um bei Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen zu intervenieren Sie machen sich im Team gegenseitig auf abwertende Äußerungen aufmerksam, gehen fehlerfreundlich miteinander um Sie feiern ihre Erfolge und gelungenen Aktivitäten (ISTA 2016, S. 46)
„Wie sollen wir das bei den Rahmenbedingungen machen und vor allem wann?“ Diverstätsbewusstsein als zusätzliche Reflexionsschleife im pädagogischen Denken und Handeln (Leiprecht 2011) Qualitätsmerkmal guter pädagogischer Arbeit z.B. in der KRIPS-RZ und KES-E Zur Erinnerung: Es gibt keine neutrale Pädagogik! (Freire 1998) Die Frage ist: In was für einer Gesellschaft möchten wir leben? Wie wichtig ist für uns der Bildungsbereich Soziale Gerechtigkeit und das Leben in einer friedvollen Gesellschaft? Welche Räume und Unterstützungen können und wollen Träger leisten? Sinnvoll den Organisationsentwicklungsprozess begleiten zu lassen.
Vielen Dank!
Beelmann, Andreas / Raabe, Tobias (2011): Development of ethnic, racial, and na-tional prejudice in childhood and adolescence: A multinational meta-analysis of age differences. Child Development. Volume 82(6). S. 1715-1737. Brockmann, Steffen (2019): Diversitätsbewusstes Denken und Handeln in Kindertageseinrichtungen- Interviews und Interviewstreifzüge. In: Hedderich, Ingeborg et al.(Hrsg.): Perspektiven auf Vielfalt in der frühen Kindheit – Mit Kindern Diversität erforschen. Julius Klinkhardt Verlag. Bad Heilbrunn. Derman-Sparks, Louise / Olsen Edwards, Julie / Goins, Catherine (2020, 2. Aufl.); Anti-Bias- Educaction for Young Childen and Ourselves. NAEYC. Washington. Derman-Sparks, Louise / Ramsey, Patricia (2006): What if all the kids are white? Anti-Bias multicultural education with young children and families. Teachers College Press. New York and London. Faundez, A. & Freire, P. (2013). Por una Pedagogía de la Pregunta. México D.F. Siglo Veintiuno. www.th-nuernberg.de Seite 32
Feagin, Joe / Van Ausdale, Debra (2002): The first r. How children learn race and racism. Rowan & Littelfield Publishers. New York. Freire, Paulo (2017). Pedagogía de la Esperanza. México D.F. Siglo Veintiuno. Freire, Paulo (1998): Pädagogik der Unterdrückten. Rororo. Reinbeck bei Hamburg. Liebel, Manfred (2020): Unerhört. Kinder und Macht. Beltz Juventa. Weinheim / Basel. Mac Naughton, Glenda / Hughes, Patrick (2011, 2. Aufl.): Doing action research in early childhood studies. Open University Press. Berkshire. Piaget, Jean / Weil, Anne-Marie (1951): Wie sich bei Kindern die Vorstellung vom Heimatland und Ausland entwickelt. In: Karsten, Anitra (Hrsg.): (1978): Vorurteile: Ergebnisse Psychologischer und Sozialpsychologischer Forschung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt. S. 98-119. Preissing, Christa / Wagner, Petra (Hrsg.) (2003): Kleine Kinder, keine Vorurteile? Interkulturelle und vorurteilsbewusste Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Freiburg. Herder. www.th-nuernberg.de Seite 33
Rodgers, Diane (2020): Children in social movements. Routledge. London / New York. Schmidt, Bettina (2009): Den Anti-Bias-Ansatz zur Diskussion stellen. BIS. Oldenburg. Trisch, Oliver (2013): Der Anti-Bias-Ansatz. Beiträge zur theoretischen Fundierung und Professionalisierung der Praxis. Ibidem. Stuttgart. Institut für den Situationsansatz / Fachstelle Kinderwelten (Hrsg.) (2016): Qualitätshandbuch für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung in Kitas. Eigenverlag. Berlin. Wagner, Petra (Hrsg.) (2017): Handbuch Inklusion. Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung, Herder. Freiburg. Wagner, Petra (Hrsg.) (2008): Handbuch Kinderwelten. Vielfalt als Chance - Grundlagen einer vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung. Herder. Freiburg. www.th-nuernberg.de Seite 34
Sie können auch lesen