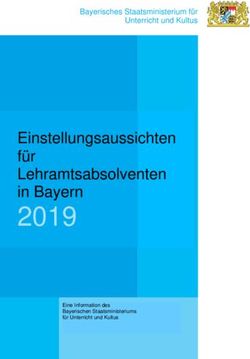Attersee - Schiffs-Agentur Schweiz
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Attersee
Geschichte der Schifffahrt
Der Attersee ist mit 47 Quadratkilometern Fläche, einer Länge von 20 km, einer Breite von
zwei bis drei km und einer Tiefe bis zu 171 m der grösste zur Gänze im Land liegende
Binnensee Österreichs. Im Süden wird er von den wildromantischen Felsenwänden des
Höllengebirges (1862 m) und des Schafbergs (1783 m), im Westen und im Osten von den
bewaldeten Bergen der Voralpen und im Norden vom Hügelland des Alpenvorlandes
umgeben. Der Attersee bildet das Endglied einer Kette von Seen, die im Südwesten mit dem
Fuschlsee und im Nordwesten mit dem Irrsee beginnt. Das Wasser aus beiden Seen fliesst
in den Mondsee und von diesem wieder über die 4 km lange Ache in den Attersee. Das
Wasser des Attersee’s wiederum fliesst über die Ager in die Traun, welche dann bei Enns in
die Donau mündet.
Der Name des Sees stammt vom vorkeltischen Wort ata oder ada, was soviel wie Wasser
bedeutet. Früher wurde der Attersee gelegentlich – heute nur mehr selten – auch als
Kammersee, abgeleitet vom Schloss Kammer und dem Kammergut, bezeichnet.
Das Attersee-Gebiet war schon in der Jungsteinzeit besiedelt. Die ältesten entdeckten
Pfahlbauten sowie Funde aus Keramik und Bronzestammen aus der Zeit von 4000 bis 3000
vor Christus. Seither war das Seengebiet ständig besiedelt. Ab 2011 gehören die Fundorte
Abtsdorf und Litzlberg Süd zur grenzübergreifenden UNESCO-Weltkulturerbe-Stätte
„Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“. Die Römer schätzten den Attersee als
Erholungsgebiet, wovon zahlreiche Relikte römischer Villen Zeugnis ablegen. Auch heute
ist er ein beliebtes Urlaubsgebiet. Neben der landschaftlichen Vielfalt beeindruckt er bei
schönem Wetter auch durch die türkisblaue Farbe seines Wassers. Zahlreiche Prominente
verbringen ihren Urlaub am Attersee. Gustav Klimt ist fast jeden Sommer in Seewalchen am
Attersee (heute Sitz eines Klimt-Museums) und auch Gustav Mahler verbringt seine Sommer
jahrelang in Steinbach am Attersee. Hier komponiert er in seinem heute noch bestehenden
kleinen Komponierhäuschen. Auch Franz Karl Ginzkey, Johannes Brahms, Gottfried Keller,
Hugo Wolf sowie die damals bekannte Burgschauspielrinnen Hedwig Bleibtreu und Charlotte
Wolter sind Sommergäste am Attersee. Hier schreibt 1922 – inspiriert durch die Eindrücke
vom Hochsitz das Jagdreviers oberhalb von Unterach – Felix Salten die Tiergeschichte vom
Reh Bambi, die dann Walt Disney zum Kinowelterfolg machte. Der See befindet sich heute
im Besitz der österreichischen Bundesforste.
Bei einer so nachhaltigen Besiedelung des Seengebietes war es selbstverständlich, dass auf
dem Wasser ein reger Schiffsverkehr mit Einbäumen, Ruderbooten und Flössen herrschte.
Über den See wurden Personen und vor allem Güter befördert. Heute dominieren die
zahlreichen privaten Boote - insbesondere Segelbooten – der Urlauber. Seit 1869/1870
existiert auch ein öffentlicher Personenschiffsverkehr, der Gegenstand des vorliegenden
Berichts ist 1.
1
Der folgende Bericht stützt sich für die Zeit von 1869/70 bis 1965 auf eine nicht veröffentlichte ausführliche
„Chronik der Schifffahrt auf dem Attersee nach Erzählungen alter Leute, eigenen Erlebnissen und noch
vorhandenen Archivunterlagen“ von Bahnrat i.R. Paul Römer. Der Zeitabschnitt nach 1965 wurde nach eigenen
Recherchen - nicht zuletzt mit Unterstützung des erst vor einigen Jahren pensionierten Kapitän Köbrunner -
zusammengestellt.
1Attersee
DIE GRÜNDUNG DER „1. KONZESSIONIERTEN ATTERSEE-DAMPFSCHIFFAHRT“
Im Jahr 1869 gründet Graf Khevenhüller-Frankenburg, Besitzer der Herrschaft Kammer, den
ersten Schifffahrtsbetrieb auf dem Attersee. Schon im Februar 1969 stellt er den von der
Linzer Ignaz-Mayer-Werft gebauten und etwas über 15 m langen Schraubendampfer Ida in
Dienst. Ihm folgt im Jahr 1870 aus der gleichen Werft der Schaufelraddampfer Attersee mit
einer Tragfähigkeit von 258 Personen und im Jahr 1872 der ähnliche Schaufelraddampfer
Kammer für 238 Personen. Im gleichen Jahr (1872) verkauft Graf Khevenhüller die „Ida“
wegen zu geringer Leistung der englischen Dampfmaschine an den Mondsee. Die
Dampfschiffe dienen nicht nur dem Personenverkehr, sondern befördern auch Stückgut und
remorquieren die antriebslosen Plätten der Seefrächter. Während die „Attersee“ befriedigt,
erweist sich die „Kammer“ als sehr labil und kann nie voll ausgefahren werden.
Im Jahr 1887 erlischt der Mannesstamm der Khevenhüller-Frankenburg. Die Schifffahrt
übernimmt Ida v. Horvath von der weiblichen Seitenlinie des gräflichen Geschlechts. Diese
muss sie jedoch bald darauf wegen erheblicher Schulden an den Wiener Seidenhändler
Ferdinand(o) Peratoner verkaufen. Bei Graf Khevenhüller trug die Kammer zeitweise auch
den Namen Weissenbach. Bei Ida v. Horvath lief sie jedoch wieder als Kammer.
Der neue Schifffahrtsbesitzer übernimmt beide Dampfschiffe, gibt ihnen jedoch als
kaisertreuer Bürger neue Namen aus dem Geschlecht der Habsburger. Das Dampfschiff
Attersee heisst nun „Franz Ferdinand“, das Dampfschiff Kammer nun „Alma“.
Schliesslich beschafft Peratoner bei der Schiffswerft Linz im Jahr 1894 noch einen
Schraubendampfer für 48 Personen, dem er den Namen „Hubert Salvator“ gibt. Dieser muss
zu Beginn des ersten Weltkriegs wegen des zu hohen Kohlenverbrauchs ausser Dienst
genommen werden. Der Rumpf erweist sich aber als langlebig: Er wird 1924 an die
Kalkwerke am Traunsee verkauft, erhält dort 1934 einen Dieselmotor und ist bis zur
Schliessung der Kalkwerke im Jahr 1968 als Kalktransportschiff im Einsatz. Danach erwirbt
ihn der Seefrächter Enichlmayer, der erst 1978 das Schiff abwrackt.
DIE GRÜNDUNG DER „ELEKTRO-SCHIFFAHRTSUNTERNEHMUNG AM ATTERSEE“
Bald tritt die Konkurrenz auf den Plan. Die in Gmunden am Traunsee ansässige Firma Stern
& Hafferl baut nicht nur schmalspurige Lokalbahnen im Salzkammergut (LB Attersee-
Vöcklamarkt, Vorchdorf - Gmunden, Gmundner Strassenbahn), sondern steigt auch in das
Schifffahrtsgeschäft ein. Sie gründet im Winter 1912/1913 ein eigenes Elektro-Schifffahrts-
Unternehmen und beschafft dafür bei der angesehenen deutschen Werft Lürssen in Vegesak
zwei Elektroboote mit einer Tragfähigkeit von 120 Personen mit denen sie im Sommer 1913
den Betrieb aufnimmt.
Während das eine Elektroboot bis zu seiner Ausmusterung den Namen „Attergau“ behält,
trägt das zweite im Laufe seines Lebens vier Namen. Zunächst als „Baron Handel“
bezeichnet, heisst es ab 1920 wegen Abschaffung der Adelstitel nur mehr „Handel“. Nach
dem Anschluss Österreichs an das Dritte Reich wird es aus politischen Gründen in
„Heimatgau“ umbenannt. Nach dem Kriegsende 1945 wechselt es erneut den Namen. Es
2Attersee
heisst nun bis zu seinem Ausscheiden „Burgau“. In Attersee entsteht eine hölzerne
Schiffshüte mit zwei Liegeplätzen für die beiden Elektroboote und eine Ladestation zum
Aufladen der Batterien.
DAS LANGSAME STERBEN DER „1. KONZESSIONIERTEN ATTERSEE-
DAMPFSCHIFFAHRT
Ab 1914 verschlechtert sich die Wirtschaftlichkeit der Dampfschifffahrt immer stärker: Die
Kohlenpreise steigen an. Die Seefrächter motorisieren ihre Plätten2. Damit endet das
Schleppen der bis dahin antriebslosen Plätten durch die Dampfer. Auch Teile des
Stückgutverkehrs wandern durch die zunehmende Zahl von Lastwagen auf die Strasse ab.
Schliesslich macht sich die Konkurrenz der Elektroschifffahrt immer stärker bemerkbar.
Im Jahr 1916 stirbt der Schifffahrtseigner Peratoner. Die Dampfschifffahrt führen nun seine
beiden Töchter weiter. Um wirtschaftlicher fahren zu können und der Konkurrenz Paroli zu
bieten, wird im gleichen Jahr bei der Firma Ratz in St. Gilgen das nur für 20 Personen
zugelassene Benzinmotorboot Möve und bei der Linzer Schiffswerft das 30-Benzinmotorboot
Weissenbach angeschafft, mit dem auch etwas Stückgut und Post befördert werden kann.
Mit der „Möve“ wird im oberen Sehbecken ein Dreiecksverkehr Kammer-Litzlberg-Attersee-
Weyregg-Kammer eingeführt. Die „Weissenbach“ besorgt im Winter den Liniendienst. Beide
Motorboote bewähren sich nicht und fahren nur 1917, also nur eine Saison.
Nach dem Ende der Monarchie erfährt der früher als „Attersee“ und dann als „Franz
Ferdinand“ bezeichnete Schaufelraddampfer seine dritte Umbenennung. Der Name des
Habsburger Erzherzogs ist nun nicht mehr erwünscht, das Schiff wird auf Forderung des
Arbeiterrates in „Unterach“ umgetauft.
EINE BETRÜGER AUFGESESSEN
Nach Kriegsende kauft ein dubioser rumänischer Händler gemeinsam mit dem Traunsee-
Dampfschiff Sophie die „Alma“. Er lässt die Maschinen der beiden Schiffe sofort
abtransportieren. Die Schiffsrümpfe sollten am Wasserweg nach Linz gebracht und dort
übergeben werden, wo der Käufer dann auch den Kaufpreis begleichen wollte. Doch erweist
sich der Transport auf dem Wasserweg unmöglich, so dass sowohl die Attersee- wie auch
die Traunsee Schifffahrtsgesellschaft kein Geld erhält, sondern auf den Rümpfen „sitzen“
bleibt. Man ist einem Betrüger aufgesessen, die „Alma“ steht ohne Maschine in Kammer und
muss abgebrochen werden.
EIN BESITZERWECHSEL
1921 kauft der mährische Industrielle Rudolf Randa, der sich auch in Oberösterreich
betätigen will, von den beiden Peratoner-Töchtern die Dampfschifffahrt, d.h. den einen noch
vorhandenen Dampfer Unterach und die Liegenschaft in Kammer. Um noch ein zweites
Schiff zur Verfügung zu haben, mietet er im Jahr 1921 zunächst vom Traunsee den 64-
2Plätten sind kiellose, weitgehend kastenförmige hölzerne Arbeitsschiffe, die früher per Ruder oder per Segel,
später dann mit Hilfe von Dieselmotoren fortbewegt wurden.
3Attersee
Personen-Schraubendampfer Maria Valerie. Erbaut 1895 bei der Dampfschiff- &
Maschinebauanstalt Dresden, ist er das erste Schiff mit einem Stahlrumpf am Attersee und
heisst hier nur mehr „Valerie“. Wenig später kauft er das Schiff. Leider steigt die
Wirtschaftlichkeit nicht im erwarteten Umfang, macht sich doch die Konkurrenz der
Elektroboote immer stärker bemerkbar.
ABER AUCH WENIG GLÜCKLICHE JAHRE DER ELEKTROSCHIFFFAHRT
Auch Stern & Hafferl will ein weiteres Schiff. Die Firma erwirbt einen alten verrosteten
kleinen Schraubendampfer für 25 Personen mit einem Ruderstand am Heck. Aus der
unteren Save stammend, kommt er im Verlauf der Kriegswirren nach Österreic.Seine
Instandsetzung erfolgt in der Stern & Hafferl-Werkstätte Gmunden. Im Jahr 1923 wird er als
Dampfschiff Burgau in Betrieb gesetzt. Wegen der grossen Rauchentwicklung und des
Funkenflugs erhält er sehr rasch von den Bewohnern der Seeorte den Spitznamen
„Feuerspeiender Berg“. Doch schon nach wenigen Monaten Dienst muss er wegen
schwerer Rohrbrüche und Kesselschäden verschrottet werden.
Ein grosses Unglück ereignet sich bei der Elektroschifffahrt im Frühjahr 1922: Nach der
Firmung bricht in Unterach der Landungssteg unter der Last der wartenden Fahrgäste – vor
allem Firmlinge und deren Angehörige - zusammen. Drei Tote und viele Verletzte sind zu
beklagen.
Ein zweiter tragischer Unfall folgt am 17.9.1923. Nach durchzechter Nacht schlafen der
Matrose im WC und der Schiffsführer im Steuerhaus eines Elektrobootes ein. Führerlos prallt
das Schiff mit voller Wucht gegen die Insel Litzlberg. Während der Schiffsführer den
Schaden von Land aus besichtigt, packt den Matrosen das heulende Elend. Er schneidet
sich die Kehle durch und stirbt. Dem einzigen Fahrgast geschieht nichts.
DIE FUSION DER BEIDEN UNTERNEHMEN
Neben diesen unerfreulichen Vorkommnissen ist im Jahr 1923 aber auch ein erfreuliches
Ereignis zu verzeichnen. Ing. Stern gelingt es nämlich, mit Herrn Randa einen Kaufvertrag
bezüglich der Dampfschifffahrt abzuschliessen. Die „Unterach“ und die „Valerie“ gehen
schon im Sommer 1923, die Liegenschaft im Februar 1924 in den Besitz von Stern & Hafferl
über. Leider verbleibt die Villa des bisherigen Besitzers mit der darin eingerichteten
Schlosserwerkstätte in dessen Besitz.
RUHIGE ZEITEN BIS ZUM BEGINN DES 2. WELTKRIREGES
Die Konkurrenzsituation mit ihren negativen Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des
Betriebs ist nun beendet. Das Dampfschiff Valerie wird allerdings öfter defekt und hat einen
ausserordentlich hohen Kohlenverbrauch. Deshalb stellt Stern & Hafferl das Schiff 1928
ausser Dienst, holt es in Attersee auf Land und verkauft den Kessel und die Maschine an
einen Altwarenhändler. Der geplante Einbau eines Holzgasmotors erweist sich jedoch als
nicht realisierbar. Da der Schiffskörper nicht gegen Rost geschützt ist, muss er schliesslich
anfangs der 30-er Jahre ebenfalls an einen Alteisenhändler verkauft werden. Dieser bezahlt
jedoch nie, weil er nach Abholung der letzten Fuhre Schrott in Konkurs geht.
4Attersee
Als Ersatz kommt 1929 ein kleiner Mahagoni-Bootskörper auf den Attersee. Stern & Hafferl
hatte vor dem ersten Weltkrieg im Jahr 1911 auf dem ebenfalls in Österreich gelegenen
Wallersee eine Schifffahrt eröffnet. Zum Einsatz kommt das bei der Bootswerft Rambeck in
Starnberg erbaute 28-Personen-Elektroboot Wallersee. Der Betrieb ruht während der
Kriegsjahre und wird nach dem Kriegsende 1918 nicht mehr wieder aufgenommen. Die
„Wallersee“ kommt an den Attersee, erhält einen Dieselmotor und kommt als „Attersee“ in
Fahrt. Die Vibrationen des Dieselmotors tun aber dem für einen ruhigen Elektroantrieb
gebauten Schiffskörper nicht sehr gut und führen zu einer „rumpligen“ Fahrweise. Die
Vibrationen sind so stark, dass einmal sogar Eier zerbrechen, die eine Bäuerin in einer Trage
mitführt. Deshalb steht das Motorboot nur von 1929 bis 1932 (oder 1934?) in Betrieb. Dann
zerspringt der Motorblock. Das Boot wird aus dem Wasser gehoben und zunächst in der
Schiffshüte – die man 1929 eigens für dieses Schiff an der ursprünglichen Schiffshütte
angebaut hat – aufgezogen. Nach dem Eintreffen der neuen Hochlecken im Jahr 1941 an
Land im Freien abgestellt, erwirbt im Jahr 1947 Karl Eder vom Traunsee den Rumpf. Er baut
ihn zur „Erika“ um und beginnt damit einen neuen Schifffahrtsbetrieb. Das Schiff bleibt bis
1973 in Betrieb, wird dann versenkt und liegt seither in ca. 60 m Tiefe beim ehemaligen
Kalkwerk im Traunsee.
Die Beförderungszahlen steigen im Lauf der Jahrzehnte kontinuierlich an. Wurden 1913 von
der Elektroschifffahrt noch rund 28.000 Personen befördert, benutzten 1937 bereits 46.000
Fahrgäste die Schiffe am Attersee.
Nach dem Anschluss Österreichs an das Dritte Reich im Jahr 1938 nimmt die
Fahrgastfrequenz schlagartig zu. Durch die Organisation „Kraft durch Freude“ (KdF)
kommen Urlauber aus dem „Altreich“ in hellen Scharen in die „Ostmark“. Schon 1939 sind
mehr als 100.000 Fahrgäste zu befördern. Deshalb bestellt Stern & Hafferl bei der
Bodanwerft in Kressbronn ein neues Schiff nach dem Vorbild der „Munot“, die auf dem
Untersee und Rhein verkehrt. Man leistet sofort eine Anzahlung. Der Bau wird jedoch wegen
des Kriegsausbruchs eingestellt. Erst einige Jahre nach dem Kriegsende erhält Stern &
Hafferl die Anzahlung in Form von Materialien zurück.
DIE KRIEGS- UND NACHKRIEGSZEIT
Auch nach Kriegsbeginn ist die Schifffahrt voll ausgelastet und ein weiteres Schiff dringend
erforderlich. Nachdem der bestellte Neubau nicht geliefert werden kann, erwirbt Stern &
Hafferl vom Schiffunternehmer Rudolf Ippisch das damals kleinste Traunsee-Schiff (60
Personen), das Elektroboot Traunstein. Bei der Havelwerft in Potsdam erbaut, kann es 60
Personen befördern. Es kommt am 29.9.1941 nach Attersee, wird als „Hochlecken“ in
Betrieb genommen und erhält in der Schiffshütte den Platz der „Attersee“.
Da der Platz in Attersee zum Aufziehen der Schiffe auf Land enger begrenzt ist und vor
allem der Dampfer Unterach dort nicht an Land genommen werden kann, kauft das
Unternehmen 1941 dafür vom Besitzer des Schlosses Kammer ein Seegrundstück in
Kammerl.
Die Benutzung der Schifffahrt ändert sich in den Kriegsjahren grundlegend. Bis zum
Kriegsbeginn waren es neben den Einheimischen vor allem die Urlauber und Ausflügler, die
das Schiff benutzten. Befördert wurde auch die Post und in geringem Umfang auch noch
5Attersee
etwas Fracht. Dementsprechend lief der Verkehrsstrom am Vormittag von der
Eisenbahnstation Kammer - Bahnverbindung in die Ballungszentren der Städte Salzburg,
Linz und Wien - nach Unterach (also vom Norden nach Süden) und am Nachmittag
umgekehrt von Unterach nach Attersee und Kammer (von Süden nach Norden).
Nun ändert sich der Verkehrsstrom. In Lenzing entsteht eine neue Zellwollfabrik, zu der jetzt
Menschen aus dem Attersee-Gebiet zur Arbeit fahren. Ja sogar in den kriegswichtigen
Stahlwerken „Hermann Göring“ in Linz sind Menschen aus dem Attersee-Gebiet tätig. Viele
fahren zur Berufsausübung oder zur Erledigung von Angelegenheiten zu den Dienststellen
der öffentlichen Verwaltung in die Bezirkshauptstadt Vöcklabruck. Nachdem der Autoverkehr
durch den Krieg fast zum Erliegen gekommen ist, liegt das Hauptgewicht der
Personenbeförderung bei der Schifffahrt. Dadurch geht der Haupt-Verkehrsstrom nun am
Vormittag von Süden nach Norden und am Abend umgekehrt vom Norden nach Süden.
SCHIFFFAHRT ALS RÜCKGRAT DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRS
Benötigt wird jetzt neben dem morgendlichen Postschiff nach Unterach und dessen
abendlicher Rückkehr nach Kammer zusätzlich ein Frühschiff ab 5.00 Uhr von Unterach zur
Eisenbahnstation Kammer und ein Abendschiff ab Kammer gegen 18.00 Uhr nach Unterach.
Dies erfordert insbesondere im Herbst, Winter und Frühjahr ein Fahren nach Kompass.
Wegen der Gefahr von Fliegerangriffen muss ohne Beleuchtung gefahren werden und auch
am Ufer sind alle Fenster der Häuser verdunkelt. Ausserdem erfordert es tägliche nächtliche
Leerfahrten zwischen Unterach und Attersee, um die Elektroboote in Attersee wieder
aufladen zu können.
Die Fahrgastfrequenz liegt im Jahr 1942 bei rund 200 000, im Jahr 1944 schon bei 343 000
beförderten Personen.
Der Einmarsch der Amerikaner kurz vor dem Kriegsende in das Attersee-Gebiet führt zur
Einstellung der Schifffahrt im Frühjahr 1945. Die Soldaten benützen die Elektroboote zu
ihrem Vergnügen zunächst allein. Später darf ein Schiffsmann mitfahren, um grössere
Schäden zu verhindern. Auch den Dampfer setzen sie ein.
Im Juli 1945 wird der ordentliche Betrieb wieder aufgenommen. Im letzten Kriegsjahr und
nach dem Kriegsende erhöht sich die Bevölkerungszahl im Attersee-Gebiet unnatürlich stark
durch den Zuzug der sogenannten DP (Displaced Person = Flüchtlinge), sowie von
entlassenen Wehrmachtsangehörigen und ausgebombten Bewohnern aus den Städten
Oberösterreichs, Salzburgs und Wiens. Viele von Ihnen fahren zur Arbeit in die Stadt und
nach Lenzing oder zu den Behörden in die Bezirkshauptstadt. So erreichen die
Beförderungszahlen im Jahr 1945 die seither nie mehr erreichte Spitze von 425 000
Fahrgästen, also rund 1 200 pro Tag.
DIE MODERNISIERUNG DER FLOTTE
Als erstes Schiff unterzieht Stern & Hafferl den zwischenzeitlich mehr als 75 Jahre alt
gewordenen Dampfer Unterach im Jahr 1946 einem Totalumbau. Geblieben ist in der
ursprünglichen Form nur die Schale. Maschine und Kessel erhielten eine
6Attersee
Generalüberholung, mehr gedeckte Innenräume, ein gedecktes Steuerhaus und eine
Heizung für den Winterbetrieb.
Immer mehr verschlechtert sich in dieser Zeit auch der Zustand der Batterien der auch schon
mehr als 30 Jahre alten Elektroboote. Deshalb bemüht man sich zunächst, die nächtlichen
Leerfahrten zwischen Unterach und Attersee zu vermeiden und lädt die Batterien des Abend-
Schiffs in der Nacht in Unterach an der Oberleitung der dortigen Strassenbahn auf.
Im Winter 1949/1950 nimmt man dann den Umbau des Elektrobootes Attergau in ein
Motorschiff in Angriff. Die Firma Stern & Hafferl hat nach Kriegsende von den Amerikanern
für ein geplantes neues Schiff zwei Sechs-Zylinder-Dieselmotoren mit Wendegetriebe und
Propeller-Rohlingen gekauft. Eines dieser Aggregate baut man nun in die „Attergau“ als
Ersatz der zusammengebrochenen Batterien ein. Damit löst sich für dieses Schiff nicht nur
das Batterien-Problem, sondern es erhöht sich auch die Geschwindigkeit von 13 km/h auf 21
km/h. Im Übrigen erfahren auch das Steuerhaus und die Aufbauten geringfügige
Veränderungen. Die Tragfähigkeit wird auf 110 Personen herabgesetzt. Nachdem im Winter
1951/1952 die Batterien der „Hochlecken“ zusammenbrechen, baut man auch in dieses
Schiff einen gebraucht gekauften Dieselmotor ein, nachdem ein neuer Motor zum damaligen
Zeitpunkt nicht zu bekommen war.
Im Sommer 1954 erfolgt ein weiterer Umbau des Dampfers Unterach. Den Kessel und die
Maschine ersetzt man durch den Einbau des zweiten, seinerzeit von den Amerikanern
gekauften Dieselmotors. Unter Verwendung von zwei aus einer aufgelassenen
Gleichrichterstation stammenden Generatoren, von zwei aus einem abgebrochenen
elektrischen Triebwagen stammenden Fahrmotoren mit einem der dazu gehörigen
elektrischen Triebfahrzeug-Fahrschalter und einer Solenoidbremse aus einem alten
Strassenbahnbeiwagen sowie einer neu beschafften Untersetzung für die Schaufelradwelle
entsteht ein Radmotorschiff mit dieselelektrischem Antrieb. Zudem erfolgt eine weitere innere
und äussere Renovierung des Schiffes. Statt wie bisher mit 7 Mann Besatzung zu fahren,
lässt sich der Dampfer nun von drei Personen bedienen. Dafür können nun 270 Personen
befördert werden.
Leider erweist sich der Dieselmotor für den Dampfer im Betrieb als etwas zu schwach.
Deshalb erhält die „Unterach“ einen neuen stärkeren Diesel. Der bisher im ehemaligen
Dampfer verwendete Diesel kommt 1958 in die „Burgau“ (ursprünglich „Baron Handel“), die
man in gleicher Weise wie die „Attergau“ umbaut. Damit endet in diesem Jahr die
Elektroschifffahrt auf dem Attersee und wird die Ladestation Attersee aufgelassen.
DAS ENDE DER LINIENSCHIFFFAHRT
Nach der Rückkehr der Bombengeschädigten in die Stadt sowie der ehemaligen
Wehrmachtsangehörigen zu ihren Familien und der Abreise der meisten DP nach
Deutschland sinken in den darauffolgenden Jahren naturgemäss die Fahrgastzahlen wieder
stark ab. Sie liegen 1947 noch bei 300.000, 1949 bei 150.000 und 1954 nur noch bei
100.000 beförderten Personen.
7Attersee
Der zunehmende Strassenverkehr führte dazu, dass auch der Stückgutverkehr, der 1944
noch bei 2.000t beförderter Fracht lag, sich von Jahr zu Jahr verringert. Lediglich die
Postbeförderung – im Jahr werden rund 150t mit dem Postschiff in der Früh von Kammer
nach Unterach und am Abend zurückbefördert – hat noch einen nennenswerten Umfang.
Etwa ab 1960 gibt es im Winter zudem kaum mehr Fahrgäste. Die Menschen fahren nun mit
dem Post-Omnibus und auch Stern & Hafferl – der schon in der Vorkriegszeit einen
bescheidenen Busverkehr betreibt - baut seinen Omnibusbetrieb weiter aus. Immer mehr
Menschen benutzen auch das eigene Auto. So wurde die Schifffahrt allmählich zu einem
reinen Ausflugs- und Vergnügungsbetrieb.
Nur im Spätsommer 1959 war die Schifffahrt noch einmal für einige Wochen der alleinige
Träger des gesamten Personen- und Güterverkehrs. Durch einen schweren Bergrutsch war
die Seeleithen-Bundesstrasse auf der Ostseite des Attersee verschüttet. Die Menschen
mussten wieder das Schiff benützen.
Schliesslich kündigt Stern & Hafferl zum 31.12.1964 den Postvertrag, beendet den
Stückgutverkehr und stellt den Winterbetrieb ein. Von da ab ist die Attersee-Schifffahrt eine
reine Saisonschifffahrt.
DER ERSATZ DER SCHIFFE
Die Schiffe kommen nun allmählich „in die Jahre“. Deshalb werden sie in den folgenden 10
Jahren alle durch neue Schiffe ersetzt. Doch zunächst wird die Attersee-Flotte um ein 5.
Schiff erweitert. Grund war das Drängen insbesondere der Gemeinde Seewalchen nach
einem möglichst stündlich verkehrenden Rundfahrtschiff. So erwirbt Stern & Hafferl vom
Schiffsbetrieb Schwaiger in Kelheim das Motorschiff Westfalen. Dieses wurde im Jahr 1965
für den Ruhrtalstausee in der bei Bonn gelegenen Lux-Werft Mondorf gebaut. 1968 kam es
dann auf die Donau. Das neue Schiff wird am 29.6.1974 in Attersee auf den Namen
„Attersee“ getauft und in Dienst gestellt. Im Jahr 1993 erhält die „Attersee“ Radständer auf
dem Dach und kann so auch als Fahrradschiff eingesetzt werden. Es vermag 190 Personen
zu transportieren.
Die Phase des eigentlichen Schiffsersatzes beginnt 1977. In diesem Jahr kauft Stern &
Hafferl vom Tegernsee das 1931 bei Kellerer in Tegernsee gebaute Schiff Wallberg für 70
Personen. Nach der Taufe am 11.7.1977 in Attersee kommt das Schiff als „neue“
„Hochlecken“ in Fahrt. Die alte „Hochlecken“ erwirbt die Chemiefaser Lenzing und gibt ihr
den Namen „Schloss Kammer“. Geplant ist, mit Gästen dieses Industriebetriebs
Ausflugsfahrten über den Attersee zu machen. Doch erfolgen solche Fahrten nur sporadisch.
Deshalb verkauft Lenzing 1991 das Schiff an Ing. Wimmer, der damit zunächst einen
Gelegenheitsverkehr am Attersee anbietet. Wenig später muss er diesen wieder einstellen,
weil die Aufsichtsbehörde die Genehmigung zurückzieht, die drei geplanten Landungsstege
anzufahren und die Einstellung eines entsprechend ausgebildeten Matrosen verlangt. Lange
Zeit läuft diesbezüglich ein Prozess. Im strengen Winter 1996/1997 wird die Schale durch
Eisdruck beschädigt. Die „Schloss Kammer“ muss aus dem Wasser genommen werden und
wird einige Kilometer vom See entfernt neben dem Bauernhof von Ing. Wimmer in Viehhof
bei Gampern abgestellt. Im Winter 2005 beschädigt im Sturm ein umstürzender Baum das
94-jährige Schiff so schwer, dass es abgebrochen werden muss.
8Attersee
Ende Oktober 1978 erleidet der nunmehr als Radmotorschiff in Fahrt befindliche ehemalige
Raddampfer Unterach einen schweren Motorschaden. Er wird am Slipplatz in Kammer an
Land genommen. Die Untersuchung ergibt erhebliche Mängel an der Schiffsschale.
Insbesondere die Spannten sind extrem brüchig geworden. Deshalb muss die „Unterach“ im
Winter 1978/1979 abgewrackt und verschrottet werden.
Als Ersatz erwirbt Stern & Hafferl von der Donau das grosse Motorschiff Ludwig der
Kelheimer. Erst 1977 bei der Hitzler Werft in Regensburg erbaut und für 400 Personen
zugelassen, fährt es zunächst bei den Vereinigten Schiffern in Kelheim auf der Donau. Im
April 1979 erwirbt es Stern & Hafferl. Im Juni 1979 in Kammer bei der Agerbrücke in den See
gesetzt wird es in Attersee auf den Namen „Stadt Vöcklabruck“ getauft. Das Schiff verfügt
über 258 Sitzplätze.
Bald steht aber auch der Ersatz der „Attergau“ und der „Burgau“ an. Zunächst wird Ende der
Saison 1983 die „Attergau“ abgestellt. Sie kommt im darauffolgenden Jahr nach St. Georgen,
wo sie beim Lieslwirt - auf Land eingegraben - als Diskobar Verwendung findet. Als Ersatz
kommt wiederum von der Donau die „Bayern“. 1970 bei der LUX-Werft Mondorf für die
Betriebsgemeinschaft Klinger/ Köck/Vogel erbaut, ist sie vor allem bei den Drei-Flüsse-
Rundfahrten in Bayern – jetzt bei Wurm & Köck - eingesetzt. Sie erhält bei der Schiffstaufe
am 17.6.1984 in Unterach den Namen „Unterach“. Ursprünglich für 220 Personen
zugelassen, stehen 125 Sitzplätze zur Verfügung.
1989: DER ERSTE ATTERSEE-NEUBAU SEIT 1913
Zum Ende der Saison 1988 muss auch die „Burgau“ abgestellt werden. Seit Frühjahr 1989
steht sie beim Restaurant Pichlmühle zwischen Attersee und Nussdorf aufgebockt an Land.
und dient als Blickfang. Der Motor kommt zum Traunsee und wird dort in die „Rudolf Ippisch“
eingebaut. Ersetzt wird sie durch die „Weyregg“. Dieses Schiff ist der erste Neubau seit
1913, der direkt für den Attersee bestellt wurde. Von der Schmidt Werft in Remagen gebaut,
nimmt es bei der Überstellung an den Attersee der deutsche Spediteur kurzerhand als
Pfand, weil ihm die Werft noch eine grössere Summe Geld schuldet. So trifft die WEYREGG
mit einigen Tagen Verspätung ein. Die Indienststellung und Schiffstaufe erfolgt dann am 1.
Juli 1989 in Weyregg. Sie kann bis zu 170 Personen auf Sitzplätzen befördern.
Nachdem die anfallenden Beförderungsleistungen mit den vier jüngeren Schiffen erbracht
werden können, wird im Jahr 1989 die „Hochlecken“ aus dem regulären Dienst genommen
und an Dr. Neumann junior, ebenfalls aus der Firma Stern & Hafferl, verkauft. Dieser
restauriert das Schiff mustergültig. Es kann nun für Sonderfahrten gemietet werden. Da es
dafür jedoch kaum eine Nachfrage gibt, wird das Schiff 1999 an den Industriellen Hans
Asamer verkauft. Dieser verwendet es für den Transport von Gästen seines Hotels Schloss
Freisitz Roith in Gmunden am Traunsee. Nachdem sich jedoch die Eigentümer des
Schlosshotels auf ihr eigentliches Kerngeschäft zurückziehen, fährt die „Hochlecken“ seit
2014 für die Traunseeschifffahrt von Karlheinz Eder als „J. Ruston“.
Schliesslich erweist sich auch die „Attersee“ als überzählig. Sie wird 2001 erst an den
Schiffsbetrieb Eder in Gmunden am Traunsee vermietet und läuft als „La Citronella“, dann
9Attersee
von diesem erworben und in „Josef J. Ruston“ umbenannt. Seit 2006 befindet sich das Schiff
in Berlin bei Exclusiv-Yachtcharter in Berlin und fährt dort nach einem recht luxuriösen
Umbau auch heute noch als „La Bella“.
Zu erwähnen ist noch, dass die an Land abgestellten ehemaligen Elektroboote und späteren
Motorboot „Attergau“ und „Burgau im Winter 2006/2007 auf Weisung des Naturschutzes
abgebrochen werden.
EIN NEUES OUTLOOK
Im Jahr 2007 erhält die „Stadt Vöcklabruck“ den Zusatznamen „Gustav Klimt“ und wird –
ganz im Stil Klimts beige lackiert. Seit 2013 ist der Rumpf schwarz lackiert. Sie bekommt
eine neue Inneneinrichtung in modernem Design, ist nun nicht nur beheizbar, sondern auch
klimatisiert und verfügt über eine kleine Bar, ein Musikanlage sowie ein behinderten-
gerechtes WC. Die Aufbauten der „Weyregg“ bemalt 2011 der österreichische Künstler
Christian Ludwig Attersee farbenprächtig. Auch sie ist beheizbar, hat eine kleine Theke für
Getränke und kleine Speisen sowie eine Musikanlage. Und auch auf der ebenfalls
beheizbaren „Unterach“ können gekühlte Getränke bezogen werden. Seit 2016 ist sie
ebenfalls wie die „Weyregg“ am Hinterschiff bemalt.
SCHIFFFAHRT HEUTE
Im Jahr 2014 werden die Landungsverhältnisse in Seewalchen durch einen neuen längeren
Landungssteg verbesset. Nun kann auch die „Vöcklabruck“ hier anlegen. Im Jahr 2015 wird
auch der Landungssteg in der Burggrabenklamm wieder in Betrieb genommen, der mehrere
Jahre wegen Sperre der Burgauklamm nach massiven Unwetterschäden gesperrt war.
Heute stehen der Schifffahrt 3 Schiffe zur Verfügung. Der reguläre Betrieb beginnt Anfang
Mai und endet Mitte Oktober. Während bis 1985 ein reiner Linienbetrieb stattfindet (Halt in
allen Stationen von Kammer bis Unterach in einer Linie) wird 1986 der Fahrplan völlig
umstrukturiert. Es werden nun je einen kreisförmigen Rundkurs im nördlichen und im
südlichen Teil des Sees angeboten Heute gliedert sich der Fahrplan in vier Abschnitte:
Den Rundkurs Nord führt von Attersee über den See, sodann entlang dem Ostufer nach
Kammer und von dort entlang des Westufers vorbei an Litzlberg zurück nach Attersee. Die
Fahrtdauer beträgt 70 Minuten. Angeboten werden in der Hauptsaison sechs Fahrten. In der
Vor- und Nachsaison ist das Angebot reduziert und findet teilweise nur an schönen
Wochenenden statt. Geführt wird der Rundkurs Nord in der Regel mit der „Weyregg“
Den Rundkurs Süd fährt von Attersee entlang des Westufers vorbei an Nussdorf nach
Unterach, zurück über das Ostufer vorbei an Weissenbach und Steinbach bis Weyregg und
dann zurück über den See nach Attersee. Fahrtdauer rund 2 Stunden und 20 Minuten.
Durchgeführt werden in der Hauptsaison vier Fahrten statt. In der Vor- und Nachsaison ist
ähnlich wie beim Nordkurs der Fahrplan reduziert. In der Regel fährt täglich ausser Montag
die „Stadt Vöcklabruck“, sonst die „Unterach“.
Der Rundkurs Süd klein besteht erst seit 2014. Er fährt nur an Sonntagen und nur bei
schönem Wetter und bietet im südlichen Teil des Attersees zwei Rundfahrten an. Von
Stockwinkel am Westufer des See ausgehend überquert er ihn zum Ostufer, fährt dieses
10Attersee
entlang bis Unterach und kehrt dann am Westufer nach 1 Stunde und 10 Minuten wieder
nach Stockwinkel zurück. Anzumerken ist, dass dieser kleine Rundkurs im südlichen Teil
des Attersees schon einmal in den Jahren 1986 bis 1990 als Rundkurs Süd II angeboten
wurde.
Die Vergnügungsfahrten am Abend werden zum grössten Teil mit der „Stadt Vöcklabruck,
untertags aber auch von der „Weyregg“ ausgeführt. Angeboten wird am Montag das
„Piratenschiff“ (Kinderschiff), am Dienstag ein Schiff-Bummelzug-Erlebnis (Rundkurs Nord
mit anschliessender Fahrt mit dem Hobby Zug auf der Schmalspurbahn Attersee-Walsberg-
Attersee), am Mittwoch eine Sommernachtsparty am See, am Donnerstag eine Abendfahrt
mit Live-Musik Tanz und Stimmung sowie am Freitag am Rundkurs Nord ein
Kindespassschiff mit dem Motto „Geister ahoi“. Aber auch bestellte Rundfahrten aus
konkreten Anlässen (z.B. Hochzeit) finden statt. Am kraftfahrzeugfreien Sonntag sowie
anlässlich der Attersee-Überquerung der Schwimmer stellen die Schiffe entsprechende
Querverbindungen ein. Schließlich werden mit den nun beheizbaren Schiffen seit einigen
Jahren sogar im Winter Rundfahrten aus konkreten Anlässen (z.B. Adventfahrten,
Weihnachtsfahrten u.a.) angeboten.
Heute werden von der Attersee-Schifffahrt jährlich rund 100 000 Personen befördert.
DIE HOTELSCHIFFFAHRT FÖTTINGER
Im Jahr 2001 erwirbt der Besitzer des Hotel Föttinger in Seefeld am Attersee eine
Konzession für Gelegenheitsfahrten und erwirbt ein Elektroboot für 25 Personen. Erbaut
1923 bei Lürssen Vegesack als „Salet“ für den Königssee, wird es dort 1997 nur mehr als
Arbeitsboot verwendet. Im Mai 1998 kauft sie die Firma Schilcher im österreichischen St.
Wolfgang. Diese unterzieht die „Salet“ mit Unterstützung rumänischer Bootsbauer einer
Generalüberholung, gibt ihr den neuen Namen "Liesa" und setzt sie für Rundfahrten ein. Die
Konkurrenz der anderen vier Schiffsbetriebe am Wolfgangsee ist jedoch zu gross. Deshalb
gibt die Firma Schilcher 2001 das Schiff weiter an das Hotel Föttinger in Seefeld am
Attersee. Dort führt die „Liesa“ nicht nur für die Hotelgäste, sondern auch für Reisegruppen
mehrstündige Ausflugs- und Eventfahrten für bis zu 22 Personen durch. Befördert werden im
Jahr rund 500 Fahrgäste.
Im August 2000 tun sich in Seewalchen am Attersee vier Männer zusammen, die alle einen
Bezug zu Flösserei und Schifffahrt haben, um eine Plätte nach historischem Vorbild zu
bauen. Mit dem Schlagen der Lärchen im Marktwald im September 2000 beginnt der Bau.
Nach vielerlei technischen Problemen wird sie im September 2004 zu Wasser gelassen. Am
5. November 2004 kann die erste Testfahrt durchgeführt werden. Das Schiff erhält den
Namen EKHENOHA, was die ersten Buchstaben der Vornamen der Schiffsbauer ergibt. Es
gibt keine kommerziellen Interessen, das Schiff kann für private Feiern, Ausflüge von
Gruppen oder Vereinen, Vergnügungsfahrten oder für Transporte eingesetzt werden.
Autor: Prof. Dr. Dr. Benedikt von Hebenstreit, München/Zürich
Copyright: Schiffs-Agentur Schweiz 2017, Ergänzung 202
11Attersee
Literaturverzeichnis Attersee
• Herbert Winkler, Die Schifffahrt auf dem Attersee, Mondsee, Wolfgangsee; in Marine-
Gestern, Heute; Sonderpublikation der Arbeitsgemeinschaft für österreichische
Marinegeschichte, Wien 1980
• Doris Schreckeneder et al., Glücksmomente – Von Menschen, Schiff und Bahn rund um den
Attersee, Trauner Verlag, Linz, 2013
12Sie können auch lesen