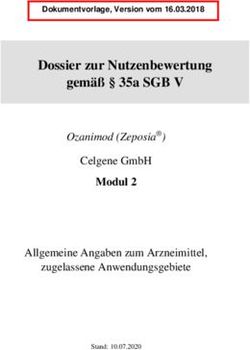Ausbildungsprogramm für das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ZfsL
Lüdenscheid
Ausbildungsprogramm
für das Lehramt
an Haupt-, Real-,
Sekundar- und
Gesamtschulen
Entwurfsfassung gemäß Beschlüssen der
Seminarkonferenz vom
25. April 2022
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Lüdenscheid
Corneliusstraße 39
58511 Lüdenscheid
Tel.: +49 2351 63055
Fax.: +49 2351 9623110Inhaltsverzeichnis
0. INHALTSVERZEICHNIS
0. Inhaltsverzeichnis .................................................................................... 1
1. Leitideen der Ausbildung im Seminar ....................................................... 2
2. Struktur des Seminars .............................................................................. 3
2.1. Ausbilderinnen und Ausbilder des Seminars HRSGe ................................ 3
2.2. Ausbildungsfächer .................................................................................... 4
3. Die Struktur der Ausbildung im Seminar HRSGe ........................................ 4
3.1. Vereidigung ............................................................................................... 4
3.2. Organisatorisches zur Ausbildung ............................................................ 5
3.3. Fachliche und überfachliche Ausbildung im Seminar HRSGe .................. 6
3.4. Akzente während der Ausbildung............................................................. 7
3.5. Ausbildung in sechs Quartalen ................................................................. 8
3.6. Ausbildungselemente in den Quartalen ................................................... 9
3.7. Einsichtnahme in eine andere Schulform ............................................... 13
3.8. Portfolio und Logbuch ......................................................................... 14
4. Beratung im Seminar ............................................................................. 15
4.1. EPG - Eingangs- und Perspektivgespräch ................................................ 15
4.2. Beratungsanlass zur Hälfte des Vorbereitungsdienstes ......................... 16
4.3. Reflexionsanlass zum Ende des Vorbereitungsdienstes ......................... 17
4.4. Beratungsanlässe nach Unterrichtsbesuchen im Fachseminar .............. 17
4.5. Beratungselemente im Kernseminar ...................................................... 18
5. Kooperation aus der Perspektive des Seminars ...................................... 19
6. Partizipation im Seminar ........................................................................ 20
7. Evaluation im Seminar ........................................................................... 20
8. Gültigkeit ............................................................................................... 20
Seite 1Leitideen der Ausbildung im Seminar
1. LEITIDEEN DER AUSBILDUNG IM SEMINAR
Das Seminarprogramm für das Lehramt HRSGe setzt die Ausführungen des
Ausbildungsprogramms des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL)
in Lüdenscheid inhaltlich fort, indem es lehramtsspezifische Aspekte ergänzt. Es
wird kontinuierlich weiterentwickelt, um dem gesellschaftlichen und
bildungspolitischen Wandel Rechnung zu tragen.
Die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sowie Lehrerinnen und Lehrer
in Ausbildung werden künftig Kinder und Jugendliche unterrichten, welche sich in
einer von vielen Veränderungen geprägten Lebensphase befinden. Die individuelle
Entwicklung vom Kind über den Jugendlichen zum jungen Erwachsenen wird von
vielen physischen und psychischen Veränderungen begleitet. Lehrerinnen und
Lehrer haben die Aufgabe, hierauf angemessen zu reagieren und im Sinne eines
humanistischen Menschenbildes erzieherisch einzuwirken. Dies erfordert ein
umfangreiches Berufs- und Handlungswissen.
Es ist normal, anders zu sein.
Die Vielfalt in unserer Gesellschaft spiegelt sich auch im Schulleben wider.
Heterogene Lernvoraussetzungen und biografische Diversität verstehen wir als
Herausforderung und Chance. Sie erfordern von den jungen Lehrerinnen und
Lehrern eine hohe Reflexivität im Abgleich von Fach- und Bildungswissenschaften.
Die Bereitschaft zur Kooperation in multiprofessionellen Teams, insbesondere mit
den sonderpädagogisch qualifizierten Kolleginnen und Kollegen, ist für unsere
Arbeit eine Gelingensbedingung für erfolgreiches Lernen auf allen Ebenen und
schließt einen kritisch-konstruktiven Diskurs über Normen und Werte mit ein.
Der Standort Lüdenscheid - klein und fein.
Das „Medardus-Haus“, ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1881 am Rande der
Lüdenscheider Altstadt, lädt in seiner Überschaubarkeit und seinem besonderen
Charme ein zu einer Professionalisierung, die gleichermaßen geprägt ist von
individueller Beratung und der Vermittlung zeitgemäßer Didaktik und Methodik.
Fachlicher Anspruch, stärkenorientierte Begleitung sowie ein wertschätzendes
Miteinander machen uns aus.
Seite 2Struktur des Seminars
2. STRUKTUR DES SEMINARS
Gemäß der Geschäftsordnung der Studienseminare für Lehrämter an Schulen aus
dem Jahr 2019 trägt die Gesamtverantwortung für die Ausbildung am Zentrum für
schulpraktische Lehrerausbildung in Lüdenscheid die Leiterin des ZfsL Frau
Nicole Korb.
Die Verantwortung für die Ausbildung im Lehramt für Haupt-, Real-, Sekundar-,
und Gesamtschulen übernimmt der Leiter des Seminars HRSGe Herr Ralf Schnetz.
2.1. Ausbilderinnen und Ausbilder des Seminars HRSGe
Am Seminar HRSGe bilden aktuell folgende Seminarausbilderinnen und
Seminarausbilder (SAB) fachlich und überfachlich aus:
Frau Brinkmann Frau Nockemann
Frau Brohl Herr Paschkewitz
Herr Dilks Frau Pauli
Herr El Barraki Frau Pohlmann
Frau Gösmann Herr Schnetz
Frau Honsberg Frau Scholz
Herr Leeker Herr Schroth
Herr Loewe Herr Storkmann
Frau Meyer Frau Tsiokas
Seite 3Die Struktur der Ausbildung im Seminar HRSGe
2.2. Ausbildungsfächer
Das Seminar HRSGe bildet aktuell in folgenden Fächern aus:
Biologie Hauswirtschaft
Chemie Katholische Religionslehre
Deutsch Mathematik
Englisch Physik
Erdkunde Sozialwissenschaften
Evangelische Religionslehre Sport
Französisch Technik
Geschichte Textilgestaltung
3. DIE STRUKTUR DER AUSBILDUNG IM SEMINAR HRSGE
Ausbildung nach Lehramtsstudium
Grundlage der Ausbildung für die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
(LAA) ist die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung für
Lehrämter an Schulen vom 10. April 2011 (OVP) in der aktuellen Fassung.
Seiteneinstieg (OBAS/PE)
Neben einer „grundständigen“ Ausbildung, die auf dem Master of Education
aufbaut, ist auch ein „Seiteneinstieg“ in die Lehrerausbildung möglich. Die
Ausbildung am ZfsL erfolgt parallel zu einer Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer im
Angestelltenverhältnis an einer Schule des Landes Nordrhein-Westfalen und
dauert 24 Monate. Den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst regelt die
Verordnung OBAS in der Fassung vom 08. Juli 2018.
Lehrkräfte ohne Befähigung zu einem Lehramt im Sinne des
Lehrerausbildungsgesetzes (LABG), die in ein Dauerbeschäftigungsverhältnis
übernommen werden sollen und die nicht nach OBAS ausgebildet werden,
nehmen mit Unterstützung des ZfsL an der Pädagogischen Einführung (PE) durch
ihre Schule und das Seminar HRSGe teil.
3.1. Vereidigung
Da die Einstellungstermine 01. Mai und 01. November immer auf einen Feiertag
fallen, finden die Vereidigungen an dem vorangehenden Werktag statt.
Die Seminarveranstaltungen beginnen am ersten Donnerstag (außerhalb der
unterrichtsfreien Zeit) nach der Vereidigung.
Seite 4Die Struktur der Ausbildung im Seminar HRSGe
3.2. Organisatorisches zur Ausbildung
Die Dauer des Vorbereitungsdienstes beträgt 18 Monate, die sich in sechs
Quartale gliedern. Insgesamt finden 21 Wochenstunden Ausbildung in Seminar
und Schule statt.
Eine Übersicht über die Organisation der Ausbildung in sechs Quartalen kann über
den internen Bereich des Lernmanagementsystems eingesehen werden.
Seminar
Seminartag für das Lehramt HRSGe ist der Donnerstag. An ihm finden für die
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und Lehrerinnen und Lehrer in
Ausbildung keine schulischen Veranstaltungen statt. Die Seminararbeit im
Lehramt HRSGe umfasst 7 Unterrichtsstunden pro Woche, davon fallen auf die
Kernseminarzeit 135 Minuten, die Fachseminarzeit jeweils 90 Minuten.
Innerhalb der ersten sechs Wochen der Ausbildung findet ein Eingangs- und
Perspektivgespräch (EPG) nach § 15 OVP statt.
Das Portfolio begleitet den Vorbereitungsdienst.
Der Zeitpunkt zur Durchführung der nach § 12 OVP vorgesehenen „Einsicht in die
besonderen Aufgaben anderer Schulformen oder Schulstufen“ stellen wir in die
Verantwortung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und in
Absprache mit den ausbildenden Schulen. Nähere Informationen finden sich in
Kapitel 3.7.
Schule
Für das Lehramt HRSGe findet die Ausbildung an den folgenden Schulformen statt:
Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule sowie die Primusschule.
Der Ausbildungsbezirk des Seminars HRSGe Lüdenscheid umfasst den Märkischen
Kreis, das Stadtgebiet Hagen sowie große Teile des Ennepe-Ruhrkreises. Eine
Auflistung der ausbildenden Schulen können auf der Homepage des ZfsL
Lüdenscheid / Seminar HRSGe eingesehen werden.
Der Ausbildungsunterricht umfasst 14 Stunden von 45 Minuten pro Woche.
Andere Stundentaktungen werden schulseitig anteilig umgerechnet.
Im ersten Quartal sind diese vorgesehen für Hospitationen und Unterricht unter
Anleitung. Ab dem zweiten bis zum Ende des fünften Quartals ist davon der
selbstständig erteilte Unterricht im Umfang von durchschnittlich neun Stunden
Seite 5Die Struktur der Ausbildung im Seminar HRSGe
pro Woche vorgesehen. Im letzten Quartal findet grundsätzlich kein
selbstständiger Unterricht mehr statt.
Die Schule entwickelt in Abstimmung mit dem Seminar und auf der Grundlage des
Kerncurriculums ein Ausbildungsprogramm. Es umfasst, je nach Schulprogramm,
besondere Angebote für die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter.
3.3. Fachliche und überfachliche Ausbildung
im Seminar HRSGe
In den Seminaren werden didaktische, methodische und pädagogische sowie
persönliche und soziale Kompetenzen entwickelt und reflektiert. Dies geschieht
auf der Grundlage der OVP 2021 in der jeweils gültigen Fassung Anlage 1 und des
Kerncurriculums (KC) 2021.
Überfachliches Kernseminar
Kernseminarleitungen besuchen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
im Unterricht. Die Kernseminarleitung verantwortet
die kompetenzorientierte Ausbildung der überfachlichen
Grundlagen,
die unterrichtsbezogenen Ausbildungsbesuche,
die personenorientierte Beratung mit Coachingelementen
(PoB-C)
und führt das Eingangs- und Perspektivgespräch (EPG) durch.
Unterrichtsbesuche und Mitarbeit im Kernseminar sind generell beurteilungsfrei.
Fachseminare
Die Fachseminarleitung verantwortet
die fachspezifische Ausbildung auf der Grundlage der aktuellen
Fachdidaktik und -methodik,
die Einbindung außerschulischer Lernorte in die
Fachseminararbeit
und übernimmt
die fachorientierte Beratung auf der Grundlage von in der Regel
fünf Unterrichtsbesuchen.
die kompetenzorientierte Beurteilung auf der Grundlage von in
der Regel fünf Unterrichtsbesuchen unter Einbezug der
Mitarbeit im Fachseminar und des dienstlichen Verhaltens.
Seite 6Die Struktur der Ausbildung im Seminar HRSGe
3.4. Akzente während der Ausbildung
Querschnittsthemen während des gesamten Vorbereitungsdienstes
In den 18 Monaten des Vorbereitungsdienstes werden die Leitideen der
Ausbildung in der fachlichen und überfachlichen Seminararbeit kontinuierlich
konkretisiert. Dazu gehören insbesondere die Felder Sprachsensibilität, Digitale
Bildung, Demokratieerziehung, Wertebildung und Lehrer:innengesundheit sowie
Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Diese genannten Themenbereiche wie auch
die gesamte Ausbildung werden dabei immer an der Leitlinie „Vielfalt als
Herausforderung annehmen und als Chance nutzen“ ausgerichtet.
Individualisierung und Standardorientierung
Der Vorbereitungsdienst am Seminar HRSGe in Lüdenscheid bezieht sich auf das
vorliegende Ausbildungsprogramm, welches ein individualisiertes und an
Berufsbiografien orientiertes Lernen ermöglicht. Es wird in agilen Arbeitszyklen
kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt. Durch diese weitgehende
Individualisierung wird es ermöglicht, den unterschiedlichsten Vorerfahrungen
und Kompetenzen der Lernenden gerecht zu werden.
Die Ausbildung erfolgt im Spannungsfeld von selbstgesteuertem Lernen und
verpflichtenden Vorgaben auf der Basis des Kerncurriculums. Daher wird das
Führen eines Logbuchs zu einem obligatorischen Instrument zum Nachweis der
selbstgewählten Ausbildungsmodule. Darüber hinaus dient es insbesondere auch
dazu, um im Gespräch zwischen den an der Ausbildung beteiligten Personen
erreichte Erfolge, gewonnene Kompetenzen sowie anstehende Ziele und
Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen und in den Fokus zu rücken.
Lehramtsübergreifende Kooperation
Auszubildende der Lehrämter Grundschule, Sonderpädagogische Förderung und
HRSGe verfügen über unterschiedliche Expertisen. Gemeinsame
Kooperationstage zwischen den Lehrämtern erlauben von und miteinander zu
lernen und von den anderen Ausbildungsgängen zu profitieren.
Ebenso wird Unterricht im Gemeinsamen Lernen - insbesondere im Rahmen der
Tandem-Ausbildung - lehramtsübergreifend geplant, erprobt und reflektiert.
Seite 7Die Struktur der Ausbildung im Seminar HRSGe
Skills im 21. Jahrhundert
Die Anforderungen an zukünftige Lehrerinnen und Lehrer durch die
Herausforderungen aus Gesellschaft, Ökonomie und Ökologie werden geprägt
sein durch Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. In
diesen Rahmenbedingungen kommt der Entwicklung einer professionellen
Lehrerpersönlichkeit eine besondere Bedeutung zu.
Die Verankerung der als 4K bekannten Kompetenzen Kommunikation,
Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken ist ein zentrales Anliegen der
Ausbildung. Durch den bewussten Einbezug der 4K in die Gestaltung der
Seminarveranstaltungen werden diese Kompetenzen sukzessive trainiert und
gefördert.
3.5. Ausbildung in sechs Quartalen
Die 18 Monate des Vorbereitungsdienstes und der Intensivphase nach OBAS
gliedern sich in sechs Quartale. Diese starten mit der Einführungsphase, die nach
drei Monaten mit dem Beginn des selbstständig erteilten Unterrichts endet.
Darauf folgt die Kernphase, bevor im sechsten Quartal die Prüfungsphase
eingeleitet wird.
Einführungsphase im ersten Quartal
Zu Beginn des Vorbereitungsdienstes ist im Rahmen des Kernseminars eine
mehrtätige, fachübergreifende Kompaktphase zum Schwerpunktthema „Bildung
im 21. Jahrhundert“ vorgesehen.
Die Ausbildung im ersten Quartal ist auf der Basis sogenannter Ankertage
organisiert.
Kernphase im zweiten bis fünften Quartal
Die Kernphase ist gekennzeichnet durch unterschiedlich organisierte Seminartage.
Neben den Ankertagen sind es insbesondere die Schwerpunkttage und die Treffen
in den Professionellen Lerngemeinschaften, die eine individuelle Ausgestaltung
der Ausbildung ermöglichen.
Prüfungsphase im sechsten Quartal:
Mit Eintritt in die Prüfungsphase sind die Seminartage in der Regel wieder in
Ankertagen organisiert. Projektorientiertes Arbeiten in unterschiedlichen
Seite 8Die Struktur der Ausbildung im Seminar HRSGe
Themenfeldern, die Einbindung externer Kooperationspartner und der Übergang
in das Berufsleben prägen diese Phase.
3.6. Ausbildungselemente
Neben den Fach- und Kernseminaren, die in Ankertagen organisiert werden, gibt
es zur Förderung der Individualisierung folgende Ausbildungselemente:
Schwerpunkttage mit Selbstorganisiertem Lernen (SoL) und Wahl-
Angeboten (W)
Seminar in Schule (SiS)
Professionelle Lerngemeinschaften (PLG)
Ausbildung in Ankertagen
Ankertage bilden mit festen Zeit- und Gruppenstrukturen das konstante
Ausbildungselement des Vorbereitungsdienstes.
Der nebenstehende Zeitplan organisiert die
Ausbildung in der Kernseminarschiene und in den
drei Fachseminarschienen Fachseminar X, Y und
Z. Die sieben Wochenstunden der
Ausbildungsverpflichtung nach OVP und OBAS
verteilen sich mit drei Wochenstunden auf das
Kernseminar und mit jeweils zwei Stunden auf die
beiden Fachseminare. In der Ausbildung nach PE
fallen drei Wochenstunden auf das Kernseminar
und zwei Wochenstunden auf ein Fachseminar. Die Ausbildung im EU
Anpassungslehrgang sieht keine überfachliche Ausbildung im Kernseminar vor und
wird in einem Fach oder in zwei Fächern absolviert.
Erweiterte Strukturen der Ausbildung
Wir am Seminar Lüdenscheid praktizieren Ausbildung in neuen Strukturen.
Komplementär zu den Ankertagen findet im Rahmen der Schwerpunkttage
individualisiertes Lernen in den Elementen Wahl-Angebote (W) und
Selbsorganisiertes Lernen (SoL) statt. Der Baustein Seminar in Schule (SiS)
ermöglicht im Rahmen der Professionellen Lerngemeinschaften (PLG) zudem eine
engere Verzahnung beider Lernorte.
Seite 9Die Struktur der Ausbildung im Seminar HRSGe
Das Ausbildungselement Schwerpunkttage
Individualisierte Ausbildung soll möglichst passgenaue Angebote für die Bedarfe
der Auszubildenden ermöglichen. Während einer Phase von Schwerpunkttagen
haben die Auszubildenden vier Mal die Möglichkeit ein Wahl-Angebot (W) zu
belegen. Je zwei dieser Angebote
werden an Vormittagen und zwei
weitere Angebote an Nachmittagen
organisiert.
Komplementär hierzu finden die
Fachseminare und das Kernseminar als
Schwerpunktseminare statt. Eine
Seminarzeit von 180 Minuten sowohl für die Wahl-Angebote als auch für die
Schwerpunktseminare bieten den nötigen Zeitraum, um intensives Arbeiten,
externe Lernorte oder externe Moderatorinnen und Moderatoren realisieren zu
können.
Wahl-Angebote
Die Wahlangebote sind die Kernstücke der Ausbildung. Sie richten sich nach den
Handlungsfeldern und Kompetenzen des Kerncurriculums.
Organisation der Wahl-Angebote
Wahl-Angebote werden den LAA/LiA an allen vier Schwerpunkttagen
einer Kernphase angeboten.
Pro Schwerpunkttag stehen mehrere Wahl-Angebote zu Verfügung und
können von den LAA/LiA frei gewählt werden.
Sie dauern jeweils vier Wochenstunden (= 180 Minuten).
Wahl-Angebote werden sowohl von SAB als auch von Externen und
LAA/LiA angeboten.
Wahl-Angebote können ersetzt werden durch eine SoL-Einheit.
Inhaltliche Gestaltung der Wahl-Angebote
Wahl-Angebote sind immer Handlungsfeldern und Kompetenzen aus
dem Kerncurriculum zuzuordnen.
Sie sind stets gruppenoffen und mindestens fächerverbindend bis
überfachlich gestaltet.
Wesentlich ist eine aktive Mitgestaltung des Arbeitsprozesses durch die
Auszubildenden.
Seite 10Die Struktur der Ausbildung im Seminar HRSGe
Selbstorganisiertes Lernen - SoL
Der Vorbereitungsdienst bereitet die Auszubildenden als eigenverantwortlich
Lernende auf die spätere berufliche Unterrichts- und Erziehungstätigkeit an
Schulen vor. In diesem Rahmen stellt die Einrichtung von Lerngruppen ein
sinnstiftendes Ausbildungselement dar. Auch die Professionellen
Lerngemeinschaften können für SoL genutzt werden. Eine weitere Option ist SoL
in Einzelarbeit.
Organisation des Selbstorganisierten Lernens
SoL findet in dem Zeitraum der Schwerpunkttage statt.
Eine SoL-Einheit entspricht vier Wochenstunden (= 180 Minuten).
SAB begleiten den Prozess und bestätigen diesen im Logbuch.
Inhaltliche Gestaltung der Selbstorganisierten Lernens
SoL hat eine von den Auszubildenden zu generierende
Erschließungsfrage zum Ausgangspunkt und ist immer an die
Handlungsfelder und Kompetenzen aus dem Kerncurriculum (KC)
anzudocken.
SoL Inhalte können erwachsen aus…
o dem Fachseminar
o dem Kernseminar
o PoB-C/UB
o Tätigkeiten für das Seminar (Moderation, Demokratische Prozesse,
Öffentlichkeitsarbeit, …)
o persönlichen Anliegen der LAA/LiA.
Der Abschluss des Selbstorganisierten Lernens
SoL hat keine inhaltliche Kontrolle als Abschluss, sondern wird durch
eine Reflexion beendet.
Der SoL-Reflexionsbogen ist dafür verbindlich zu nutzen.
Auf ausdrücklichen Wunsch von LAA und LiA oder SAB kann zusätzlich
ein Abschlussgespräch geführt werden.
Seminar in Schule – SiS
Das Format Seminar in Schule eröffnet die Möglichkeit für LAA und LiA
unterrichtliche und außerunterrichtliche Aktivitäten (z.B. Projekte,
fächerverbindendes Arbeiten, kollegiale Hospitation, Simulationen) zu gestalten
und zu reflektieren.
Seite 11Die Struktur der Ausbildung im Seminar HRSGe
Die Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Reflexion erfolgt in der Regel
durch die Professionellen Lerngemeinschaften. Dabei sollen bereits in der
Vorbereitung Schwerpunkte der Beobachtung und Erschließungsfragen festgelegt
werden. Für die Reflexion der Arbeit steht ein Seminartag zu Verfügung. Die SAB
unterstützen die Reflexion im ZfsL.
Hospitationen im Rahmen von SiS werden von den LAA und LiA im
Logbuch dokumentiert.
Fachseminar in Schule
Gemäß §11(3) der OVP umfasst die Ausbildung auch Hospitationen bei
Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern sowie bei Auszubildenden.
Das Seminar HRSGe fasst die kollegiale Hospitation als Instrument der Vernetzung,
des Austauschs und als Basis für anschießendes Feedback auf. Sie soll den
Teamgedanken fördern und allen Auszubildenden die Möglichkeit zu einem
Perspektivwechsel geben.
In der Regel treffen sich und arbeiten die Fachseminare im ersten Quartal der
Ausbildung je einmal an Ausbildungsschulen. Dabei nehmen sich LAA, LiA und SAB
in Unterrichtssituationen wahr, indem sie Unterrichtsvorhaben planen,
beobachten, durchführen und gemeinsam reflektieren.
Professionelle Lerngemeinschaften – PLG
Die OPV ermöglicht gemäß §10(2) neben den fächerbezogenen und
überfachlichen Seminaren auch andere Formen der Ausbildung. Im Lehramt
HRSGe arbeiten LAA und LiA ergänzend zu den Seminaren in regional vernetzten
Professionellen Lerngemeinschaften.
Dies schafft dem Grundsatz Geltung, der Lehrerinnen und Lehrer als autonome
und professionelle Lernerinnen und Lerner wahrnimmt, die ihren Beruf als
ständige Lernaufgaben begreifen. In den Professionellen Lerngemeinschaften
gehen LAA und LiA selbst gesteckte Entwicklungsaufgaben gemeinschaftlich und
in hohem Maß selbstständig an.
Professionellen Lerngemeinschaften bieten einen geschützten Raum für kollegiale
Beratung, Austausch, Reflexion und Evaluation. Sie können eine Arbeitsform für
das Format Seminar in Schule sein, bei dem LAA und LiA Unterricht gemeinsam
planen, durchführen und reflektieren oder anderen Fragestellungen nachgehen.
Seite 12Die Struktur der Ausbildung im Seminar HRSGe
Die Professionalität einer Lerngemeinschaft ergibt sich nicht aus einer
vorhandenen Expertise. Vielmehr liegt die Grundlage und Zielsetzung der
Professionellen Lerngemeinschaften darin, berufliche Haltungen, Werte,
Erfahrungen und Kompetenzen im Sinne der persönlichen Entwicklung der
Auszubildenden gezielt in den Blick zu nehmen. Hilfe-Kultur und die Bereitschaft,
Fehler als Lerngelegenheit zu sehen, zeichnet die Professionelle Lerngemeinschaft
als Wertegemeinschaft aus.
Mit der Anlage von Professionellen Lerngemeinschaften ist die langfristige
Etablierung einer kollegialen Beratungs- und Reflexionskultur intendiert. Jede PLG
wir durch eine Seminarausbilderin oder einen Seminarausbilder unterstützt. Die
innere sowie äußere Organisation, Unterstützungsstrukturen und die Evaluation
sind in der Handreichung Professionelle Lerngemeinschaften ausgeführt.
Die Arbeit in den Professionellen Lerngemeinschaften wird im
Logbuch dokumentiert.
3.7. Einsichtnahme in eine andere Schulform
Gemäß § 12 OVP nehmen die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
während des Vorbereitungsdienstes Einblick in die spezifischen Aufgaben und
Herausforderungen einer anderen Schulform.
Dieses „Praktikum“ umfasst im Lehramt HRSGe 20 Schulstunden und wird in der
Regel an Grundschulen oder sonderpädagogischen Förderschulen durchgeführt.
Möglichkeiten für die Einsichtnahme ergeben sich sowohl aus der Leitlinie Vielfalt
wie auch aus den Kompetenzen und Konkretionen der Handlungsfelder des aktuell
gültigen Kerncurriculums. Die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
sollen Erfahrungen in unterrichtlichen Tätigkeiten machen. Einblicke in
außerunterrichtlichen Tätigkeiten sind ergänzend möglich.
Das Praktikum kann an allen Grund- und Förderschulen im Ausbildungsbezirk des
Seminars HRSGe (Ennepe-Ruhr-Kreis, Märkischer Kreis, Hagen) sowie an den
Förderschulen im Ausbildungsbezirk des Seminars für Sonderpädagogische
Förderung des ZfsL Lüdenscheid absolviert werden.
Die Auszubildenden organisieren ihr Praktikum über den Zeitraum der Ausbildung
selbstständig und führen es in der Regel neben den unterrichtlichen
Verpflichtungen durch. Eine Dokumentation über das entsprechende Formular ist
obligatorisch. Dieses wird vom Seminar über die Homepage zur Verfügung gestellt.
Seite 13Die Struktur der Ausbildung im Seminar HRSGe
Abgeschlossen sein muss die Einsichtnahme in eine andere Schulform bis zum
Ende des vom Landesprüfungsamt (LPA) veröffentlichten Prüfungszeitraums des
jeweiligen Vorbereitungsdienstes. Dieser kann auf der Homepage des LPA
eingesehen werden.
3.8. Portfolio und Logbuch
Portfolio Praxiselemente
Im Portfolio Praxiselemente dokumentieren alle angehenden Lehrkräfte den
systematischen Aufbau berufsbezogener Kompetenzen in den einzelnen
Praxiselementen der Ausbildung. Dies ist durch das Lehrerausbildungsgesetz
(LABG) vorgegeben (LABG § 12 Absatz 1).
Im Vorbereitungsdienst führen die Auszubildenden in Eigenregie ihre
Portfolioarbeit kontinuierlich fort und schärfen reflexiv ihren Blick auf ihre
individuelle berufspraktische Kompetenzentwicklung. So wird die gesamte
Ausbildung als ein zusammenhängender berufsbiographischer Prozess
dokumentiert.
Logbuch – Ausbildung sichtbar machen
Eine individualisierte Ausbildung braucht ein Instrument, um die Akzente in der
Belegung von Veranstaltungen sichtbar zu machen und die Arbeitsverpflichtung
zu dokumentieren. Mit dem Logbuch – Ausbildung sichtbar machen wird eine
transparente Dokumentation ermöglicht.
Das Logbuch wird zu Beginn des
Vorbereitungsdienstes in Papierform ausgehändigt
und steht auch als Download über die Homepage zu
Verfügung. Um in der Balance zwischen
Selbstverantwortung und Begleitung das Logbuch
gewinnbringend zu nutzen, ist die
verantwortungsvolle und stringente Führung
Dienstpflicht der Lehramtsamtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärter sowie der Lehrerinnen und Lehrer
in Ausbildung.
Das Logbuch wird von den Auszubildenden selbstverantwortlich geführt und ist
verbindlich zu Terminen mit SAB oder in der PLG mitzuführen. Darin werden die
verbindlichen Ausbildungselemente eingetragen und so die Arbeit dokumentiert.
Seite 14Beratung im Seminar
Besondere Berücksichtigung finden:
Unterrichtsbesuche
Ausbildungsberatung und Personenorientierte Beratung,
Wahl-Angebote
SoL Elemente
BAR-trEff und BAR-chEck
Termine der PLG
Abgabe der Bescheinigung des Praktikums (§12 OVP)
Das Logbuch verbleibt am Ende der Ausbildung mit einer Aufbewahrungsfrist
von 12 Monaten im ZfsL.
4. BERATUNG IM SEMINAR
4.1. Eingangs- und Perspektivgespräch - EPG
Das Eingangs- und Perspektivgespräch ist ein eigenständiges Element der
Ausbildung und ist in §15 OVP 2011 in der jeweils gültigen Fassung geregelt.
Zu Beginn des Vorbereitungsdienstes führt die Lehramtsanwärterin oder der
Lehramtsanwärter zusammen mit der Kernseminarleitung und der oder dem
Ausbildungsbeauftragten der Schule das Eingangs- und Perspektivgespräch
§ 13(2) OVP. Es beruht auf einer von der Lehramtsanwärterin oder dem
Lehramtsanwärter gehaltenen Unterrichtsstunde.
Das Eingangs- und Perspektivgespräch nach § 15 OVP dient
einer ersten systematischen Selbstreflexion im Vorbereitungsdienst, die
im Portfolio schriftlich dokumentiert wird.
einer vorläufigen Standortbestimmung („Was kann ich schon? Was
bringe ich mit?“) auf der Grundlage der bereits erreichten
berufsbezogenen Kompetenzen.
der Formulierung von Kompetenzen und Entwicklung von Perspektiven,
welche die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter in den
besonderen Fokus nehmen wird.
einer Verknüpfung der beiden Unterstützungssysteme Ausbildungsschule
und Ausbildungsseminar.
als Auftakt für die personenorientierte Beratung.
Seite 15Beratung im Seminar
4.2. Beratungsanlass zur Hälfte des Vorbereitungsdienstes
Zum Ende des dritten Quartals organisiert das Seminar HRSGe den Beratungstag:
BAR-trEff.
Der gebildete Name BAR-trEff ist ein
Akronym derjenigen Begriffe, welche
den Kern der Beratungstage am
besten widerspiegeln.
Beraten, Austauschen, Reflektieren und Entwickeln legen nicht nur Fokus auf den
IST-Stand (Reflektieren und Beraten), sondern nehmen auch die zweite Hälfe des
Vorbereitungsdienstes (Entwickeln) in den Blick. Gleichzeitig wird der Aspekt
eines kommunikativen und kollaborativen Austauschens vor Ort miteinbezogen.
So finden an dem BAR-trEff einerseits Beratungsgespräche mit den
Seminarausbildenden statt. Andererseits werden – in Anlehnung an das Bar-
Camp-Format – Begleitveranstaltungen organisiert, aus deren Angeboten die
Auszubildenden zwischen den terminierten Gesprächen wahl-verpflichtend
auswählen.
Die Fach- und Kernseminarveranstaltungen entfallen an dem Tag des BAR-trEffs
und werden durch die Belegung der Begleitveranstaltungen, die
Beratungsgespräche der SAB und ein Treffen der PLG ersetzt.
Die Beratungsgespräche sind verpflichtende Ausbildungselemente und werden
initiativ von Auszubildenden im Benehmen mit den Seminarausbildenden
terminiert.
Eine inhaltliche Vorbereitung der Gespräche durch die Auszubildenden mit Hilfe
von bereitgestellten Reflexionsbögen ist verpflichtend und Grundlage der
Beratung. Durch die Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder wird den
Auszubildenden neben einer personenorientierten Beratung eine
kompetenzorientierte Einschätzung der Leistung im jeweiligen Fach zur Hälfte der
Ausbildung gegeben.
Das Begleitprogramm nimmt thematisch nicht nur, aber vorrangig die
Querschnittsthemen wie zum Beispiel Bildung für nachhaltige Entwicklung,
Vielfalt, Schule der Zukunft, Lehrer:innengesundheit oder auch Digitale Bildung in
den Fokus.
Seite 16Beratung im Seminar
4.3. Reflexionsanlass zum Ende des Vorbereitungsdienstes
Zum Ende des Vorbereitungsdienstes
findet der Tag des BAR-chEck statt.
Bilanzieren, Austauschen,
Reflektieren und Evaluieren stehen
für die Akzentuierung dieser
Zusammenkunft. In diesem Zusammenhang findet mit der Kernseminarleitung ein
Bilanzierungsgespräch auf Grundlage des Logbuches statt. Daneben treffen sich
ein letztes Mal die Professionellen Lerngemeinschaften, um die eigene
Entwicklung und auch die Arbeit im PLG-Team während der Zeit des
Vorbereitungsdienstes zu reflektieren.
4.4. Beratungsanlässe nach Unterrichtsbesuchen im
Fachseminar
Gemäß §11 (3) OVP finden in beiden Fächern in der Regel jeweils fünf
Unterrichtsbesuche statt. Sie dienen „[…] der Anleitung, Beratung, Unterstützung
und Beurteilung“ der Auszubildenden. Die Beratung und ihre Struktur orientieren
sich dabei an erwachsenenpädagogischen Prinzipien. Eine wertschätzende
Haltung zwischen allen beteiligten Personen bildet die Basis für eine gelungene
Kommunikation.
Die oder der Auszubildende entwickelt gemeinsam mit den an der Ausbildung
beteiligten Personen im ziel- und entwicklungsorientieren Gespräch Perspektiven
für eine fortschreitende, individuelle Professionalisierung. Im Sinne des
nachhaltigen Lernens dokumentieren die Auszubildenden ihre aus der Reflexion
erwachsenen Kompetenzen und Ziele.
Kurzgefasste Planung
Nach §11 (3) Satz 7 OVP legen die Auszubildenden zu den Unterrichtsbesuchen
eine kurzgefasste Planung vor. Neben formalen Angaben zum
Unterrichtsvorhaben bildet ein Planungschart das Kernstück der schriftlichen
Ausführungen.
Seite 17Beratung im Seminar
Ausgehend von der
Lerngruppe bilden die
Dimensionen des
Referenzrahmens
Schulqualität und die
Bildungsziele des 21.
Jahrhunderts die
übergeordnete Struktur. Diese
wird inhaltlich konkretisiert
mit den für den Unterricht
wesentlichen didaktischen, methodischen und medialen Entscheidungen. Hierbei
sind die Kernlehrpläne der Fächer sowie der Medienkompetenzrahmen Grundlage
für die Begründungszusammenhänge.
4.5. Beratungselemente im Kernseminar
Die Beratungselemente im Kernseminar nach Absatz 4 und 5 § 10 OVP finden im
beurteilungsfreien Raum statt. Sie sind verpflichtend und gliedern sich auf in
zwei personenorientierte Beratungen mit Coachingelementen (PoB-C) und zwei
Ausbildungsberatungen im Zusammenhang mit einer Einsichtnahme in den
Unterricht der Auszubildenden.
Personenorientierte Beratung ist grundsätzlich als 4-Augen-Gespräch angelegt,
erfolgt in einem „geschützten Raum“ unter Beachtung der Schweigepflicht. Durch
die PoB-C werden im interaktiven Beratungs- und Begleitungsprozess
Handlungskompetenzen und Haltungen systematisch gefördert.
Ziel ist es, über die Aspekte der fachlichen und überfachlichen
Ausbildungsberatung hinaus das Rollen- und Aufgabenverständnis der
Auszubildenden nach OVP und OBAS professionell zu begleiten.
Konkret geht es um die
persönliche professionsbezogene Standortbestimmung,
Entwicklung von persönlichen Zielen und Perspektiven,
Entwicklung von Problemlösungs- und Umsetzungsstrategien im
komplexen Arbeitsalltag,
Analyse und Weiterentwicklung des eigenen Lehrerverhaltens,
Klärung der eigenen Rolle, auch unter Einbeziehung der eigenen
diversitätsspezifischen Erwartungen und Vorstellungen.
Seite 18Kooperation aus der Perspektive des Seminars
Angestrebt wird die bestmögliche Entfaltung aller individuellen Potenziale für die
berufliche Aufgabe als Lehrerin und Lehrer.
Ausbildungsberatung im Zusammenhang mit Einsichtnahme in den Unterricht
erfolgt einmal ausschließlich mit der jeweiligen Kernseminarleitung
(„Unterrichtsmitschau“). Bei der weiteren Ausbildungsberatung besteht die Wahl
zwischen einer „Unterrichtsmitschau“ (s.o.) und einem Unterrichtsbesuch mit
Fachleitung und Kernseminarleitung.
Alle verbindlichen Ausbildungsberatungen sind vor der Staatsprüfung
wahrzunehmen. Idealerweise verteilen sich die Beratungsanlässe auf den
gesamten Ausbildungszeitraum.
5. KOOPERATION AUS DER PERSPEKTIVE DES SEMINARS
Neben der Kooperation mit den Lehrämtern Sonderpädagogische Förderung und
Grundschule bereichert die Zusammenarbeit mit weiteren Bildungspartnern die
Ausbildung um wesentliche Elemente.
Insbesondere sei an dieser Stelle das Kooperationsprojekt Schule-der-Vielfalt in
NRW genannt, mit dem das ZfsL Lüdenscheid seit 7.10.2021 einen
Kooperationsvertrag abgeschlossen hat.
Für eine Berufswahlberatung für Auszubildende, die sich gegebenenfalls während
des Vorbereitungsdienstes in eine andere berufliche Richtung orientieren
möchten, steht das Arbeitsamt Lüdenscheid zur Verfügung.
Des Weiteren findet während der 18-monatigen Ausbildung eine Zusammenarbeit
mit vielfältigen Behörden, Stellen und Experten statt. Für die Vielfalt der
Kooperationspartner stehen unter anderem
Schule für Kinder beruflich Reisender
Wegweiser e.v. Präventionsprogramm gegen Islamismus
Schulpsychologische Beratungsstellen im Ausbildungsbezirk
Deutsches Rotes Kreuz
…
Seite 19Partizipation im Seminar
6. PARTIZIPATION IM SEMINAR
Ganz im Sinne demokratischer Prozesse pflegen das Seminar HRSGe die
Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten der Ausbildung (LAA/LiA, SAB und
Seminarleitung). Etabliert ist sie zum Beispiel in der Mitarbeit des Sprecherrates
bei der Weiterentwicklung des Ausbildungsprogramms auf Grundlage von
Evaluationen und der Gestaltung des Seminarlebens (Bergfest, Abschlussfeier,
etc.).
Des Weiteren fließen thematische Wünsche der LAA/LiA in die Auswahl der WAHL-
Angebote ein. Ebenso ist die Durchführung von WAHL-Angeboten durch LAA/LiA
ausdrücklich erwünscht.
7. EVALUATION IM SEMINAR
Die Optimierung der Ausbildung ist dem Seminar HRSGe ein wichtiges Anliegen.
Evaluationen gehören deshalb als wesentliche Bausteine zu einem
professionellen, agilen Entwicklungsprozess.
Sie werden systemisch erhoben
am Ende von Wahl-Angeboten
am Ende des Vorbereitungsdienstes
anlassbezogen nach Erprobung von neuen Ausbildungselementen
…
8. GÜLTIGKEIT
Das Ausbildungsprogramm HRSGe ist letztmalig am 30. Juni 2021 von der
Konferenz des ZfsL verabschiedet worden.
Die vorliegende, aktualisierte Entwurfsfassung ist auf Basis der Beschlüsse der
Seminarkonferenz vom 25. April 2022 geändert worden.
Es tritt zum 1. Mai 2022 in Kraft und hat bis zum Beschluss durch die Konferenz
des ZfsL auch in der Entwurfsfassung Gültigkeit.
Seite 20Sie können auch lesen