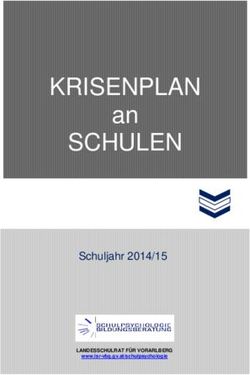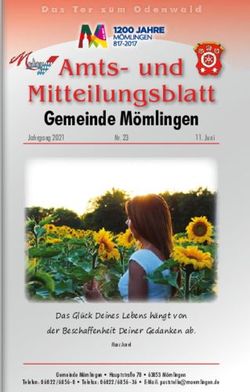Auswertungen und Analysen zur International Grid Control Cooperation
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
9. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Auswertungen und Analysen zur International Grid
Control Cooperation
Steffen Fattler 1, Christoph Pellinger
Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V., Am Blütenanger 71, 80995 München,
+49 (0)89 158121-57, sfattler@ffe.de, www.ffe.de
Kurzfassung:
Die International Grid Control Cooperation (IGCC) ist eine Kooperation zwischen sieben
europäischen Übertragungsnetzbetreibern, die darauf abzielt den Einsatz von
Sekundärregelenergie zu reduzieren. Strukturell kann sie als Erweiterung des deutschen
Netzregelverbundes betrachtet werden, jedoch beschränkt auf dessen erstes Modul, der
Saldierung des Sekundärregelenergiebedarfs vor dem tatsächlichen Abruf. Im Rahmen
dieses Beitrags werden zunächst die regulatorischen Rahmenbedingungen der Kooperation
sowie die der Mitgliedsländer im Bereich der Sekundärregelleistung erarbeitet. Darauf
aufbauend folgt eine detaillierte Auswertung der von den Übertragungsnetzbetreibern
veröffentlichten Daten zum Sekundärleistungsabruf mit dem Ziel die durch die Teilnahme am
IGCC erzielten Ersparnisse energetisch sowie monetär zu quantifizieren.
Keywords: Regelenergie, IGCC, Europäischer Strommarkt
1. Einleitung
Seit dem Beschluss des Europäischen Rates vom 4. Februar 2011 zur Realisierung eines
integrierten europäischen Strombinnenmarktes bis 2014 wird dessen Vorbereitung im
Bereich der klassischen Strombörsen konsequent vorangetrieben. Im Gegensatz dazu
existieren im Bereich der Regelenergiemärkte noch immer stark ausgeprägte regulatorische
Diskrepanzen, sowie eine fast vollständige Entkopplung entlang der Ländergrenzen. Die
daraus resultierenden Ineffizienzen sollten im Rahmen der europäischen
Strommarktkopplung gehoben werden. Zwar existieren einige bilaterale Kooperationen,
hauptsächlich im Bereich der Primärregelleistung, diese beschränken sich bisher allerdings
auf die teilweise gemeinsame Ausschreibung der vorgehaltenen Leistungen (Bsp.:
Niederlande/Deutschland, Schweiz/Deutschland). Ein Effekt dieser unabhängig voneinander
geführten Regelzonen sind gegenläufige, und somit, rein physikalisch aus Sicht des
Gesamtnetzes gesehen, unnötige Regelleistungsabrufe. Genau an dieser Stelle greift die
Ende 2011 gegründete, und seit dem mehrfach erweiterte International Grid Control
Cooperation an. Sie zielt darauf ab durch eine regelzonenübergreifende Onlinesaldierung
der Leistungsungleichgewichte vor dem tatsächlichen Abruf die unnötigen Abrufe zu
unterbinden und somit die Gesamtsystemkosten zu reduzieren. Im Rahmen der vorliegenden
Veröffentlichung soll untersucht werden wie sich Regelenergiemärkte im Bereich der
1
Jungautor
Seite 1 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Sekundärregelenergie der beteiligen Regelzonen im Verlauf der letzten Jahre entwickelt
haben. Außerdem soll eine energetische wie monetäre Quantifizierung des Einflusses der
IGCC auf diese Entwicklung durchgeführt werden.
Zu Beginn des Berichts soll zunächst der im Rahmen der IGCC verwendete
Saldierungsvorgang und die Abrechnung der ausgetauschten Energiemengen erläutert
werden. Im darauf folgenden Kapitel werden die den vorgenommenen Auswertungen
zugrundeliegenden Annahmen erläutert. Der Fokus der Analyse liegt dabei auf dem Einfluss
der IGCC auf die Regelenergiemärkte. Aus diesem Grund wird ausschließlich die
Entwicklung der SRL und im Speziellen die der abgerufenen Energiemengen und den mit
Abrufen verbundenen Kosten betrachtet. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der
Ergebnisse in Bezug auf die durch die IGCC eingesparten Regelenergiemengen und Kosten
sowie den der Regelenergiebereitstellung zugrundeliegenden Regularien. Für detaillierte
Auswertungen der Marktstrukturen und Einsatzcharakteristika der einzelnen Mitglieder im
Bereich der Sekundärregelleistung sowie eine Darstellung der Marktdaten jedes
Mitgliedslandes inklusive der durch die Kooperation vermiedenen SRL-Abrufe und den damit
verbundenen Kosteneinsparungen sei auf den Anhang verwiesen.
Die Arbeit entstand in dem Projekt „PiVO - Tanken im Smart Grid“ (Förderkennzeichen:
16SNI005B), das von den Bundesministerien für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS), Wirtschaft und Technologie (BWMi), Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(BMU) und Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität
zusammen mit weiteren acht Partnern aus Industrie und Forschung gefördert wird.
2. Grundlagen IGCC – International Grid Control Cooperation
Innerhalb der deutschen Regelzone sind die vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB), Tennet,
Amprion, Transnet BW und 50Hertz für die Wahrung eines stabilen Netzbetriebs
verantwortlich. Vor der Implementierung des deutschen Netzregelverbundes erfolgte die
Netzregelung unabhängig voneinander innerhalb der vier Regelzonen.
Seit 2001 beschaffen sich die vier Übertragungsnetzbetreiber die Regelleistungsprodukte
über die gemeinsame Ausschreibungsplattform regelleistung.net. Die gemeinsame
Ausschreibung soll eine möglichst kostenoptimale Beschaffung der Regelleistung
ermöglichen. Zu Beginn war jeder der ÜNB alleine für die Frequenzhaltung in seiner
Regelzone zuständig. Dies führte oft dazu, dass zum gleichen Zeitpunkt eine Überdeckung
in einer Regelzone sowie eine Unterdeckung in einer anderen Regelzone kompensiert
wurden, obwohl physikalisch bereits ein gegenseitiger Ausgleich gegeben war. Um diese
überflüssigen Kosten zu minimieren entstand eine intensive Kooperation der
Übertragungsnetzbetreiber, die schließlich 2010 in der Gründung des bundesweit optimierten
Netzregelverbunds (NRV) resultierte (siehe Abbildung 1).
Seite 2 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Abbildung 1: Entwicklung des Netzregelverbunds (Eigene Darstellung)
Ausgehend von den positiven Erfahrungen des deutschen Netzregelverbundes erschien eine
internationale Erweiterung außerordentlich vielversprechend. Laut Prognosen der
teilnehmenden Partner sollen durch diese Kooperation je Teilnehmer und Jahr Einsparungen
von bis zu 10 Mio. € möglich sein [1]. Zunächst beschränkt auf Modul 1, der Vermeidung von
gegenläufigem SRL Einsatz durch vorherige Saldierung der Leistungsungleichgewichte,
wurde der Netzregelverbund nach und nach durch weitere Länder erweitert (siehe
Abbildung 2).
Abbildung 2: Entwicklung des IGCC (Eigene Darstellung)
Grundsätzlich ist die austauschbare Leistung innerhalb der IGCC auf die in den einzelnen
Mitgliedsländern vorgehaltene Sekundärregelleistung begrenzt und beläuft sich damit
insgesamt auf etwa 3780 MW (Stand 2015, [1]). Sie teilt sich wie folgt auf die Mitgliedsländer
auf:
Tabelle 1: Vorgehaltene SRL der IGCC-Mitglieder
Deutschland: ± 2300 MW
Dänemark: ± 300 MW
Niederlande: ± 300 MW
Schweiz: ± 400 MW
Tschechien: ± 350 MW
Belgien: ± 140 MW
Österreich: ± 200 MW
Seite 3 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
2.1 Technische Umsetzung
Die bisherige Kooperation innerhalb der IGCC beschränkt sich auf das erste Modul des
deutschen Netzregelverbundes, der Saldierung von Leistungsungleichgewichten vor dem
tatsächlichen Abruf der SRL. Zu diesem Zweck tauschen die Teilnehmer über das
Optimierungssystem des deutschen Netzregelverbundes in Echtzeit die
Leistungsungleichgewichte ihrer Regelzonen aus. Auf dieser Basis wird das
Saldierungspotential ermittelt und die angepassten Werte an die Leistungs-Frequenz-Regler
der beteiligten Regelzonen übermittelt. Somit wird ein gegenläufiger Abruf innerhalb der
Verbundzone vermieden, die im Gesamtsystem eingesetzte Menge an SRL wird reduziert.
Zu beachten ist, dass der mögliche Austausch an den Kuppelstellen zwischen den einzelnen
Regelzonen auf die nach Abschluss des Intraday-Handels freien Kapazitäten beschränkt ist.
Dies und die Tatsache, dass diese Art der Kooperation keinen Eingriff in die
Regelmarktstrukturen der teilnehmen Länder darstellt, ermöglicht eine relativ unkomplizierte
Realisierung und Einbindung weiterer Teilnehmer.
2.2 Verrechnungsmodell
Das implementierte Verrechnungsmodell, auch Settlement Modell genannt, zielt darauf ab,
die durch die Saldierung der SRL eingesparten Kosten möglichst fair auf die teilnehmenden
Regelzonen zu verteilen. Hierbei ist zu beachten, dass durch die Vermeidung von positiver
Regelenergie zwar grundsätzlich eine Kostenersparnis erzielt wird, durch die Vermeidung
von negativer Regelenergie bei positiven Arbeitspreisen dem beteiligten ÜNB aber auch ein
Erlös entgehen kann. Aufgrund des systematischen Preisspreads zwischen positiver und
negativer Regelenergie sind die erzielten Ersparnisse dabei meistens größer als die
entgangenen Erlöse, sodass im Gesamtsystem insgesamt eine finanzielle Einsparung erzielt
werden kann. Um diese fair auf die beteiligten Regelzonen zu verteilen wurde ein
internationales Settlementpreis-Modell entwickelt welches vor allem den folgenden
Anforderungen gerecht werden soll [1]:
• Ein Preis für jede Abrechnungsperiode (eine Viertelstunde)
• Berücksichtigung des Wertes des vermiedenen Abrufs von Sekundärregelenergie
(Opportunitätskosten)
• Möglichst einfache und transparente Berechnung
• Einfach Erweiterbarkeit um weitere Teilnehmer
In den Mitgliedsländern der IGCC existieren zum Teil sehr unterschiedliche regulatorische
und marktwirtschaftliche Randbedingungen in der Beschaffungsstruktur und Abrechnung von
Regelleistung. Deswegen berücksichtigt das Settlement-Modell den für jedes Mitgliedsland
individuell berechneten Opportunitätspreis welcher auf den jeweiligen Opportunitätskosten
(also den Kosten, die durch die Saldierung vermieden werden und die damit die strukturellen
Unterschiede in der Regelenergiebeschaffung berücksichtigen) basiert. So soll erreicht
werden, dass keinem der Mitglieder über einen längeren Zeitraum ein finanzieller Nachteil
entsteht. Auf die genaue Berechnung des jeweiligen Opportunitätspreises wird in den
folgenden Kapiteln zu den Marktstrukturen der einzelnen Mitgliedsstaaten eingegangen. Der
Settlement-Preis selbst hängt von der ausgetauschten Energiemenge der Mitglieder und den
jeweiligen Opportunitätspreisen ab und wird für jede Abrechnungsperiode nach Formel 1
berechnet.
Seite 4 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Formel 1
CIGCC: Resultierender Settlementpreis in €/MWh
Ei,Imp: Importierte Energiemenge der Regelzone i in MWh
Ei,Exp: Exportierte Energiemenge der Regelzone i in MWh
Ci,Imp: Opportunitätspreis der Regelzone i für positive SRL in €/MWh
Ci,Exp: Opportunitätspreis der Regelzone i für negative SRL in €/MWh
Hierbei ist zu beachten, dass alle Energiemengen mit dem Wert ihres Betrages in die
Rechnung eingehen. Die Vorzeichenkonvention der Opportunitätskosten ist der folgenden
Tabelle zu entnehmen:
Tabelle 2: Vorzeichenkonvention Opportunitätspreis
Zahlungsrichtung Opportunitätspreis
Positive SRL ÜNB zahlt an Lieferant (+)
Positive SRL Lieferant zahlt an ÜNB (-)
Negative SRL ÜNB zahlt an Lieferant (-)
Negative SRL Lieferant zahlt an ÜNB (+)
Der so berechnete Settlementpreis gilt für alle Mitglieder des IGCC für jeweils eine
Viertelstunde und ist für Importe zu zahlen und wird für Exporte vergütet. Die resultierenden
Zahlungsströme für jedes Land und jede Abrechnungsperiode ergeben sich
dementsprechend nach Formel 2:
Formel 2
Mi,IGCC: Resultierender Zahlungsstrom Regelzone i in €
Hierbei entspricht ein positiver Zahlungsstrom einer Zahlung, ein negativer einer Einnahme.
Da die Opportunitätskosten aufgrund der Vermarkungsstruktur einzelner Länder erst nach
der tatsächlichen Lieferung der Energiemengen berechnet werden können, wird auch der
Settlement-Preis ex post ermittelt.
3. Erläuterungen zu den vorgenommenen Auswertungen und zur
Datengrundlage
Die Daten zu abgerufener Sekundärregelleistung und den mit den Abrufen verbundenen
Arbeitspreisen werden von den jeweiligen Übertragungsnetzbetreibern der Regelzone in
regelmäßigen Abständen auf deren Websites veröffentlicht [2]-[8]. Die im Zusammenhang
mit der IGCC ausgetauschten Energiemengen sowie die entsprechenden Settlementpreise
werden von den deutschen Übertragungsnetzbetreibern auf der Internetplattform
regelleistung.net zur Verfügung gestellt [8].
Seite 5 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Die Summen der Abrufe von SRL und der vermiedenen Abrufe durch die IGCC lassen sich
durch die Aufsummierung der für alle Länder vorhandenen Viertelstundenwerte errechnen.
Die Berechnung der resultierenden Kosten der SRL-Abrufe geschieht durch Multiplikation
der abgerufenen Regelenergiemenge mit den entsprechenden Arbeitspreisen zu jeder
Viertelstunde. Die durch IGCC-Saldierung vermiedenen Kosten werden anhand der Formel 3
berechnet:
Formel 3
KIGCC,saved: Durch IGCC-Saldierung vermiedene Kosten in €
APp_SRL Arbeitspreis für positive SRL in €/MWh
APn_SRL: Arbeitspreis für negative SRL in €/MWh
CIGCC: IGCC-Settlementpreis in €/MWh
EImp: Importierte Energiemenge in MWh
EExp: Exportierte Energiemenge in MWh
Diese Formel beruht auf der Annahme, dass die durch die IGCC vermiedenen SRL-Abrufe
ohne Saldierung trotzdem vollständig abgerufen und über den entsprechenden Arbeitspreis
vergütet werden müssten. Von diesen theoretischen Kosten werden dann die tatsächlich
entstandenen Kosten, die durch den Austausch über die IGCC entstehen, subtrahiert. Bei
dieser Berechnung treten hauptsächlich zwei Probleme auf, welche zu Abweichungen von
den tatsächlichen Werten führen können.
• Ersteres betrifft alle Länder in denen die eingesetzten Energiemengen nach dem
Merit-Order-Prinzip vergütet werden. Der veröffentlichte Preis der
Abrechnungsperiode entspricht hier dem mengengewichteten Mittelwert der
abgerufenen Energiemenge. Zur Berechnung der tatsächlichen Ersparnisse wäre
jedoch der mengengewichtete Mittelwert der abgerufenen Energiemenge ohne IGCC
heranzuziehen, was zu einem höheren Referenzpreis führen würde. Dieser müsste
über die individuellen Merit-Order-Listen (MOL) neu berechnet werden. Diese MOL
stehen aber nur für die deutsche Regelzone zur Verfügung, sodass eine
Neuberechnung der tatsächlichen Arbeitspreise nicht möglich ist. Der tatsächliche
mittlere Arbeitspreise wäre also in jedem Fall höher als der von den ÜNB
veröffentlichte. Die aus der Berechnung hervorgehenden Ersparnisse sind also als
Minimum zu betrachten und würden eigentlich höher ausfallen.
• Des Weiteren werden in allen Ländern nur dann Arbeitspreise veröffentlicht, wenn
auch tatsächlich ein Abruf vorliegt. Wird nun der gesamte Bedarf an SRL durch den
IGCC-Austausch kompensiert, wird ein mittlerer Arbeitspreis von 0 €/MWh
veröffentlicht welcher so auch in Formel 3 eingehen würde. Die theoretischen Kosten
würden also falsch berechnet werden. Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen,
gehen in diese Formel nicht die viertelstündlich veröffentlichten Arbeitspreise sondern
deren monatliche Mittelwerte ein.
4. Ergebnisse
Insgesamt konnten durch die IGCC deutliche Einsparungen erzielt werden. Diese sollen im
Verlauf dieses Kapitels zusammenfassend dargestellt und diskutiert werden. Als Einstieg soll
zunächst die Bruttostromerzeugung und das Erzeugungsportfolio aller Mitglieder der IGCC
Seite 6 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
miteinander verglichen werden, um eine Übersicht über die Proportionen der einzelnen
Regelzonen zu erlangen (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4, links).
100%
90%
80%
Sonstige
70%
Erneuerbare
60%
Laufwasser
50%
Pumpspeicher
40%
Kernenergie
30% Öl
20% Gas
10% Kohle
0%
Abbildung 3: Erzeugerportfolio der IGCC Mitglieder 2012 (Eigene Darstellung, Daten
von [4] & [9])
Die Bruttostromerzeugung der deutschen Regelzone ist mit 629 TWh etwa sechsmal so groß
wie die der nächstkleineren Regelzone der Niederlande. Mit Ausnahme Dänemarks befinden
sich die aller übrigen Regelzonen im Bereich zwischen etwa 70 und 100 TWh pro Jahr.
Dänemark besitzt mit etwa 30 TWh die mit Abstand kleinste Bruttostromerzeugung. Der
Regelenergiebedarf hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Es wird angenommen, dass
die absolute Höhe aber grundsätzlich mit der Größe des Regelgebiets, also auch der
Bruttostromerzeugung in Verbindung steht. Um eine Vergleichbarkeit der Werte der
einzelnen Länder zu ermöglichen, wurde deswegen die Bruttostromerzeugung als
Normierungsgröße gewählt. In Abbildung 4 sind links die Bruttostromerzeugung und rechts
der jährliche Durchschnitt von abgerufener SRL der einzelnen Länder dargestellt.
Abbildung 4: Bruttostromerzeugung (BSE) 2012, fiktiver Jahresdurchschnitt der
eingesetzten SRL (Eigene Darstellung, Daten von [2]-[8])
Da die Zeiträume zu denen Daten zur Regelenergie zur Verfügung stehen nicht alle gleich
sind, wurden bei der Berechnung der durchschnittlichen Abrufmenge pro Jahr nur die Jahre
2012 bis 2014 berücksichtigt. Außerdem ist in Abbildung 4, links die durch die
Bruttostromerzeugung des Landes normierte Höhe der Jahressumme von abgerufener SRL
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Unterschiede der normierten Energiemenge
deutliche weniger ausgeprägt sind als die der absoluten Menge. Unterschiede bei dieser
normierten Höhe sprechen nicht zwangsläufig für ein „besseres“ Regelsystem oder höhere
Prognosegüten, sondern können beispielsweise auch durch eine andere Zielsetzung in der
Seite 7 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Regelungstrategie erklärt werden. Den höchsten Wert nimmt hier beispielsweise Belgien ein,
dessen ÜNB Elia seinen Fokus deutlich mehr auf die Regelung durch SRL anstatt
Tertiärregelleistung gesetzt hat. Die TRE-Abrufmengen sind dafür dementsprechend deutlich
geringer als in vergleichbaren Regelzonen.
Bei der Betrachtung der Einsparungen durch die Teilnahme an der IGCC ist zu beachten,
dass die Mitglieder zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten beigetreten sind. Um eine
Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurde die mittlere Abrufmenge pro Monat für jedes Land
berechnet und dieses auf ein Jahr extrapoliert um zur Darstellung der vermiedenen
Abrufmengen in Abbildung 4, rechts zu gelangen.
Einsparungen der eingesetzten SRL
Abbildung 5 zeigt links die relative Einsparung durch die Teilnahme am IGCC, bezogen auf
die gesamte benötigte SRL der jeweiligen Regelzone, rechts ist die durchschnittliche
absolute Einsparung pro Jahr dargestellt. Wie zu erwarten ist diese absolute Einsparung
vom Bedarf der Länder abhängig und dementsprechend in der „größten“ Regelzone
Deutschland am größten. Es ist weiterhin zu erwarten, dass die austauschbare Menge der
Länder unter anderem von dem mittleren Bedarf der Gesamtzone abhängt und somit gerade
die möglichen Einsparungen in Deutschland begrenzt. Da die dänische Regelzone im
Vergleich einen prinzipiell sehr niedriegen Grundbedarf hat, fällt die relative Ersparnis
bezogen auf diesen mit über 50 % bei positiver SRL verhältnismäßig groß aus, während sie
in Deutschland relativ gesehen eher gering ausfällt. Im verbundweiten Durchschnitt konnte
durch die Teilnahme am IGCC die abgerufene SRE um etwa 30 % reduziert werden.
Abbildung 5: Durchschnittliche relative und absolute Einsparungen, (Eigene
Darstellung, Daten von [2]-[8])
Hier ist anzumerken, dass die Größe und der damit einhergehende Bedarf an SRL nur eine
von vielen Einflussfaktoren auf die über den IGCC ausgetauschte Energiemenge darstellt.
Außerdem spielen die freien Kuppelstellenkapazitäten zwischen den Ländern und die
geographische Lage innerhalb der Verbundzone eine entscheidende Rolle. Insgesamt
konnten seit Gründung der IGCC bis Dezember 2014 jeweils 2,98 TWh positive und negative
SRL-Abrufe vermieden werden.
Monetäre Einsparungen
Im Folgenden werden die monetären Einsparungen, die durch die Saldierung erzielt werden
konnten gegenübergestellt. In Abbildung 6 sind die finanziellen Einsparungen pro Land und
Jahr dargestellt, die nach den in Kapitel 1.2 vorgestellten Annahmen berechnet wurden.
Seite 8 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Abbildung 6: Durch IGCC eingesparte Kosten (Eigene Darstellung, Daten von [2]-[8])
Auffällig ist hier, dass die Einsparungen Österreichs besonders groß ausfallen, obwohl der
Beitritt zum IGCC erst im April 2014 umgesetzt wurde. Die lässt sich durch die sehr niedrigen
Arbeitspreise im Bereich der negativen Sekundärregelenergie erklären. Der österreichische
Übertragungsnetzbetreiber APG muss die Anbieter negativer SRE bei Abruf vergüten,
während der Zahlungsstrom in allen anderen an der IGCC beteiligten Ländern diesem
entgegengesetzt ist. Auf eine weitere Untersuchung dieses Sachverhalts wird im Rahmen
dieser Veröffentlichung verzichtet. Für eine detailliertere Darstellung sei allerdings hier noch
einmal auf die länderspezifischen Auswertungen im Anhang verwiesen. Insgesamt konnten
im IGCC-Gebiet seit Bestehen der Gründung allein durch die Saldierung der
Leistungsungleichgewichte vor dem eigentlichen Abruf von SRL Einsparungen von etwa
158 Mio. € erzielt werden. Über die Bildung eines extrapoliertes Jahresmittels aus den
monatlichen Mittelwerten der einzelnen Teilnehmer berechnen sich mittlere jährliche
Einsparungen von 10,48 Mio. € je internationalem Teilnehmer, womit die nach [1]
prognostizierten jährlichen Einsparungen von ca. 10 Mio. € bestätigt werden können. Dabei
ist allerdings zu beachten, dass die individuellen, mittleren jährlichen Ersparnisse von Land
zu Land deutlich variieren und von verschiedenen Faktoren abhängen, welche im Verlauf
dieses Berichts beschrieben wurden. Dazu zählen unter anderem die grundsätzliche Höhe
des Regelenergiebedarfs sowie die individuellen Vergütungsstrukturen der einzelnen
Regelenergiemärkte.
Weitere Auswirkungen der Kooperation
Die im Verlauf dieses Kapitels analysierten und dargestellten Einsparungen betreffen
zunächst einmal nur die tatsächlich abgerufene Menge an SRL. Aufgrund der
systematischen Zusammenhänge im Bereich der Regelenergie ist zu erwarten, dass eine
Reduktion der abgerufenen SRL auch den Bedarf an TRE beeinflussen wird. Außerdem ist
davon auszugehen, dass auf lange Sicht auch die Dimensionierung der vorzuhaltenden SRL
durch den IGCC beeinflusst wird, da die verwendeten Dimensionierungsverfahren meistens,
wie z.B. in Deutschland [10], die im vorhergehenden Dimensionierungszeitraum eingesetzte
Regelenergie als Eingangsgröße mit berücksichtigen.
Vergleich der SRL-Regularien
In Tabelle 3 sind die Rahmenbedingungen der SRL-Abwicklung der einzelnen
IGCC-Mitglieder zusammenfassend dargestellt ([3]-[7], [11]-[14]). Es wird deutlich, dass die
Marktstrukturen der IGCC-Mitglieder zwar zum Teil ähnlich sind, sie insgesamt aber doch
starke strukturelle Unterschiede aufweisen. Ohne eine weitere Harmonisierung dieser
Seite 9 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Rahmenbedingungen ist eine Ausweitung der Kooperation nach dem Vorbild des deutschen
Netzregelverbunds nicht umsetzbar.
Tabelle 3: Übersicht der SRL-Regularien
Leistungsvorhaltung DE DK NL CH CZ BE AT
Verm arktungsinteravall w öchentlich monatlich jährlich w öchentlich N/A jährlich w öchentlich
Anzahl von Produkten 4 1 1 1 N/A 2 6
Mindestangebotsgröße 5 MW N/A N/A 5 MW 20 MW N/A 5 MW
Sym m etrisches Produkt nein ja ja ja ja nein nein
Produktgröße zeitl. 12 h 1 Monat 1 Jahr 1 Woche N/A 1 Jahr 12h
Vergütung nach… pab pab pab pab pab u.a. pab pab
Abruf
Zw eiter Markt? nein nein ja nein nein ja nein
7% 15 %
Aktivierungs- 30 sek - 2 MW/min,
5 min Rampe, N/A Rampe, max 5 min
geschw indigkeit 15 min max 10 min
max 15 min 15 min
Art des Abrufs MO pro-rata MO pro-rata pro-rata pro-rata MO
Preisbeschränkung nein entfällt ja entfällt enfällt ja nein
Abrechungsintervall 15 min 1h 15 min 15 min 1h 15 min 15 min
Vergütung nach… pab Spot +/- x MO Spot +/- x festgelegt pab pab
5. Fazit
Ziel der vorliegenden Studie war es, den Einfluss der International Grid Control Cooperation
auf die Regelenergiemärkte der beteiligten Regelzonen energetisch, wie monetär zu
quantifizieren. In diesem Zusammenhang wurden zunächst die regulatorischen
Rahmenbedingungen im Bereich der Beschaffung, des Einsatzes und der Vergütung von
Sekundärregelleistung herausgearbeitet. Dabei ergab sich, dass die Regularien starke
strukturelle Unterschiede aufweisen, wodurch eine weitere Kopplung der Märkte, analog der
des deutschen Netzregelverbundes, ohne eine Angleichung dieser Regularien zunächst als
nicht umsetzbar betrachtet werden muss. Bei der Auswertung der historischen Daten konnte
festgestellt werden, dass durch die Einführung der IGCC in allen beteiligten Regelzonen
energetisch, wie monetär signifikante Einsparungen erzielt werden konnten. Die von den
ÜNB der deutschen Regelzone prognostizierte Einsparungen von 10 Mio. € pro
internationalem Teilnehmer und Jahr konnten bestätigt werden. Für weiterführende
Auswertungen zu den Regelenergiemärkten der beteiligten Regelzonen, sowie einen
Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen in diesem Bereich sei auf den Anhang und [15]
verwiesen.
Seite 10 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Anhang
1. Deutschland
Deutschland ist mit einer Bruttostromerzeugung von 627 TWh [9] das erzeugungsstärkste
Mitglied der IGCC. Die Fläche des Landes ist in vier Regelzonen aufgeteilt, für die jeweils
einer der vier ÜNB Tennet, Amprion, TransnetBW und 50Hertz verantwortlich ist. Seit dem
endgültigen Zusammenschluss der vier Regelzonen zum Netzregelverbund im Jahre 2012
beschaffen sich die vier ÜNB die benötigte Regelleistung über die gemeinsame
Internetplattform www.regelleistung.net. Auch der Abruf der Regelenergie geschieht
regelzonenübergreifend über einen zentralen Merit-Order-List-Server.
1.1 Ökonomische und regulatorische Grundlagen der Sekundärregelleistung
Die Dimensionierung der benötigten SRL obliegt in Deutschland den ÜNB der jeweiligen
Regelzone. Das Dimensionierungsverfahren basiert auf dem Ansatz der Faltung von
Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungen und berücksichtigt auf diese Weise verschiedenste
Ursachen für Bilanzungleichgewichte wie Kraftwerksausfälle, Lastprognosefehler und
Fahrplansprünge. Die Dimensionierung wird alle drei Monate durchgeführt und führt aktuell
zu einer ausgeschriebenen Reserveleistung von 2003 MW bei positiver und 1919 MW bei
negativer SRL [7].
Vermarktung der Leistungsvorhaltung
Die vorzuhaltende Leistung wird in Deutschland wöchentlich separat für jede Regelrichtung
vermarktet. Außerdem erfolgt eine weitere Differenzierung in Hochtarif (HT, werktags von
08:00 bis 20:00) und Niedertarif (NT, werktags von 20:00 bis 08:00, an Wochenenden sowie
gesetzlichen Feiertagen), sodass insgesamt vier verschiedene Produkte existieren. Die
Mindestangebotsgröße beträgt 5 MW. Der Zuschlag erfolgt nach Merit-Order und die
vorgehaltene Leistung wird nach pay-as-bid durch den angebotenen Leistungspreis pro
vorgehaltene Stunde vergütet.
Abrufcharakteristika und Vergütung der Arbeit
Im Falle von Bilanzabweichungen erfolgt der Abruf von SRL automatisch durch
Leistungs-Frequenz-Regler entsprechend der Merit-Order der angebotenen Arbeitspreise.
Diese Aufreihung nach Arbeitspreisen wird Merit-Order-Liste genannt. Das Vorgehen zielt
darauf ab, die resultierenden Kosten durch den Abruf zu minimieren. Bei einem Abruf muss
die Leistung nach spätestens fünf Minuten vollständig aktiviert und eine Verfügbarkeit von
100 % über den vermarkteten Zeitraum gewährleistet werden. Auch bei der Arbeitsvergütung
erfolgt die Preisbildung nach dem pay-as-bid-Prinzip basierend auf der aktuellen
Merit-Order-Liste. Der für die Berechnung des IGCC-Settlementpreises relevante
Opportunitätspreis wird für positive wie negative SRL je viertel Stunde ermittelt. Er
errechnet sich jeweils aus dem Quotienten der Kosten (bzw. Erlöse) je Viertelstunde und der
in der gleichen Zeit eingesetzten SRL-Menge, entspricht also dem gewichteten Mittelwert der
Arbeitspreise.
(Beschreibung nach [11])
Seite 11 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
1.2 Auswertungen
Die Entwicklung der in Bezug auf die Ersparnisse durch die IGCC relevanten Werte der
tatsächlich abgerufenen SRL und den damit verbundenen Kosten sind in Abbildung 7 für die
Jahre 2009 bis 2014 dargestellt.
Abbildung 7: SRL-Abrufe und Kosten – Deutschland (Eigene Darstellung, Daten von
[8])
Abbildung 7 zeigt die jährlich aufsummierten Mengen an positiver wie negativer abgerufener
SRL, sowie die seit 2012 durch die IGCC vermiedenen SRL-Abrufe. Rechts sind in Blau die
aufsummierten Kosten aufgezeigt, die durch die dem ÜNB durch die Abrufe entstanden sind.
In Rot dargestellt sind die Einsparungen durch die Teilnahme am IGCC. Es ist hier zu
beachten, dass die Kosten der Leistungsvorhaltung nicht mit inbegriffen sind, da die
Teilnahme am IGCC keinen unmittelbaren Einfluss auf diese hat. Insgesamt ist sowohl bei
den jährlich abgerufenen Energiemengen sowie den damit in Verbindung stehenden Kosten
seit dem Jahr 2012 eine deutlich fallende Tendenz zu erkennen, welche durch die Teilnahme
am IGCC noch weiter verstärkt wird. Die niedrigen Gesamtkosten im Jahr 2011 werden
durch die starken Unterschiede zwischen der aufsummierten Menge an positiver und
negativer SRL hervorgerufen. Während dem Anbieter positive Regelenergie bei positiven
Arbeitspreisen vergütet wird, muss er für abgerufene negative Regelenergie bei positiven
Arbeitspreisen aufkommen. Da im Jahr 2012 besonders wenig positive SRL abgerufen
wurde, fallen die Gesamtkosten vergleichbar gering aus.
Abbildung 8: Verlauf der mittleren Arbeitspreise (AP) - Deutschland (Eigene
Darstellung, Daten von [8])
Seite 12 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
2. Dänemark
Abbildung 9: Dänemark West und Ost (Eigene Darstellung)
Das dänische Energiesystem ist in zwei Teile aufgeteilt, Dänemark West (auch DK1) und
Dänemark Ost (auch DK2). Dänemark Ost ist Teil des Nordeuropäischen Verbundnetzes
(ehemals NORDEL) während Dänemark West mit dem zentraleuropäischen Verbundnetz
(ehemals UCTE) verbunden ist. Zwar sind die beiden Verbundnetze über HGÜ verbunden
und haben die gleiche Nenn-Netzfrequenz, sind aber aufgrund der fehlenden
Wechselstromverbindung als asynchron zu bezeichnen. Das heißt konkrete
Frequenzabweichungen und Phasenlage des Wechselstroms können unterschiedlich sein.
Für beide Teile des dänischen Energiesystems ist der ÜNB Energinet.dk verantwortlich, die
Struktur der Regelenergiebeschaffung und -Bereitstellung ist allerdings grundsätzlich
verschieden. Da nur Dänemark West Teil der IGCC ist, wird in den folgenden Ausführungen
und Analysen auch nur auf die Produkte und Daten dieser Zone eingegangen. Wird von
„Dänemark“ gesprochen, ist damit nur der westliche Teil gemeint. Grundsätzlich zu beachten
ist, dass in Dänemark im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern der IGCC eine
Abrechnungsperiode von einer Stunde implementiert ist (im Vgl. zu 15 Minuten in den
anderen Ländern).
2.1 Ökonomische und regulatorische Grundlagen der Sekundärregelleistung
In Dänemark wird Sekundärregelleistung unter dem Namen „load frequency control“ (LFC)
geführt. Deren ökonomischen und regulatorischen Grundlagen werden im folgenden
Abschnitt zusammenfassend vorgestellt.
Vermarktung der Leistungsvorhaltung
Die vorzuhaltende Leistung wird einmal monatlich auf Basis des maximalen
Stromverbrauchs des Monats dimensioniert und ausgeschrieben. Sie beträgt aktuell
ungefähr ±90 MW. Positive und negative Leistung werden hier in einem gemeinsamen
Produkt vermarktet und nach dem pay-as-bid-Prinzip nach den gebotenen Leistungspreisen
vergütet. Eine Mindestangebotsgröße existiert nicht.
Abrufcharakteristika und Vergütung der Arbeit
Der Abruf der LFC sowie deren Vergütung unterscheiden sich deutlich von der deutschen
SRL. Der Abruf geschieht hier nicht nach der Merit-Order-Reihenfolge sondern „pro rata“.
Das heißt, dass alle Anbieter gleichzeitig, anteilig ihrer vermarkteten Leistung abgerufen
Seite 13 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
werden. Die Aktivierung muss hier innerhalb von 30 Sekunden begonnen werden und
spätestens nach 15 Minuten vollständig abgeschlossen sein. Die Arbeitspreise für
abgerufene Leistung richten sich in Dänemark nach den Preisen der manuell abgerufenen
Tertiärregelenergie und den Nordpool-Spot-Preisen und gelten für die gesamte
Abrechnungsdauer von einer Stunde. Der Preis für positive LFC entspricht dem Arbeitspreis
der positiven Tertiärregelenergie, es sei denn, dieser ist niedriger als der aktuelle
Nordpool-Spot-Preis. In diesem Fall berechnet er sich aus diesem + 100 DKK. Für den
negativen LFC-Arbeitspreis gilt der Arbeitspreis für negative Tertiärregelenergie, es sei denn
dieser ist höher als der Nordpool-Spot-Preis in der aktuellen Stunde. In diesem Fall
entspricht er diesem -100 DKK. Eben nach diesem Prinzip berechnet sich auch der dänische
Opportunitätspreis für die Berechnung des IGCC-Settlement-Preises, welcher für eine
ganze Stunde gilt.
(Beschreibung nach [12])
2.2 Auswertungen
In Abbildung 10 sind die aufsummierten Abrufmengen von SRL in Dänemark, die über die
IGCC ausgetauschten Mengen und die damit verbundenen Kosten dargestellt:
Abbildung 10: SRL-Abrufe und Kosten – Dänemark (Eigene Darstellung, Daten von [2]
& [8])
Wie bereits in [12] prognostiziert wurde, konnten die SRL-Abrufe durch die vorherige
Saldierung mit den IGCC-Partnern um etwa 50 % reduziert werden. Gerade im direkten
Vergleich zu Deutschland scheint der IGCC einen viel stärkeren Einfluss auf SRL-Abrufe und
resultierende Kosten zu haben. Dies lässt sich vor allem durch das deutlich kleinere,
insgesamt aufzubringende Regelvolumen der westdänischen Regelzone erklären. Im
jährlichen Mittel ist die aufsummierte Menge von positiver und negativer SRL in Deutschland
ungefähr 20-mal so groß, während die durch IGCC vermiedenen mittleren Werte nur etwa
fünfmal so groß sind. Damit entsprechen diese Ergebnisse prinzipiell den Erwartungen, dass
sich die potentiellen Einsparungen einer Regelzone systembedingt nicht nur an der Höhe der
eigenen Regelenergieabrufe sondern vor allem an der gemittelten Höhe aller an der IGCC
beteiligten Regelzonen orientieren. Der überproportionale Effekt auf die aus der IGCC
Kooperation resultierenden, vermiedenen Kosten lässt sich allerdings allein aufgrund dessen
nicht vollständig erklären. Auf eine weitere Untersuchung wird an dieser Stelle verzichtet.
Seit Bestehen der IGCC konnten bis Ende 2014 Einsparungen von etwa 9,8 Mio. € erzielt
werden.
Seite 14 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
3. Niederlande
Mit einer Bruttostromerzeugung von etwa 102 TWh im Jahre 2012 [9] sind die Niederlande
nach Deutschland der zweitgrößte Stromproduzent der IGCC. Dabei nimmt Gas mit einem
Anteil von 65 % den Platz als wichtigsten Energieträger ein. Für die Betreibung der
Übertragungsnetze und die Netzregelung ist in den Niederlanden der ÜNB TenneT NL
verantwortlich.
3.1 Ökonomische und regulatorische Grundlagen der Sekundärregelleistung
Auch in den Niederlanden wird Sekundärregelleistung und tatsächlich abgerufene
Sekundärregelenergie (auch bekannt unter „Regelvermogen“) über zwei getrennte
Ausschreibungen akquiriert.
Vermarktung der Leistungsvorhaltung
Die Sekundärregelleistungsvorhaltung wird im Gegensatz zu Deutschland nur einmal pro
Jahr als symmetrisches Produkt ausgeschrieben und vermarktet. Um an dieser
Ausschreibung teilzunehmen müssen die Anlagen in der Lage sein eine Rampensteigerung
von 7 % der vermarkteten Leistung pro Minute zu bewältigen, die volle Leistung nach
spätestens fünf Minuten zu erreichen und diese für mindestens 15 Minuten zur Verfügung
stellen zu können. Bezuschlagte Anbieter sind verpflichtet die vermarktete Leistung über den
gesamten Zeitraum zu reservieren und diese am täglich stattfindenden Regelenergiemarkt
anzubieten. Insgesamt stellen diese rein technischen Anforderungen eine relativ hohe Hürde
dar, sodass fast ausschließlich Großkraftwerke in der Lage sind diese zu erfüllen. Es werden
jährlich 300 MW SRL ausgeschrieben, nach der Merit-Order bezuschlagt und nach dem
jeweils gebotenen Leistungspreis vergütet (pay-as-bid-Prinzip).
Abrufcharakteristika und Vergütung der Arbeit
Um den Wettbewerb zwischen den Anbietern noch zu verstärken, können am täglich
stattfindenden Regelenergiemarkt auch nicht am Leistungsmarkt bezuschlagte Anbieter
Regelenergieprodukte anbieten (sog. „free bids“). Die angebotenen Arbeitspreise können bis
zu einer Stunde vor dem Lieferzeitraum geändert werden. Alle Gebote werden anschließend
nach der Höhe ihrer Arbeitspreise in der sog. „bid ladder“ (entspricht der deutschen Merit
Order List) aufgelistet und im Bedarfsfall in Echtzeit nacheinander bis zu benötigten Leistung
abgerufen. Eine parallele Aktivierung (pro rata) wird nur im Falle von größeren
Bilanzungleichgewichten vorgenommen. Der Arbeitspreis des höchsten, gerade noch
abgerufenen Volumens bestimmt hierbei den Preis für alle aktivierten Angebote des
Abrechnungsintervalls (Market-Clearing-Price-Prinzip). Der Opportunitätspreis, der in die
Berechnung des IGCC-Settlement-Preises eingeht, entspricht dabei diesem Arbeitspreis.
(Beschreibung nach [13])
3.2 Auswertungen
Abbildung 11 zeigt links die Entwicklung der aufsummierten jährlichen Abrufmengen von
SRL und rechts die damit verbunden Kosten. Insgesamt ist bei der Abrufmenge sowohl bei
positiver als auch bei negativer Regelrichtung eine abnehmende Tendenz zu erkennen,
welche durch die Saldierung im Rahmen der IGCC noch einmal verstärkt wird.
Seite 15 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Abbildung 11: SRL-Abrufe und Kosten – Niederlande (Eigene Darstellung, Daten von
[3] & [8])
Die mit den Abrufen verbundenen Kosten hingegen scheinen eher zuzunehmen, immerhin
noch eingedämmt durch die Ersparnisse der vermiedenen Abrufe. Um dieses Phänomen zu
erklären ist in Abbildung 12, links die Entwicklung der Arbeitspreise im gleichen Zeitraum
dargestellt.
Abbildung 12: Entwicklung der Arbeitspreise (AP) und spezifischen Kosten–
Niederlande (Eigene Darstellung, Daten von [3])
Insbesondere bei den Arbeitspreisen der positiven SRL ist hier ein steigender Trend mit etwa
+10 %/Jahr bis etwa August 2013 zu erkennen. Anschließend brechen die Arbeitspreise
positiver SRL stark ein, was zu ebenfalls sinkenden Gesamtkosten im Jahr 2014 führt. Auf
eine weitere Analyse der Ursachen hierfür wird an dieser Stelle verzichtet. Die Arbeitspreise
der negativen SRL verzeichnen im betrachteten Zeitraum einem Zuwachs von etwa
0,1 %/Jahr. Positive Arbeitspreise bei positiver SRL bedeuten für den ÜNB Kosten, während
positive Arbeitspreise bei negativer SRL mit Erlösen verbunden sind.
Die durchgeführte Abschätzung ergibt, dass durch die internationale Ausweitung des NRV
auf internationale Partner pro Jahr in der niederländischen Regelzone etwa 113 GWh
positive und 271 GWh negative SRL-Abrufe vermieden werden konnten. Summiert über den
gesamten Zeitraum bis Dezember 2014 entspricht dies einer finanziellen Einsparung von
28,8 Mio. €.
4. Schweiz
Der Erzeugerpark in der Schweiz ist, bedingt durch die guten geographischen und
topographischen Gegebenheiten, stark von Wasserkraftwerken geprägt. So werden
Seite 16 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
insgesamt knapp 60 % der nationalen Bruttostromerzeugung durch Wasserkraftwerke
bereitgestellt. Weitere 36 % entfallen auf die Kernenergie, während der Anteil konventioneller
Kraftwerke mit Brennstoffen fossilen Ursprungs nur etwa 3 % beträgt [4]. Für die Betreibung
und Instandhaltung der etwa 6700 km umfassenden Übertragungsnetze und die
Bereitstellung von Systemdienstleistungen ist in der Schweiz der Übertragungsnetzbetreiber
Swissgrid AG mit Sitz in Laufenburg verantwortlich.
4.1 Ökonomische und regulatorische Grundlagen der Sekundärregelleistung
In der Schweiz wird die Menge der vorzuhaltenden SRL jährlich auf Basis von
stochastischen Berechnungsverfahren berechnet, welche Größe und Verfügbarkeit des
Kraftwerksparks, Güte der Last- und Erzeugungsprognosen und das Lastrauschen der
Regelzone berücksichtigen. Zurzeit werden darauf basierend ±400 MW zur Vorhaltung
ausgeschrieben. Für die Dimensionierung und Ausschreibung der Regelleistungsprodukte ist
die Swissgrid AG zuständig.
Vermarktung der Leistungsvorhaltung
Im Gegensatz zur deutschen Regelzone werden dazu wöchentlich symmetrische
Regelleistungsbänder zu mindestens 5 MW ausgeschrieben. Das heißt die
Leistungsvorhaltung bezieht sich sowohl auf positive als auch auf negative SRL. Pro
Angebot sind mehrere Menge/Preis-Kombinationen möglich (Stufenangebote), wobei die
Mindeststufengröße pro Preis 1 MW entspricht. Die Vergütung der vorgehaltenen Leistung
erfolgt über einen Leistungspreis der dem angebotenen Preis des jeweiligen Produkts
entspricht (pay-as-bid).
Abrufcharakteristika und Vergütung der Arbeit
Über einen zentralen Netzregler wird die tatsächlich benötigte Menge an SRL über ein
Stellsignal an die Anbieter „pro-rata“ abgerufen. Ähnlich wie in der dänischen Regelzone
werden also alle Anbieter gleichzeitig aktiviert, proportional zu der von ihnen angebotenen
Menge an Regelleistung. Die Vergütung der abgerufenen Arbeit erfolgt dementsprechend
über einen einheitlichen Arbeitspreis der für alle Anbieter gilt und sich an dem über 15
Minuten gemittelten Stellsignal und dem Stundenpreis der Schweizer Energiebörse SwissIX
orientiert. Die genaue Preisbildung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen, wobei die
Vorzeichen der Preise zu berücksichtigen sind. „Wochenbase“ entspricht hier dem
ungewichteten Mittelwert aller in der jeweiligen Woche am Day-Ahead-Markt der SwissIX
erzielten stündlichen Durchschnittspreise.
• Positive SRL + positiver SwissIX-Stundenpreis:
mindestens Wochenbase
Geldfluss: Swissgrid Anbieter
• Positive SRL + negativer SwissIX-Stundenpreis:
mindestens Wochenbase
Geldfluss: Swissgrid Anbieter
• Negative SRL + positiver SwissIX-Stundenpreis:
maximal Wochenbase
Seite 17 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Geldfluss: Anbieter Swissgrid
• Negative SRL + negativer SwissIX-Stundenpreis:
maximal Wochenbase
Geldfluss: Swissgrid Anbieter
Die Vergütung der Arbeit erfolgt demzufolge im Gegensatz zur Leistungsvergütung getrennt
nach positiven und negativen Abrufen. Zu beachten ist hierbei, dass nur der über eine
Abrechnungsperiode (15 Minuten) saldierte Regelenergiebedarf vergütet wird, sodass es nur
einen positiven oder einen negativen Arbeitspreis pro Abrechnungsperiode gibt.
Dementsprechend wird sowohl für IGCC-Import als auch Exporte der gleiche
Opportunitätspreis angewendet der folglich entweder dem Arbeitspreis positiver oder dem
Arbeitspreis negativer SRL entspricht und sich nur durch sein Vorzeichen unterscheidet.
(Beschreibung nach [14])
4.2 Auswertungen
In Abbildung 13 ist die Entwicklung der SRL-Abrufe über die letzten vier Jahre dargestellt.
Die resultierenden Kosten konnten nur für die letzten vier Jahre ausgewertet werden, weil
vor 2011 keine Daten zur Verfügung stehen.
Abbildung 13: SRL-Abrufe und Kosten – Schweiz (Eigene Darstellung, Daten von [4] &
[8])
Insgesamt ist ersichtlich, dass sowohl die abgerufenen Mengen an positiver und negativer
SRL als auch die resultierenden Kosten eine fallende Tendenz aufweisen. Bei der negativen
SRL ist allerdings anzumerken, dass die tatsächlich benötigten Energiemengen faktisch
gestiegen sind und nur durch die Kooperation im Rahmen der IGCC auf einem konstanten
Level gehalten werden konnten. Des Weiteren konnte durch verschiedene Maßnahmen
seitens Swissgrid, wie die Anpassung im Ausschreibungsverfahren, welche auch kleineren
Anbietern den Zugang zum Regelleistungsmarkt ermöglichte, auch die spezifischen
Abrufkosten (also die Arbeitspreise) reduziert werden [9]. Deren Entwicklung ist in
Abbildung 14, links dargestellt.
Seite 18 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Abbildung 14: Entwicklung der Arbeitspreise (AP) und Leistungspreise (LP) – Schweiz
(Eigene Darstellung, Daten von[4])
Abbildung 14, rechts zeigt die Entwicklung der Leistungspreise bis Juni 2014. Dabei ist
auffällig, dass diese im Frühjahr jeden Jahres einen Peak aufweisen, welcher im Jahr 2013
besonders ausgeprägt ist. Das lässt sich durch den hohen Anteil von Pump- und
Laufwasserkraftwerken an der schweizerischen Elektrizitätsversorgung erklären, welcher
wiederum von den Füllständen der Speicherseen beeinflusst wird. Die charakteristisch
niedrigen Füllstände zwischen März und Juni verknappen das Angebot auf den
Regelleistungsmärkten und erhöhen so die Leistungspreise (siehe Abbildung 15). Der sehr
kalte und niederschlagsarme Winter 2012/13 [16] führte zu besonders niedrigen
Speicherständen im Frühjahr 2013, wodurch der auffallende Peak der Leistungspreis in
diesem Zeitraum zu erklären ist.
Abbildung 15: Füllstand Speicherseen – Schweiz 2011-2014 (Eigene Darstellung,
Daten von [17])
Die durchgeführte Abschätzung ergibt, dass durch die internationale Ausweitung des NRV
auf internationale Partner pro Jahr in der Schweizer Regelzone etwa 93 GWh positive und
164 GWh negative SRL-Abrufe vermieden werden konnten. Summiert über den gesamten
Zeitraum bis Dezember 2014 entspricht dies einer finanziellen Einsparung von 12,86 Mio. €.
5. Tschechien
Die Stromerzeugung in Tschechien ist mit einem Anteil von 51 % stark durch den
Energieträger Kohle geprägt. Einen weiteren großen Anteil nimmt die Kernenergie ein,
während Erneuerbare Energie mit 10 % unter dem Durchschnitt der betrachteten Länder
liegt. Der ÜNB ČEPS, mit dem tschechischen Staat als Hauptanteilseigner, ist für die
Seite 19 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Beschaffung und den Einsatz der Systemdienstleistungen verantwortlich während die
tatsächlich eingesetzte Energie von dem tschechischen Energieregulator Energetický
Regulační Úřad (ERÚ) vergütet wird. Etwa 90 % der vorgehaltenen Regelleistung wird über
langfristige Verträge beschaffen und nach dem pay-as-bid-Prinzip vergütet. Die
verbleibenden 10 % werden über einen täglichen Day-Ahead-Markt ausgeschrieben, wobei
sich der vergütete Preis hier nach dem Market-Clearing Preis, also nach dem höchsten noch
bezuschlagten Angebot richtet.
5.1 Ökonomische und regulatorische Grundlagen der Sekundärregelleistung
Vermarktung der Leistungsvorhaltung
SRL wird vom tschechischen ÜNB ceps als symmetrisches Produkt mit einer
Mindestangebotsgröße von 20 MW ausgeschrieben, wobei auch hier aus Gründen der
Redundanz eine maximale Angebotsgröße pro Anlage von 70 MW besteht. Die Vergütung
richtet sich nach den jeweiligen Prinzipien der langfristigen Verträge oder des
Day-Ahead-Marktes.
Abrufcharakteristika und Vergütung der Arbeit
Bei einem Abruf von SRL müssen die Anbieter in der Lage sein die vermarktete Leistung
innerhalb von 10 Minuten mit einer Rampengeschwindigkeit von 2 MW/min zu aktivieren. Der
Abruf erfolgt in Tschechien „pro-rata“, das heißt alle Anbieter werden gleichzeitig aktiviert. Im
Gegensatz zu den anderen Regelzonen der IGCC wird der Arbeitspreis für positive und
negative SRA einmal pro Jahr von dem tschechischen Energieregulator Energetický
Regulační Úřad festgelegt. Seit 2009 beträgt dieser konstant 2350 CZK/MWh
(~84,50 €/MWh) für positive SRL und 1 CZK/MWh (~3,5 ct/MWh, wird vernachlässigt) für
negative SRL. Bei der Abrechnung wird wie in der Schweiz nur die über eine
Abrechnungsperiode (hier eine Stunde!) saldierte Energiemenge vergütet. Wurde in einer
Stunde mehr positive als negative SRL abgerufen, wird nur der Saldo mit dem positiven
Arbeitspreis vergütet. Ist der Saldo negativ, wird es mit dem negativen Arbeitspreis vergütet.
Für die Berechnung des Opportunitätspreises werden zunächst von den Kosten die
angefallen wären, wenn CEPS nicht am IGCC teilgenommen hätte die tatsächlichen Kosten
der entsprechenden Abrechnungsperiode abgezogen. Diese Kosten werden dann durch den
Saldo der Energieimport und -Exporte im Rahmen der IGCC dividiert. Dieser
Opportunitätspreis ist über die Abrechnungsperiode von einer Stunde konstant und gilt
wegen der zuvor beschriebenen Saldierung bei der Regelenergieabrechnung gleichermaßen
für IGCC Import und Exporte.
(Beschreibung nach [5])
Seite 20 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
5.2 Auswertungen
In Abbildung 16 sind die Entwicklung der SRL-Abrufe und die damit verbunden Kosten
dargestellt.
Abbildung 16: SRL-Abrufe, Tschechien (Eigene Darstellung, Daten von [5] & [8])
Die durchgeführte Abschätzung ergibt, dass durch die internationale Ausweitung des NRV
auf internationale Partner pro Jahr in der Tschechischen Regelzone durchschnittlich etwa
107 GWh positive und 83 GWh negative SRL-Abrufe vermieden werden konnten. Summiert
über den gesamten Zeitraum bis Dezember 2014 entspricht dies einer finanziellen
Einsparung von 22,7 Mio. €.
6. Belgien
Die Erzeugung von Elektrizität beruht in Belgien hauptsächlich auf Kernenergie und Gas,
wobei sich diese Kraftwerke zu 95 % im Besitz der drei größten Energieversorger, ECS,
Electrabel und SPE befinden. Zwar ist der Elektrizitätsmarkt liberalisiert, der Wettbewerb ist
allerdings durch diese sehr zentralistisch geprägte Erzeugerstruktur eher eingeschränkt. Für
Betrieb und Instandhaltung der Übertragungsnetze sowie die Beschaffung, den Einsatz und
die Vergütung der Regelenergie ist der belgische ÜNB Elia verantwortlich.
6.1 Ökonomische und regulatorische Grundlagen der Sekundärregelleistung
Aktuell werden in Belgien nach dem Dimensionierungsverfahren von Elia ±140 MW SRL
unter dem Namen „Automatic Frequency Restoration Reserves“ (aFRR) vorgehalten. Auch
hier werden Leistungsvorhaltung und tatsächlich eingesetzte Leistung über zwei
verschiedene Ausschreibungen vermarktet.
Vermarktung der Leistungsvorhaltung
Die Vermarktung der Leistungsvorhaltung findet dabei einmal pro Jahr statt, wobei positive
und negative SRL separat angeboten werden kann und außerdem noch zwischen „peak“
und „off-peak“ Produkten unterschieden wird. Um für die SRL-Bereitstellung präqualifiziert zu
werden, muss eine Anlage in der Lage sein eine Rampengeschwindigkeit von 15 % der
angebotenen Leistung pro Minute zu realisieren und die gesamte Leistung nach fünf Minuten
voll zur Verfügung zu stellen. Für die Angebote gilt eine Mindestangebotsgröße von 5 MW.
Außerdem darf pro Anlage nicht mehr als 50 MW vermarktet werden um eine möglichst hohe
Versorgungssicherheit in der Regelzone zu gewährleisten. Bezuschlagte Anbieter von SRL
werden nach dem pay-as-bid-Prinzip vergütet und müssen eine hundertprozentige
Verfügbarkeit über den gesamten Ausschreibungszeitraum gewährleisten.
Seite 21 von 279. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien IEWT 2015
Abrufcharakteristika und Vergütung der Arbeit
Die bezuschlagten Anbieter sind weiterhin verpflichtet ihre vermarktete Leistung am täglich
stattfinden Day-Ahead-Regelenergiemarkt anzubieten. Um eine optimale Nutzung aller
verfügbaren Ressourcen zu gewährleisten, steht dieser Markt auch allen weiteren Anbietern
offen. Es werden nur symmetrische Produkte vermarktet, wobei die möglichen Gebote hier
einem „Price-Cap“ unterliegen. Für positive SRL bedeutet das, dass die Arbeitspreise nicht
höher sein dürfen als die Brennstoffkosten einer Standard GuD-Anlage mit einer Effizienz
von 50 % plus eines Zuschlags von 40 €/MWh. Die Arbeitspreise negativer SRL müssen
mindestens 0 €/MWh betragen. Alle Gebote werden zu einer gemeinsamen Merit-Order-Liste
zusammengefügt und anhand dieser je nach benötigtem Bedarf für den Folgetag ausgewählt
und so für mögliche Abrufe reserviert. Der Abruf erfolgt „pro-rata“, d.h. alle Anlagen werden
gleichzeitig über ein Stellsignal aktiviert. Die zu erbringende Leistung jeder Anlage verhält
sich dabei proportional zu der vom Anlagenbetreiber insgesamt vorgehaltenen Menge an
SRL. Die Vergütung richtet sich hier allerdings trotz des „pro-rata“ -Abrufs nach dem
angebotenen Arbeitspreis (pay-as-bid). Der Opportunitätspreis entspricht deswegen dem
mengengewichteten mittleren Arbeitspreis pro Abrechnungsperiode (15 Minuten) und wird
sowohl für positive als auch für negative SRL berechnet.
(Beschreibung nach [5])
6.2 Auswertungen
In Abbildung 17 sind die Entwicklungen von SRL-Abrufen, den damit verbunden Kosten und
die Einsparungen durch die Teilnahme am IGCC über den verfügbaren Zeitraum dargestellt.
Abbildung 17: SRL-Abrufe und Kosten – Belgien (Eigene Darstellung, Daten von [6] &
[8])
Trotz sinkender Abrufmengen ist eine deutliche Kostensteigerung zu erkennen. Dies lässt
sich durch die Entwicklung der Arbeitspreise erklären, die im gleichen Zeitraum eine ähnliche
Tendenz aufweisen (vgl. Abbildung 18). Die Arbeitspreise der positiven SRL verzeichnen
eine leichte Zunahme, während die der negativen im gleichen Zeitraum deutlich abnehmen.
Da positive Arbeitspreise bei positiver SRL mit Kosten und positive Arbeitspreise bei
negativer SRL mit Erlösen für den ÜNB verbunden sind, haben die vorliegenden Tendenzen
einen deutlichen Anstieg der Gesamtkosten durch SRL-Abrufe zur Folge und erklären das
vorliegende Phänomen. Auf eine Analyse der Ursachen dieser Entwicklungen soll im
Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht weiter eingegangen werden.
Seite 22 von 27Sie können auch lesen