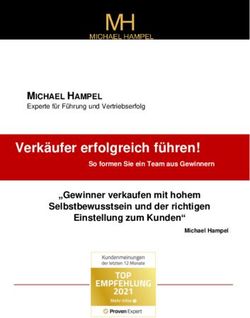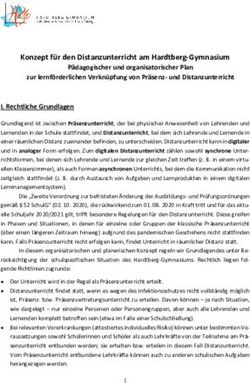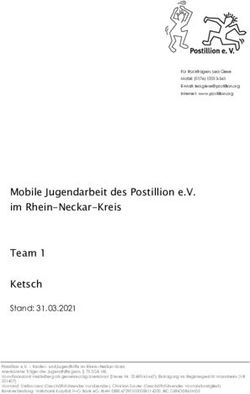Über die semiotischen Wirkebenen kartographischer Punktsignaturen About the semiotic dimensions of cartographic point symbols - ovg.at
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Vermessung & Geoinformation 3/2020, S. 105 – 112, 3 Abb. 105
Über die semiotischen Wirkebenen
kartographischer Punktsignaturen
About the semiotic dimensions of
cartographic point symbols
Silvia Klettner, Wien
Kurzfassung
Karten sind selektive Repräsentationen, die Informationen über den geographischen Raum in ausgewählter Form
in verkleinertem Maßstab darstellen. Durch den Einsatz von Zeichen und Symbolen stellen Karten so einen Bezug
zu räumlichen Vorkommnissen und Ereignissen her, der weit über die unmittelbare menschliche Wahrnehmung
hinausgeht. Durch die Wahl der eingesetzten kartographischen Zeichen beeinflussen Karten jedoch die mensch-
liche Vorstellung über die geographische Welt. Die Wahl der kartographischen Darstellungsform ist daher von
zentraler Bedeutung. Die Herausforderung kartographischer Kommunikation besteht nun u.a. darin, dass kar-
tographische Zeichen neben ihren denotativen Qualitäten (im Sinne ihrer kontext- und situationsunabhängigen
Grundbedeutung), über konnotative Eigenschaften verfügen, die implizit und assoziativ die Karteninterpretation
beeinflussen können. Zu wenig ist jedoch bekannt über die vielfältigen impliziten Wirkweisen von kartographi-
schen Zeichen und über deren Bedeutungsebenen. Die im Folgenden dargestellte Forschung widmete sich daher
der Identifizierung dieser Wirkmechanismen und stellt dafür, neben zentralen kartographischen und semiotischen
Theorien, Ergebnisse einer empirischen Studie vor, welche die konnotativ impliziten Bedeutungsebenen von
kartographischen Zeichen am Beispiel von Punktsignaturen untersuchte.
Schlüsselwörter: Kartographie, Visuelle Kommunikation, Semiotik, Thematische Karten, Psychologie
Abstract
As selective representations, maps depict information about geographic space in an abstracted, generalized
manner, and at a reduced scale. By employing signs and symbols, maps refer to spatial occurrences and events
and enable us to relate to them from a viewpoint far beyond direct experience. In doing so, the choice of the
cartographic signifiers shows to be of vital importance as it will influence how humans read and respond to maps,
and how the geographic world is perceived. Decisions towards the most suitable cartographic signifiers are, yet,
a challenging task, especially since cartographic signs may not only denote (i.e., act as neutral identifiers) but
also connote (i.e., imbue implicit and associative meaning, which may influence how maps are perceived and
interpreted). As little is known about the connotative meanings of cartographic signs, the present research was
devoted to unraveling some of its implicit, semiotic dimensions. This article, thus, introduces central cartographic
theories and semiotic approaches and discusses the findings of an empirical study that explored the connotative,
semiotic dimensions of cartographic point symbols.
Keywords: Cartography, Visual Communication, Semiotics, Thematic Maps, Psychology
1. Einleitung menschliche Vorstellung über die geographische
Welt konzipiert, artikuliert und strukturiert [3].
Kartographie umfasst die Kunst, Wissenschaft
und Technologie über die Erstellung und Ver- Die Herausforderung kartographischer Kom-
wendung von Karten [1]. Aus wissenschaftlicher munikation besteht jedoch u. a. darin, dass karto-
Perspektive wird Kartographie als Kommunikati- graphische Zeichen nicht durch fixe, syntaktisch
onsdisziplin verstanden, da sie georaumbezogene eindeutig festgelegte Referenzen determiniert
Informationen vermittelt (lat. communicare = sind, sondern deren Bedeutung und Wirkung
mitteilen, teilen). Durch den Einsatz von Zeichen variabel veränderbar sind [4]. Karten und ihre Zei-
und Symbolen ermöglichen Karten die Vorstellung chen können daher nicht als neutral verstanden
räumlicher Phänomene, fernab der tatsächlichen, werden, sondern verfügen neben denotativen
unmittelbaren menschlichen Wahrnehmung. So Eigenschaften (d. h. neben ihrer expliziten Haupt-
stellen Karten einen Bezug zu geographischem bedeutung) ebenso über konnotative Qualitäten
Raum her, der über die direkte Erfahrung hinaus- (d. h. implizite, assoziative Nebenbedeutungen),
geht. Dadurch werden sowohl nahe als auch ferne die etwa durch das kartographische Zeichen
Ereignisse und Phänomene vorstellbar, auch etwa selbst (wie durch dessen Form, Gestalt, Farbe,
solche, denen man anders nie begegnen würde etc.) die Kartenwahrnehmung und Interpretation
[2]. Karten gelten daher als Medium, das die beeinflussen können [5].106 Vermessung & Geoinformation 3/2020
Da sich jedoch bislang wenige Studien explizit Bis heute wird Kartographie als Kommu-
mit den oft subtilen, konnotativen Eigenschaften nikationsdisziplin erforscht, und Modelle und
von kartographischen Variablen beschäftigten, Theorien entsprechend den technologischen und
war die vorliegende Forschung umso mehr be- gesellschaftlichen Entwicklungen stetig weiter
strebt hier einen wesentlichen Beitrag zu leisten. entwickelt, verfeinert und neu erarbeitet [7,10].
Der folgende Artikel umfasst daher zunächst So brachten die rasanten technologischen Ent-
eine Einführung über Theorien kartographischer wicklungen seit Ende der 1990er Jahre etwa, eine
Kommunikation und Semiotik und stellt sodann weitere Wendung in kartografischer Forschung
Ergebnisse einer empirischen Studie dar, welche und Praxis mit sich [11]. Das Aufkommen neuer
die impliziten Wirkebenen von kartographischen und gut zugänglicher Technologien, Software und
Zeichen am Beispiel der graphischen Variable Daten eröffnete neue Möglichkeiten im Bereich
„Form“ untersuchte. der Geovisualisierung [12] und veränderte da-
durch auch die Art und Weise, wie Karten erstellt,
2. Kartographie als Kommunikationsprozess verwendet und genutzt werden [7]. Heutzutage
Das Verständnis von Kartographie als Kommuni- sind Karten allgegenwärtig, rasch vergänglich,
kationsdisziplin hat seinen Ursprung in den 1960er viele monothematisch, einschichtig, teils von
Jahren. Während bis dahin der Fokus auf der Pro- Kartograph*innen teils von Nicht-Kartograph*innen
duktion von Karten lag, wurde nach und nach eine erstellt und können leichter denn je im Internet
Wende in der Kartographie eingeläutet, welche die geteilt und verbreitet werden [13]. Während das
Karte als Medium als Teil eines dynamischen und Internet die Verbreitung von Karten erleichtert,
interaktiven Kommunikationsprozesses verstand schränkt es als Medium kartographisches Design
[6]. Da die Karte den geographischen Raum nur auch gleichzeitig ein; nämlich auf die – manchmal
in einem verkleinerten Maßstab darstellen kann, sehr kleine – physische Anzeigegröße. Das Design
müssen im kartographischen Schaffungsprozess von digitalen Karten erfordert daher besondere
eine Vielzahl an Entscheidungen darüber getroffen Aufmerksamkeit. Ziel ist eine gut übersichtliche
werden, welche Inhalte und in welcher Art diese und lesbare Darstellung trotz eingeschränkter
kartographisch repräsentiert werden und auch Anzeigegröße zu gewährleisten. Gut gestaltete
darüber welche Inhalte nicht dargestellt werden. online Karten gelten daher als „relativ leer“ [14].
Karten werden daher auch als selektive Repräsen-
Digitale Karten sind mittlerweile ein wesentli-
tationen verstanden [7], da sie Informationen über
cher Bestandteil des täglichen Lebens. Online
den geographischen Raum nicht in ihrer Ganzheit
Karten werden etwa als Navigationsunterstützung
sondern ausschließlich ausgewählt darstellen
zur Orientierung in unbekannten Umgebungen
können. Über das Was und das Wie entscheidet
aufgerufen oder sind eingeflochten als Zusatzin-
der/die Kartenersteller*in. Dies bedeutet auch,
formation bei Berichterstattungen in Online-Nach-
dass Karten niemals wertfrei oder neutral sind
richten. Während digitale Karten nicht nur kleiner,
[8], sondern von einer Vielzahl an Entscheidungen
einfacher, und präsenter geworden sind, so hat
abhängen, die alle zu unterschiedlichen Karten-
sich auch die Art der Auseinandersetzung mit ih-
ergebnissen und Wirkungen führen können. Der
nen verändert [7]. Manche dieser Karten werden
tschechoslowakische Kartograph A. Koláčný
als Unterstützung zur Entscheidungsfindung
machte dies als einer der ersten seiner Zeit in
genutzt (wie etwa als Navigationshilfe), wohinge-
seinem komplexen kartographischen Kommu-
gen andere wie Bilder behandelt und konsumiert
nikationsmodell deutlich, und wies dabei darauf
werden [16]. Digitale Karten sind zumeist für diese
hin, dass der/die Kartograph*in Informationen auf
Zwecke gestaltet, d. h. dass sie schnell und inzi-
der Grundlage der eigenen Wahrnehmung über
dentell verarbeitet werden können, keine kognitive
die Realität in Karten codiert, welche wiederum
Anstrengung verlangen, sondern den täglichen Si-
von den Kartenlesenden auf Basis der eigenen
tuationen des raschen und flüchtigen Gebrauchs
Erfahrung und aus der eigenen Perspektive
gerecht werden [7,15,16].
decodiert und interpretiert werden [6]. Die Karte
als physischer Ausdruck wird sodann nicht als Im Vergleich zu den einst komplexen mehr
Bedeutungsträgerin verstanden, sondern als schichtigen Karten der Vergangenheit werden
Medium, das Bedeutungsinterpretationen ermög- digitale Karten des heutigen Alltags schneller
licht: „the physical means of communication such produziert und ebenso schnell und flüchtig kon-
as language and maps, do not carry meaning, but sumiert. Die beinahe alltägliche Begegnung mit
rather, they trigger or release it“ [9] (S.184). derartigen Karten, bei gleichzeitiger inzidenteller,S. Klettner: Über die semiotischen Wirkebenen kartographischer Punktsignaturen 107
assoziativer Verarbeitung erfordert daher eine Linien-, als auch Flächensignaturen gelten (siehe
Neubetrachtung kartographischer Kommunika- Abbildung 1). Signaturen werden in der Kartog-
tion und ihrer Effekte und Wirkungen auf die Kar- raphie all jene graphischen Zeichen genannt, die
tennutzenden [7]. der Darstellung und Referenz von Objekten und
Sachverhalten in Karten dienen. Punktsignaturen
3. Kartographische Semiotik werden etwa eingesetzt um punkthafte (d. h.
ortsgebundene, diskrete) Sachverhalte in Karten
Semiotik (altgr. σημεῖον sēmeĩon = Zeichen, Sig- darzustellen. Liniensignaturen beziehen sich auf
nal) bezeichnet die Wissenschaft der Zeichensys- jene kartographischen Zeichen, die linienförmige
teme oder Zeichenlehre. Kartografische Semiotik Diskreta und Kontinua repräsentieren, während
befasst sich insbesondere mit der Identifizierung über Flächensignaturen flächenhafte Verbreitun-
und Definition der wichtigsten gestalterischen, gen kartographisch dargestellt werden. Die von
kartographischen Variablen und damit wie diese Bertin beschriebenen graphischen Variablen sind
verändert werden können um Geoinformationen nun jene manipulierbaren visuellen Eigenschaften,
angemessen zu codieren und zu repräsentieren durch welche kartographische Signaturen hinsi-
[17]. Damit verbunden ist das Kernziel kartogra- chtlich ihrer Form, Farbe, Größe, etc., verändert
phischer Semiotik, die Schaffung gemeinsamer werden können [18].
Zeichen und semiotischer Regeln für eine erfolg-
reiche (d. h. eindeutige bzw. intendierte) kartogra-
phische Kommunikation. Bertins grafische Semiologie ist noch heute
anerkannt [17]. Jedoch wird sie auch als dogma-
Eines der bekanntesten und ersten kartog- tisch, als empirisch nicht verifiziert und als un-
raphisch, semiotischen Abhandlungen stammt vollständig kritisiert [19]. Im Laufe der Jahrzehnte
vom französischen Kartographen J. Bertin, der wurde Bertins Semiologie daher erweitert und
in den 1970er Jahren ein Rahmenwerk entwarf, neue semiotische Rahmenwerke geschaffen. So
um kartografisch-semiotische Entscheidungen wurden etwa semiotische Systematiken an die
theoriegeleitet zu unterstützen [18]. Seine graf- Eigenschaften unterschiedlicher Kartentypen und
ische Semiologie umfasste dabei sechs visuelle Kartenverwendungen angepasst, wie etwa um
Variablen, bestehend aus Farbe, Form, Muster, den Anforderungen taktiler Karten, dynamisch
Helligkeit, Richtung und Größe. Je nach Skalen- visueller Karten oder Audiokarten gerecht zu
niveau der darzustellenden Daten (d. h. quantita- werden [19]. Neuere semiotische Forschungsar-
tiv, ordinal oder nominal) schlägt Bertin überdies beiten beschäftigen sich überdies mit der Ent-
Regeln über den Einsatz und die Nutzung dieser wicklung kartographisch-semiotischer Regeln für
graphischen Variablen vor, die sowohl für Punkt-, die gezielte Darstellung bestimmter Dateneigen-
Abb. 1: Grafische Semiologie nach Jacques Bertin; selbst illustriert nach [18].108 Vermessung & Geoinformation 3/2020
schaften, wie etwa der Visualisierung von Daten- im Folgenden dargestellte Forschung versuchte
unsicherheit [20,21]. daher hier einen Beitrag zu leisten und untersuch-
Bertins Semiologie entstand theoriegeleitet. te die konnotativen Wirkebenen von kartographi-
Neuere Ansätze sind daher bestrebt semiotische schen Zeichen am Beispiel von Punktsignaturen
Regelwerke auf Basis von empirisch belastbaren unter Berücksichtigung der graphischen Variable
Ergebnissen zu gestalten und bestehende Theori- „Form“.
en empirisch zu prüfen. Denn, vermeintlich simple
4. Konnotative Wirkebenen kartographischer
Entscheidungen bezüglich der Farbe, Form, Grö-
Punktsignaturen
ße, etc. von kartographischen Variablen können
die Kartenwahrnehmung und Karteninterpretation Punktsignaturen werden in der thematischen
signifikant beeinflussen [22]. Kartographie eingesetzt um georäumliche In-
formationen mit nominal qualitativem Charakter
Die Herausforderung kartographischer Semio-
darzustellen, oder auch um ordinal-, rational- und
tik besteht auch heute noch darin, dass Kartens-
intervallskalierte Geodaten auszudrücken. Die Ge-
ymbole und kartographische Zeichen nicht durch
staltung von Punktsignaturen erfordert dabei eine
fixe und eindeutig festgelegte Referenzen deter-
Vielzahl an Entscheidungen. Neben Überlegungen
miniert sind [4]. Kartenzeichen sind daher nicht
bezüglich Signaturgröße oder -farbe, bezieht sich
als rein denotativ zu verstehen, sondern verfügen
eine der ersten – wenn nicht sogar die erste – Ent-
ebenso über konnotative Eigenschaften. Deno-
scheidung auf die Wahl der Signaturform. Form
tation bezieht sich auf die neutrale Bedeutung
bezieht sich dabei auf die Gestalt der Signatur,
von Zeichen. In der Kartographie umfasst dies
also etwa auf die Entscheidung ob eine Kreisform,
etwa den Einsatz von kartographischen Zeichen
ein Dreieck, ein Quadrat, oder dgl. für einen ge-
und Symbolen als georäumliche Identifikatoren
gebenen Inhalt eingesetzt wird. Formen werden
bzw. Referenzen. D. h., dass die Hauptfunktion
in visuellen Disziplinen daher auch als zentrale
kartographischer Zeichen darin besteht sich auf
Bausteine verstanden [18,27,28]. Eingesetzt als
Gegebenheiten, Objekte, Phänomene udgl. des
Punktsignaturen in Karten werden Formsymbole
Georaums zu beziehen. Als solche, sind kartogra-
in weiterer Folge etwa skaliert, rotiert oder farblich
phische Zeichen immer denotativ. Demgegenüber
verändert.
stehen subjektive, emotionale und assoziative In-
terpretationen, welche Zeichen überdies auslösen Die Wahl der Form kartographischer Zeichen
können. Diese werden als Konnotation bezeich- versteht sich demnach als entscheidend, zumal
net. Derart implizite, konnotativen Bedeutungen diese auf die Kartenwahrnehmung und -interpre-
sind in der Kartographie jedoch bislang wenig tation Einfluss nimmt [5]. Kartographisch-semi-
erforscht. Die empirische Forschung legt jedoch ologische Werke beschäftigen sich daher auch
nahe, dass Karten und ihre Zeichen mehr als reine mit der Wahrnehmung von graphischen Zeichen
Identifikatoren sind. So zeigte sich, dass der Ein- und der Entwicklung von Richtwerten, um diese
satz unterschiedlicher kartographischer Zeichen perzeptuell gut erfassbar und gut unterscheidbar
etwa die Geschwindigkeit der Informationsverar- zu gestalten (wie z. B. durch Mindestdimensionen
beitung maßgeblich verändern kann [21,23–25] für Signaturgrößen). Neben der Berücksichtigung
oder, dass unterschiedliche kartographische Stile derartiger kognitiv-analytischer Regeln umfassen
das Vertrauen in Karten signifikant verändern und semiotische Werke auch Darstellungsempfehlun-
sogar zu Einstellungsveränderungen führen kön- gen bezüglich assoziativer Wirkaspekte. Derar-
nen [26]. tige semiotische Hinweise zur Formassoziativität
Kartographische Zeichen sind demnach nicht beziehen sich etwa darauf, dass ein Ansteigen
„stumm“, sind nicht neutral. Sie wirken nicht im- von Quantitäten sich auch graphisch durch den
mer rein oder ausschließlich als Identifikatoren Anstieg der Signaturgröße widerspiegelt. Bei der
für räumliche Objekte und Phänomene, sondern Darstellung nominaler Daten durch Punktsigna-
konnotieren. Durch ihre Merkmale (wie etwa über turen gilt hierbei etwa, dass ungleiche Inhalte
ihre Form, Gestalt, Farbe, etc.) verfügen sie über durch ungleiche Formen darzustellen sind.
weitere Deutungsebenen, welche die Karten- Der Inhalt bestimmt demnach die Form. For-
wahrnehmung und die Interpretation der Karte zu men wirken jedoch nicht ausschließlich logisch-
beeinflussen vermögen [5]. Wenig ist jedoch be- analytisch, sondern ebenso assoziativ. Jedoch,
kannt über die impliziten Bedeutungsebenen und welche Formen sind assoziativ zu welchem Inhalt?
Wirkweisen von kartographischen Zeichen. Die Welche Formen sind geeignet um etwa konträreS. Klettner: Über die semiotischen Wirkebenen kartographischer Punktsignaturen 109
Abb. 2: Stimulusmaterial bestehend aus
12 geometrischen Formen, sowie zwei
Beispiele der Gruppierungsergebnisse;
adaptiert nach [29].
Inhalte besonders geeignet darzustellen? Welche pektiven Verbalisierungen durch Audioaufnahmen
Formen werden demgegenüber als besonders dokumentiert. Die Studie fand in Individualset-
ähnlich erlebt – und vor allem warum? Derartige tings statt, d. h. jede Person wurde einzeln von der
Erwägungen zur Formassoziativität führen un- Testleiterin durch die Studie geführt. Insgesamt
weigerlich zu der bereits erwähnten Bedeutungs nahmen 38 Personen an der Untersuchung teil,
ebene der Konnotation von Zeichen. Im Zuge bei einem Durchschnittsalter von M = 21,50 Jah-
dieser Überlegungen wurde daher eine Studie ren (SD = 3,00).
durchgeführt um einige dieser Fragen empirisch
4.2. Ergebnisse
zu beantworten [29], nämlich: wie unterscheiden
sich kartographische Punktsignaturen? Welche 4.2.1. Formähnlichkeiten
sind sich ähnlicher und welche unähnlich? Und, Die Ähnlichkeitsgruppierungen der 12 geometri-
welche Wirk- und Bedeutungsebenen unterliegen schen Formen ergaben insgesamt 177 Gruppie-
diesen Ähnlichkeitsurteilen? rungen. Am häufigsten wurden fünf oder sechs
Gruppen aus dem Stimulusset gebildet (Min = 3,
4.1. Studiendesign Max = 7) (siehe Tabelle 1).
Die im Folgenden dargestellte empirische Studie Basierend auf den Ergebnissen der freien
untersuchte die Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit Gruppierung wurden Häufigkeiten der gemein-
von geometrischen Formen und identifizierte zu- sam auftretenden Formen in einer 12 × 12 Co-
dem jene Wirkebenen, die diesen Entscheidungen occurrence Matrix abgebildet. Die Matrix wurde
zugrunde liegen; siehe dazu [29] für die vollstän- ferner einer multidimensionalen Skalierung mittels
dige Veröffentlichung. PROXSCAL Skalierungsalgorithmus unterzogen
Das Stimulusmaterial der Studie u mfasste 12 sowie anschließend einer agglomerativen Clus-
achromatische, geometrische Formen, die auf teranalyse, um weitere statistische Ähnlichkeiten
Einzelkärtchen gedruckt an Studien teil
nehmer* bzw. Unähnlichkeiten zwischen den Formen auf-
innen ausgehändigt wurden. Die Teilnehmer*innen zudecken. Die Ergebnisse der multidimensionalen
wurden instruiert, das Stimulusmaterial frei und Skalierung und Clusteranalyse ergaben eine Kon-
intuitiv nach ihrer subjektiv erlebten Einschätzung figuration mit drei homogenen Formenclustern
der Formähnlichkeit zu gruppieren, wobei nach (siehe Abbildung 3). Während die Methode der
Belieben so viele Gruppen wie nötig erstellt wer- multidimensionalen Skalierung die Relationen
den konnten (siehe Abbildung 2). Im Anschluss zwischen den geometrischen Formen in einem
wurden die Studienteilnehmer*innen instruiert ihre zweidimensionalen Raum quantifizierte, erschlos-
Entscheidungen für jede gebildete Gruppe einzeln sen die Ergebnisse der Clusteranalyse neben
durch retrospektive Verbalisierung zu begründen. Relationen auch Metarelationen zwischen den
Die Ergebnisse der Formgruppierungen wurden Formstimuli. Drei distinkte Formencluster wurden
als visuelle Protokolle festgehalten und die retros- dabei identifiziert: ein homogenes Cluster, das
Gruppenhäufigkeiten
1 Gruppe 2 Gruppen 3 Gruppen 4 Gruppen 5 Gruppen 6 Gruppen 7 Gruppen
Häufigkeit . . 8 9 10 10 1
Prozent . . 21% 24% 26% 26% 3%
Tab. 1: Gruppenhäufigkeiten des Stimulussets bestehend aus 12 geometrischen Formen110 Vermessung & Geoinformation 3/2020
kantige, polygonale Formen umfasste (Cluster 1); chen Kodierschemas und seiner Logik ist es, alle
ein weiteres Cluster, das runde Formen umfasste Kernbedeutungen angemessen und eindeutig zu
(Cluster 2); sowie ein drittes Cluster, das stern- erfassen und gleichzeitig den gesamten Bereich
artige Formen als homogene Gruppe abbildete der verbalen Aussagen zu berücksichtigen. Die
(Cluster 3). Das Dendrogramm verdeutlichte zu- schriftlichen Protokolle wurden auf Basis des
dem eine Metarelation zwischen Cluster 1 und finalen Kodierschemas unabhängig von zwei
Cluster 2. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, Personen kodiert. Die Interrater-Reliabilität nach
dass sich polygonale Formen und runde Formen Krippendorffs Alpha ergab dabei eine Urteils-
auf einer Metaebene ähneln, während sternartige übereinstimmung von α = 0,87; CI [0,82, 0,93]. Im
Formen demgegenüber eine kognitiv-distinkte abschließenden Interpretationsprozess wurden
Gruppe bilden. die kodierten Aussagen zueinander in Beziehung
gesetzt und daraus Kategorien höheren Abstrakti-
4.2.2. Konnotative Wirkebenen onsgrades entwickelt.
In einem nächsten Analyseschritt wurden die Die Ergebnisse dieses Analyseverfahrens legten
Ergebnisse der retrospektiven Verbalisierung drei konnotativ-implizite Kernstrategien nahe, wel-
einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen, um che den Ähnlichkeitsurteilen der Teilnehmer*innen
jene Gründe und Strategien zu identifizieren, die zugrunde lagen:
an der Beurteilung der Formähnlichkeiten betei-
ligt waren. Im Speziellen wurde eine reduktive Visuelle Strategien: Mit 59,5% machten visuelle
qualitative Inhaltsanalyse nach dem Verfahren Formmerkmale die Mehrheit der Formgruppie-
der induktiven Kategorienbildung durchgeführt rungen aus. Nennungen bezogen sich dabei
[30]. Dabei werden Kategorien nach induktivem hauptsächlich auf a) das visuelle Erscheinungs-
Vorgehen schrittweise aus den verbalen Protokol- bild und die Geometrie der Formen (z. B. Ähn-
len entwickelt [31]. Die Datenanalyse folgt dabei lichkeit aufgrund von Ecken, Kanten, Rundung),
zunächst einer bestimmten Forschungsfrage, um sowie auf b) visuell-kognitive Hierarchie (z. B.
einen klaren Fokus auf den zu untersuchenden die Einteilung nach einfachen Grundformen ge-
Inhalt zu legen [32]. Im Fall dieser Forschung genüber komplexen Formen), und c) Symbiose
lautete die Frage: Welche Prozesse erklären die und Vervollständigung (z. B. vervollständigt eine
Ähnlichkeitsgruppierungen von Formen? Alle Form die andere oder zwei Formen zusammen
relevanten Textpassagen aus den retrospektiven ergeben eine neue Form).
Verbalisierungen wurden sodann anhand dieser Assoziationen: Assoziative Strategien zur Grup-
Fragestellung extrahiert und in ein schriftliches pierung der Formen wurden in 23,4% der Fälle
Protokoll übertragen. Das schriftliche Protokoll als Begründung genannt. Personen nahmen
wurde weiters in mehreren iterativen Analyse- hier etwa Bezug auf a) natürliche oder men-
schritten zusammengefasst, sodass aus vormals schgemachten Objekte (z. B. erinnerten Formen
Einzelaussagen, relevante Schlüsselgedanken an Straßenschilder, Himmelskörper, udgl.), oder
und Konzepte hervorgehoben und daraus ein referierten auf b) Karten (z. B. Assoziationen mit
Kodierschema entwickelt wurde. Ziel eines sol- kartographischen Punktsignaturen).
Abb. 3: Ergebnis der multidimen-
sionalen Skalierung und Cluster-
analyse; adaptiert nach [29].S. Klettner: Über die semiotischen Wirkebenen kartographischer Punktsignaturen 111
Affektive Qualitäten: In 17,1% der Antworten tungsebenen von abstrakten Punktsignaturen auf-
begründeten die Testteilnehmer*innen ihre zudecken und bediente sich dafür dem Konzept
Gruppierungsentscheidungen anhand von der Ähnlichkeit. Die Identifizierung von Ähnlich-
evaluativen, affektiven Formqualitäten. Die keiten ist in Kognitions- und Kommunikationswis-
Nennungen entsprachen dabei den drei Dimen- senschaften von zentraler Bedeutung, da dadurch
sionen semantischer und affektiver Theorien: kognitive Strukturen und Relationen aufgedeckt
Valenz, Aktivierung, Dominanz [33–35]. Derarti- werden können.
ge Formgruppierungen wurden in dieser Studie
Die hier vorgestellte Studie identifizierte drei
etwa anhand folgender Eigenschaften begrün-
homogene Formencluster auf Basis eines Stimu-
det: a) Valenz (z. B. unvollständig, langweilig), b)
lussets bestehend aus abstrakten, symmetrischen
Aktivierung (z. B. unruhig, aggressiv, ruhig) oder
Formen, sowie deren Relationen und Metarelatio-
c) Dominanz (z. B. auffällig, brutal, dominant,
nen. Darüber hinaus wurden dreierlei konnotative
schwer).
Bedeutungsebenen identifiziert, welche an der
Die Ergebnisse legen daher nahe, dass karto- Wahrnehmung von Formähnlichkeiten beteiligt
graphische Punktsignaturen auf mehrfachen kon- waren: visuelle, assoziative, und affektive Pro-
notativen Bedeutungsebenen wirken, und dass zesse. Die Ergebnisse untermauern die bereits
zumindest drei konnotative Wirkmechanismen an eingangs postulierte These, dass Formen nicht
der Wahrnehmung dieser beteiligt sind, nämlich neutral sind, und zeigen, dass Formeigenschaften
visuelle, assoziative, und affektive Prozesse. auf mehrfachen Ebenen wirken. Die Ergebnisse
dieser Studie verdeutlichten, dass Formen nicht
5. Diskussion nur rein anhand ihres visuellen Charakters wahr
genommen sondern ebenso über Assoziationen
Karten kommunizieren über Zeichen und Symbole und affektive Eigenschaften bewertet werden.
Informationen über den geographischen Raum. Diese Ergebnisse stützten ebenso eine auf dieser
Karten sind zugleich selektive Repräsentationen, Forschung aufbauende Studie, die zeigte, dass
da sie georäumliche Informationen ausschließlich Punktsignaturen über teils ausgeprägte affektive
ausgewählt, in verkleinertem Maßstab darstellen Profile verfügen [36]. Manche Signaturformen
können. Durch den Einsatz von Zeichen ermög- zeichneten sich dabei über ausgeprägt ruhende
lichen es Karten mentale Relationen zu räumli- und positiv-konnotierte Qualitäten aus, während
chen Ereignissen herzustellen, die weit über die andere Punktsignaturen als besonders dynamisch
unmittelbare, menschliche Wahrnehmung hinaus- und negativ-konnotiert erlebt wurden. Derartige
gehen. Die Art und Weise der kartographischen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass manche
Darstellung beeinflusst jedoch die menschliche Zeichen besonders expressiv wirken, wodurch
Vorstellung über Raum und räumliche Ereignisse. diese nicht als neutrale Signaturen im kartogra-
Die Herausforderung kartographischer Kom- phischen Kommunikationsprozess betrachtet
munikation besteht daher darin, dass kartogra- werden können.
phische Zeichen neben ihrer expliziten Funktion Diese Forschungsergebnisse eröffnen zugleich
als Referent von georäumlichen Vorkommnissen, eine Reihe weiterer zentraler Fragestellungen: Wie
ebenso über implizite, konnotative Bedeutungs- beeinflusst etwa die Wahl der Signatur die Vorstel-
ebenen verfügen, welche die Kartenwahrnehmung lung und Einschätzung von georäumlichen Vor-
und Interpretation des Karteninhalts beeinflussen kommnissen? Bewirken expressive Formsymbole
können. Während sich kartographisch-semioti- eine Überschätzung von räumlichen Ereignissen
sche Werke vor allem mit kognitiv-analytischen und Formsignaturen mit ruhendem Charakter
Aspekten befassen, gibt es bislang nur wenige eine Unterschätzung? Kann also die schiere Form
Studien, die sich explizit mit den subtilen, kon- eines einzelnen kartographischen Zeichens die
notativen Eigenschaften von kartographischen Aussagekraft einer Karte maßgeblich verändern?
Zeichen beschäftigen. Die vorliegende Forschung Kartographische Kommunikation erfordert daher
war daher bestrebt zu einer differenzierteren Per- gut informierte und gezielte Entscheidungen.
spektive über kartographische Punktsignaturen Denn nur durch ein fundiertes Wissen über die
beizutragen. Wirkebenen und Wirkweisen von Kartensignatu-
Die hier auszugsweise vorgestellte empirische ren können subtile, konnotative Bedeutungen im
Studie (siehe [29] für die vollständige Veröffentli- kartographischen Kommunikationsprozess mitbe-
chung) zielte daher darauf ab, Wirk- und Bedeu- rücksichtigt werden.112 Vermessung & Geoinformation 3/2020
Danksagung [19] MacEachren, A.M. (1995): How Maps Work: Represen-
Die Autorin wurde für die hier auszugsweise beschriebene tation, Visualization, and Design. The Guilford Press.
wissenschaftliche Arbeit von der Österreichischen Geodäti- [20] McKenzie, G., Hegarty, M., Barrett, T., & Goodchild, M.
schen Kommission mit dem Karl-Rinner Preis 2019 ausge- (2016): Assessing the effectiveness of different visua-
zeichnet. Die Autorin bedankt sich herzlich bei der Kommis- lizations for judgments of positional uncertainty. Inter-
sion für diese Ehrung. national Journal of Geographical Information Science,
30(2), 221–239.
Referenzen [21] MacEachren, A.M. (1992): Visualizing Uncertain Infor-
[1] ICA (2003): A Strategic Plan for the International Carto- mation. Cartographic Perspectives, 13, 10–19.
graphic Association 2003-2011. As adopted by the ICA [22] Monmonier, M. (1996): How to Lie with Maps. The Uni-
General Assembly 2003-08-16. versity of Chicago Press.
[2] Keates, J.S. (1996): Understanding Maps (2nd ed.): Ad- [23] Stachoň, Z., Šašinka, Č., Čeněk, J., Angsüsser, S.,
dison Wesley Longman Limited. Kubíček, P., Štěrba, Z., & Bilíková, M. (2018): Effect of
Size, Shape and Map Background in Cartographic Vi-
[3] Harley, J.B. (1989): Deconstructing the map. Cartogra-
sualization: Experimental Study on Czech and Chinese
phica, 26(2), 1–20.
Populations. ISPRS International Journal of Geo-Infor-
[4] Langer, S.K. (1953): Feeling and Form: A Theory of Art. mation, 7(11), 427.
Charles Scribner’s Sons.
[24] Jenny, B., Stephen, D.M., Muehlenhaus, I., Marston,
[5] Chandler, D. (2007): Semiotics: The Basics. Routledge. B.E., Sharma, R., Zhang, E., & Jenny, H. (2018): Design
[6] Koláčný, A. (1969): Cartographic Information - A Funda- Principles for Origin-destination Flow Maps. Cartogra-
mental Concept and Term in Modern Cartography. The phy and Geographic Information Science, 45(1), 62–75.
Cartographic Journal, 6(1), 47–49. [25] Thompson, M.A., Lindsay, J.M., & Gaillard, J. (2015):
[7] Kent, A.J. (2018): Form Follows Feedback: Rethinking The influence of Probabilistic Volcanic Hazard map Pro-
Cartographic Communication. Westminster Papers in perties on Hazard Communication. Journal of Applied
Communication and Culture, 13(2), 96–112. Volcanology, 4, 6.
[26] Muehlenhaus, I. (2012): If Looks Could Kill: The Impact
[8] Wood, D. (2010): Rethinking the Power of Maps. The
of Different Rhetorical Styles on Persuasive Geocom-
Guilford Press.
munication. The Cartographic Journal, 49(4), 361–375.
[9] Petchenik, B. (1977): Cognition in Cartography. Carto-
[27] Arnheim, R. (1978): Kunst und Sehen: Eine Psychologie
graphica: The International Journal for Geographic In-
des schöpferischen Auges. Walter de Gruyter.
formation and Geovisualization, 14(1), 117–128.
[28] Klee, P. (1920): Schöpferische Konfession. In K. Ed-
[10] Board, C. (2011): Cartographic Communication. In M. schmid (Ed.), Tribüne der Kunst und Zeit - Eine Schrif-
Dodge, R. Kitchin, & C. Perkins (Eds.), The Map Reader: tensammlung, Band XIII, 28–40. Erich Reiß Verlag.
Theories of Mapping Practice and Cartographic Repre-
[29] Klettner, S. (2019): Why Shape Matters—On the Inhe-
sentation, 37–47.
rent Qualities of Geometric Shapes for Cartographic
[11] Montello, D.R. (2002): Cognitive Map-Design Research Representations. ISPRS International Journal of Geo-
in the Twentieth Century: Theoretical and Empirical Ap- Information, 8(5), 217.
proaches. Cartography and Geographic Information [30] Mayring, P. (2015): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundla-
Science, 29(3), 283–304. gen und Techniken (12th ed.): Beltz.
[12] Słomska, K. (2018): Types of maps used as a stimu- [31] Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005): Three Approa-
li in cartographical empirical research. Miscellanea ches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health
Geographica Regional Studies on Development, 22(3), Research, 15(9), 1277–1288.
157–171. [32] Mayring, P. (2014): Qualitative Content Analysis: The-
[13] Field, K. (2014): A Cacophony of Cartography. The Car- oretical Foundation, Basic Procedures and Software
tographic Journal, 51(1), 1–10. Solution.
[14] Kraak, M.J., & Ormeling, F. (2011): Cartography: Visua- [33] Osgood, C.E., Suci, G.J., & Tannenbaum, P.H. (1967):
lization of Spatial Data. Guilford Press. The Measurement of Meaning. University of Illinois
Press.
[15] Kahneman, D. (2003): Maps of Bounded Rationality:
Psychology for Behavioral Economics. The American [34] Mehrabian, A., & Russell, J.A. (1974): An approach to
Economic Review, 93(5), 1449–1475. environmental psychology. The MIT Press.
[35] Bakker, I., Van Der Voordt, T., Vink, P., & De Boon, J.
[16] Padilla, L.M., Creem-Regehr, S.H., Hegarty, M., & Stefa-
(2014): Pleasure, arousal, dominance: Mehrabian and
nucci, J.K. (2018): Decision making with visualizations:
Russell revisited. Current Psychology, 33(3), 405–421.
a cognitive framework across disciplines. Cognitive Re-
search: Principles and Implications, 3, 29. [36] Klettner, S. (2020): Affective Communication of Map
Symbols: A Semantic Differential Analysis. ISPRS Inter-
[17] MacEachren, A.M., Roth, R.E., O’Brien, J., Li, B., national Journal of Geo-Information, 9(5), 289.
Swingley, D., & Gahegan, M. (2012): Visual Semiotics
and Uncertainty Visualization: An Empirical Study. IEEE Anschrift der Autorin
Transactions on Visualization and Computer Graphics, Mag.rer.nat. Silvia Klettner, BA, TU Wien, Department für
18(12), 2496–2505. Geodäsie und Geoinformation, Forschungsbereich Karto-
[18] Bertin, J. (1974): Graphische Semiologie: Diagramme, graphie, Gusshausstraße 30, 1040 Wien.
Netze, Karten. Walter de Gruyter. E-mail: silvia.klettner@tuwien.ac.atSie können auch lesen