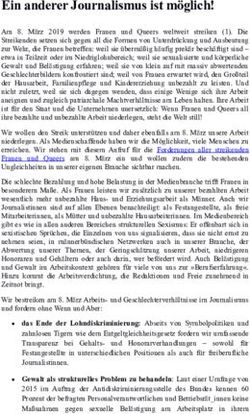Call for Papers Digitale Hermeneutik: Maschinen, Verfahren, Sinn
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
CfP
des Forschungs-
schwerpunkts
digtale_kultur
Call for Papers
Digitale Hermeneutik:
Maschinen, Verfahren, Sinn
Jahrestagung des FSP digitale_kultur
23. – 25. März 2022 an der FernUniversität in Hagen
Veranstalter : Prof. Dr. Thomas Bedorf, Prof. Dr. Peter RisthausCall for Papers
Digitale Hermeneutik: Maschinen, Verfahren, Sinn
Jahrestagung des FSP digitale_kultur
23. – 25. März 2022 an der FernUniversität in Hagen
Veranstalter: Prof. Dr. Thomas Bedorf, Prof. Dr. Peter Risthaus
Anfänglich enträtselt Hermeneutik als eher praktische Kunst Die Jahrestagung des Forschungsschwerpunkts digitale_kultur
die Sprache der Götter. Jene sprach sich durch Musen und in fragt transdisziplinär nach jenen Herausforderungen, die sich
Orakeln indirekt und verästelt aus, bevor sie in heiligen Schrif- dem Verstehen, dem Sinn, kurzum der Hermeneutik stellen,
ten fixiert vorliegt, die hermeneutisch sachgerecht gedeutet wenn Algorithmen, Programme, Maschinen und andere tech-
und ausgelegt werden müssen, um überhaupt erst ihren ei- nische Verfahren an ihm mitarbeiten.
gentlichen Sinn zu verstehen. Dem Problem, dass Zeichen und
Texte, sprachliche Kommunikation überhaupt, prinzipiell miss-
verstanden werden können, stellt Hermeneutik methodisch Panels:
abgesicherte Verfahren entgegen, die durch Auslegung und
Interpretationen jenen Sinn hütet und hervorbringt, den sie 1_@_Deutungsmacht_und_Digitalität
Worten und Büchern, den Erlebnissen und der Geschichte, un- 2_@_Verstehende_Algorithmen_/_Algorithmen verstehen
terstellt, – bei eigenwilliger Vernachlässigung der Zahlen. Dar- 3_@_Dimensionen_historischen_Verstehens_im_digitalen
aus wird in der Moderne nicht nur die Geisteswissenschaft Raum
entstehen, sondern die Idee abgeleitet, dass wir als sprachliche 4_@_Poetische_Maschinenräume
wesentlich verstehende, d.h. hermeneutisch bedürftige Wesen
sind.
Nachfolgend finden Sie inhaltliche Kurzbeschreibungen der
Heute ist Hermeneutik vielfältig herausgefordert, denn die Lage Panels. Ausführlichere Informationen zum Inhalt sowie forma-
hat sich fundamental geändert. Traute man anfänglich nur den le Angaben zur Zeichenzahl der Einsendungen und Einrei-
Göttern zu, das Wetter vorherzusagen, erledigen das jetzt be- chungsfrist der Abstracts finden Sie auf der Website des FSP
achtlich zielgenau Computer. Um es mit den Worten von Han- digitale_kultur unter:
nes Bajohr zu sagen: »Das Unding ist das Digitale. [...] Bereits
das Wort ›Wort‹ ist eine Ebene tiefer, hexadezimal, als 576F7274 www.fernuni-hagen.de/forschung/schwerpunkte/
codiert und wieder darunter, binär, als 01010111 01101111 digitale-kultur/jahrestagung2022.shtml
01110010 01110100«. Von einem Zeitalter der Digitalisierung
ist die Rede und nicht allein Dichter schulen auf Programmierer
um. Auch die Geistes- und Kulturwissenschaften siedeln längst
nicht mehr allein im Raum von Bibliotheken, sondern sie ge-
brauchen und entwickeln selbst Algorithmen, verdaten jenen
Sinn, über den sie nicht mehr allein die Deutungshoheit bean-
spruchen können.
02Panel_1_@ Deutungsmacht_&_Digitalität
Veranstalter*innen: Prof. Dr. Thomas Bedorf, Sarah Kissler, Dr. Thorben Mämecke
Anfänglich enträtselt Hermeneutik des FSP digitale_kultur un Diesen und anderen Problemen digitaler Deutungsmacht
Hermeneutik scheint eine ›weiche‹ Wissenschaft zu sein, eine wollen wir u.a. anhand folgender Fragen nachgehen:
harmlose statt machtvolle Annäherung an Deutungen von Tex-
ten, Bildern und Artefakten, die in eine mehr oder minder har- • Welche wissenschaftlichen Konzepte, Begriffe und Theo-
monische ›Horizontverschmelzung‹ mündet. Doch nur eine rien der Hermeneutik bergen besonderes Potenzial zur
ihrerseits harmlose Deutung von Deutungsprozessen vermag Einordnung von Deutungsprozessen unter digitalen Be-
eine solche harmonisierende Auffassung zu stützen. Eine der- dingungen?
artige Auslegung ist insbesondere in der Gegenwart digitaler
Medien in Frage zu stellen. Deutungsprozesse spielen sich nicht • Wie ist das Verhältnis von Menschen, Nicht-Menschen und
nur innerhalb von Diskurs- und Machtdispositiven ab, sondern (teil-)automatisierten Prozessen vor dem Hintergrund
etablieren diese selbst, indem sie Wirklichkeiten verändern oder hermeneutischer Perspektiven zu bestimmen?
erzeugen.
• Wie beeinflussen technologische Prozesse wie »social
Wahrheiten waren zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte – physics«, »micro targeting«, »nudging«, »dark posts«,
quasi naturwüchsig – mit der Politik verschwistert. Vielmehr »click baiting« und »Personality Assessments« Deutungs-
gehört die Rhetorik seit der griechischen ›Polis‹ zum Instrumen- prozesse und welche neuen politischen Machtmechanismen
tarium der Gestaltung von Machtverhältnissen, während bis- und -Verhältnisse gehen damit einher?
weilen gar die Lüge zum Proprium der Politik erklärt wird (Han-
nah Arendt). Entsprechend ist auch die Geschichte der Medien • Wie lassen sich solche Prozesse mit dem aktuellen Inventar
eine Geschichte der Deutungsmacht. forschungsoperativer Praktiken fassen und welche neuen
Ansätze sind denkbar?
Von Platons Höhlengleichnis bis zur Gegenwart folgt jedem
Medium wie ein Schatten die Frage nach Sinnverlust und Un- • Wo finden sich kontraintuitive Phänomene, digitale An-
eigentlichkeit (Hans Magnus Enzensberger). Doch unter Bedin- eignungsprozesse, Gegenstrategien oder politische und
gungen ›der Digitalität‹ diversifiziert sich das Verhältnis von wirtschaftsinhärente Paradoxien?
Macht, Deutung und Wirklichkeit; sei es durch Automatisierung
und Geschwindigkeit, durch Ubiquität und Distanzverlust, oder
durch Personalisierbarkeit und Wissensmonopolisierung. In ei-
ner digitalen Kultur, in der sich Bilder, Texte und ihre Produ- Als interdisziplinärer Forschungsschwerpunkt freuen wir
zent*innen hinsichtlich Verfügbarkeit, Kommunizierbarkeit und uns über Abstracts (von bis zu 500 Wörtern) aus Philo-
technischer Manipulierbarkeit vervielfältigt haben und volatiler sophie, Soziologie, Medien- und Kommunikationswissen-
geworden sind, werden Deutungsprozesse zunehmend tech- schaften, sowie fachübergreifend.
nologisch opak und unreflektiert. Bezeichnender Weise verjün-
gen sich damit einhergehende Manipulationsthesen heute Die Deadline für Zuschriften ist der 30. November 2021.
gerade unter den Bedingungen internetbasierter und dezent-
raler Kommunikationstechnologien. Während lange angenom- Einsendeadresse:
men wurde, dass sich Phänomene wie politische Deutungs- thorben.maemecke@fernuni-hagen.de
macht, Diskurshegemonie und Wahrheitsproduktion, die
vielfach mit den Monopolstellungen konventioneller Massen-
medien verbunden werden, durch eine Dezentralisierung und
Demokratisierung der Sender-Empfänger-Beziehungen im In-
ternet aufheben lassen, bestehen sie unter digitalen Bedingun-
gen nicht nur fort, sondern haben ihr Einflusspotential expo-
nentiell erweitert.
03Panel_2_@ Verstehende_Algorithmen_/_Algorithmen ver-
stehen
Veranstalter*innen: Prof. Dr. Claudia de Witt, Dr. Christian Leineweber, Vanessa Meiners
Im Begriff der Hermeneutik bündeln sich traditionell jene Fä- Folgende Fragen sind für die gewünschten Beiträge –
higkeiten, die Menschen erwerben, wenn sie ein Verständnis ohne Anspruch auf Vollständigkeit – leitend:
von etwas konstruieren. Hermeneutik verweist in diesem Sinne
auf die Methode, sprachlich kommunizierten Sinn zu verstehen • Auf welche Art und Weise sind Algorithmen derzeit an
(Jürgen Habermas). Herausgefordert wird diese Methode im Konstruktionen menschlicher Welt- und Selbstverhältnisse
Zeitalter der Digitalisierung maßgeblich deshalb, weil sich zu- beteiligt?
nehmend solche »Maschinen an der Kommunikation unter
Menschen« (Dirk Baecker) beteiligen, die sich durch eigenstän- • Welcher Reflexionen und Neuformulierungen bedarf der
dig rechnende Algorithmen und daraus resultierende künstlich Begriff des Verstehens angesichts maschinell generierter
intelligente Verfahren auszeichnen. Innerhalb dieser neuen Interpretationen?
Formen von Kommunikation profilieren sich algorithmisch ge-
steuerte Maschinen dadurch, dass sie eigenständig Verständ- • Zwischen welchen (empirischen) Methoden maschineller
nisse errechnen und entsprechend mitteilen können, dass sie Verstehensverfahren ist zu unterscheiden?
für den Menschen sinnhaft zugänglich sind. Wenn algorith-
misch konstruierte Verständnisse dabei jedoch ausschließlich • Welche (ethischen, technischen, didaktischen usw.) Modelle
auf mathematischen Rechenprozessen basieren, dann unter- und Prinzipien bedarf es, um die Operationen von Maschinen
scheiden sie sich kategorial von menschlichen Verständniskon- verstehen und in verschiedenen Kontexten anwenden zu
struktionen, weil hier lediglich regelgeleitete Muster interpre- können?
tiert, aber nicht in einem sprachlich kommunizierten Sinn
verstanden werden (Thomas Bächle). Verstehen steht im Kon- • Welche ideengeschichtlichen Prinzipien gehen der Entwick-
text von Maschinen synonym für die Konstruktion einer ma- lung (vermeintlich) verstehender Maschinen voraus und
thematisch berechneten Wirklichkeit (Heinz von Foerster). In- welchen Einfluss üben diese auf tradierte geisteswissen-
dem sich Maschinen an kommunikativen Prozessen beteiligen, schaftliche Begriffe und (tradierte) soziale Phänomene aus?
reichern sie die Methode der Hermeneutik mit veränderten
Verständnisprinzipien an.
Eine Hermeneutik, die sich als digital begreifen und profilieren Ausgehend von diesen Fragen, die methodische Anwen-
möchte, verweist unter solchen Voraussetzungen auf die Me- dungen und theoretische Reflexionen verbinden wollen,
thode, sprachlich kommunizierten und maschinell berechneten rufen wir zur Einsendung von Abstracts auf. Denkbar
Sinn zu verstehen. Mensch und Maschine treten so in ein Netz- sind Entwürfe für einen Workshop (2 h) und Einzelvor-
werk von kommunizierten und kommunizierbaren Verständ- trag (20 Min plus 20 Min Diskussion). Die Abstracts soll-
nissen. Dies setzt nicht mehr nur ein Verstehen der Welt, son- ten ca. 300 Wörter umfassen und dabei Zielsetzung
dern darüber hinaus auch verstehende Algorithmen und ein sowie theoretische, empirische und/oder methodische
Verstehen der Algorithmen voraus. Unser Panel widmet sich Bezugnahmen akzentuieren.
diesem ›Doppelspiel‹ aus philosophischer, kultur-, sozial-, me-
dien- und bildungswissenschaftlicher Perspektive. Die Deadline für Zuschriften ist der 30. November 2021.
Einsendeadresse:
algorithmen-verstehen@fernuni-hagen.de
04Panel_3_@ Dimensionen_historischen_Verstehens_im_digi-
talen Raum
Veranstalter*innen: Dr. Almuth Leh, Dr. Dennis Möbus
Historisches Verstehen ist nicht nur das Ziel geschichtswissen- • Unterstützen digitale Daten, Computer und Algorithmen
schaftlicher Hermeneutik, es ist vielmehr in die DNA der Her- den Prozess historischen Verstehens oder droht die digitale
meneutik eingeschrieben: Welt und Mensch – eine Grundan- Vermittlung auf verschiedenen Ebenen den Erkenntnisge-
nahme der Hermeneutik – sind nur in ihrem »Gewordensein« winn zu verschleiern?
(Johann Gustav Droysen) zu verstehen. Die in der Tradition der • Wie kann sichergestellt werden, dass durch die auf Wahr-
Phänomenologie stehende Biographieforschung untersucht scheinlichkeitsrechnung und Statistik beruhenden Verfahren
Lebensläufe, weil sie dem Paradigma folgt, menschliches Han- maschinellen Lernens die Außenseiter und Randphänomene
deln sei das Ergebnis eines Prozesses, habe also immer eine nicht vom mathematischen Mittelwert verschluckt werden?
Vorgeschichte. Nur wenn man diese berücksichtigt, sei es mög-
lich, menschliches Handeln zu verstehen. Diese mikrohistori- • Kann die Geschichtswissenschaft, um zwischen den Diszi-
sche Perspektive erfährt durch Untersuchungen zur Sozioge- plinen zu vermitteln, basales Handwerkszeug bereitstellen
nese gesellschaftlicher Phänomene ihre makrohistorische und bei der Entwicklung algorithmengestützter hermeneu-
Erweiterung. Nicht selten teilt sich der hermeneutisch verfah- tischer Verfahren unterstützen?
rende Fächerkanon Quellenkorpora oder Forschungsdaten, die
mit je eigenen Perspektiven, Fragestellungen und methodi-
schen Ausprägungen untersucht werden. Durch die Digitalisie- Wenn man diesen letzten ›Thread‹ weiterspinnt, stellt sich die
rung ist das ›hermeneutische Handwerk‹ bedeutenden Verän- Frage, inwiefern hermeneutisches Verstehen auch Perspektiven
derungen ausgesetzt. Ob originär digitale Daten/Quellen für die Erforschung Künstlicher Intelligenz bietet: Die funda-
(»born digital(s)«) oder durch exorbitante Retrodigitalisierungs- mentalen Prinzipien des Erfahrens durch Anschauung oder
projekte verfügbare historische „Big Data“, es gilt Heuristik, Zuhören kann man auf primitive Weise im massenhaften Sam-
Quellenkritik und hermeneutisches Arbeiten grundlegend zu meln digitaler Daten wiederfinden, auch das diachrone Herlei-
überdenken (Graham et al.). Eine ganze Fülle von Fragen drängt ten und synchrone Einordnen wird je nach Methode beim
sich auf. Zum Beispiel: Training der KI-Modelle angedeutet. Sind hier Synergien zwi-
schen Geisteswissenschaften und Informatik denkbar, um
• Wo liegen Gewinn und Risiken der breiten, spontanen und KI-Systeme zu optimieren und gleichzeitig verständlicher zu
häufig offenen Verfügbarkeit von Daten/Quellen? machen? Diesen Fragen möchten wir im Panel ›Dimensionen
historischen Verstehens im digitalen Raum‹ nachgehen, das
• Was geht bei der Vermittlung durch die Digitalisierung Beispiele aus der Praxis der Digital Humanities mit methodi-
sensorisch verloren? schen und theoretischen Reflexionen verbindet, und rufen zur
Einsendung von Paper Proposals auf.
• Wie sind Originale und Fälschungen im digitalen Raum zu
identifizieren?
• Welche Suchmechanismen und Strukturierungswerkzeuge Ein Vortrag ist auf 20 Minuten (plus 20 Minuten Diskus-
helfen bei der Spurensuche im digitalen Raum? Und wie sion) angesetzt. Das Proposal kann auf Deutsch oder
bestimmen sie darüber mit, was gefunden wird? Englisch eingereicht werden und sollte nicht mehr als 200
Wörter umfassen.
Die Deadline für Zuschriften ist der 30. November 2021.
Einsendeadresse:
dennis.moebus@fernuni-hagen.de
05Panel_4_@ Poetische_Maschinenräume
Veranstalter: Prof. Dr. Peter Risthaus, Helmut Hofbauer
Der Informatiker Theo Lutz programmiert 1959 einen Algorith- Das Panel fokussiert neben der Literaturgeschichte der ›Dich-
mus, der auf dem von Konrad Zuse konstruierten Z22 läuft und tungsmaschinen‹ aktuelle Lyrik-Bots und vergleichbare Textge-
die sogenannten ›Stochastischen Texte‹ auswirft. Heute gelten neratoren im Web. Beispiele dafür, die einen besonders inter-
sie als erste von Computern erzeugte Poesie. Die von Lutz aus- essanten Ansatz verfolgen oder sich durch hohen
gewählten 16 Substantive und Prädikate, Textmatrix seines Bekanntheitsgrad beim Publikum auszeichnen, sind etwa die
Programms, entstammen dem Roman »Das Schloß« von Franz Arbeiten von Kathrin Passig, Hannes Bajohr oder Ranjit Bhat-
Kafka. Wer ausprobieren möchte, welche ›Gedichte‹ dabei ent- nagar. Wir planen ›Literaten‹ zu uns einzuladen.
stehen, kann heute im Netz selbst ›Lutzen‹, so lautet das ent-
sprechende Verb, das nach seinem Erfinder benannt ist (https://
auer.netzliteratur.net/0_lutz/lutz_original.html). Die sogenann- Erwünscht sind Exposés zu folgenden Schwerpunkten:
te Stuttgarter Schule, rund um den Philosophen und Schrift-
steller Max Bense, wird sich intensiv mit der Programmierung • Algorithmische Dichtung, Permutation und Zufallsfunktionen;
solch poetisch-informatischer Texte befassen. Auch Hans-Ma- Neue Ansätze, die computerlinguistische und KI-Methoden
gnus Enzensberger verfasst 1974 eine »Einladung zu einem verwenden, beispielsweise zur Grammatik-, Metrik- oder
Poesie-Automaten«, der im Jahr 2000 dann tatsächlich gebaut Semantikanalyse (Konkordanzen, Lemmatisierung, Senti-
und auf dem Lyrikfestival ›Lyrik am Lech‹ präsentiert wird. In ment- u. Topic-Analyse etc.). Textquellen und Korpora, die
Enzensbergers Einladung findet sich auch eine kritische Ein- als Basis für die Verarbeitung dienen.
schätzung der Computerpoesie: »Es ist ein Spiel. Wie weit man
es mit Sinn auflädt, hängt vom Betrachter ab. Es können Ge- • Literatur- und Mediengeschichte von ›Dichtungsmaschinen‹
dichte entstehen, die jemand was sagen.«
• Neue Rezeptionshaltungen, neue Leser, neuer Literaturbe-
Zwei Jahre vor den ›Stochastischen Texten‹ von Lutz stellt der griff?
Philosoph Martin Heidegger in seinem Vortag ›Hebel der Haus-
freund‹ fest, dass »die [...] Dichtung selbst keine maßgebende • Maschinelle Produktion und sozialer Sinn: Interaktion und
Gestalt der Wahrheit mehr zu sein vermag«. Der Grund dafür Performanz, Timelines und Hashtags kommentieren, liken,
sei, dass die umfassende Technisierung der Welt und des Den- teilen und sich am Dichtungsprozess beteiligen, kollektive
kens in der Kybernetik ihren endgültigen Höhepunkt erreicht Autorschaft, antihumane Dichtung, Re-politisierung der
habe. Folge dieser Entwicklung ist eine »Sprachmaschine«, die Literatur, Hermeneutik der Maschinen.
Sprache auf berechenbare Information reduziere und so das
Verhältnis des Menschen zu ihr grundsätzlich verwandelt. Was
dabei angeblich verloren geht, sei jene ›poetische Tiefe‹ der
Sprache, so wie sie von Goethe angeschrieben worden sei:
»Man hat zwar eine Kenntnis von dem Vorgang, bedenkt aber Erwünscht sind Exposés, von bis zu 500 Wörtern, zu
nicht seinen Sinn.« Was aber wäre, wenn diese ›poetische Tie- Kurzvorträgen oder Präsentationen (20 Min. plus 20 Dis-
fe‹ selbst in jenen von Heidegger gezeihten ›Vorgang‹, den kussion) zu den beschriebenen Schwerpunkte.
unbewussten Schaltungen und Programmen zu finden ist, die
jenseits des Unterschieds zwischen Menschen und Maschinen Die Deadline für Zuschriften ist der 30. November 2021.
prozessieren? Welchen Ort hat dabei überhaupt ›Verstehen‹?
Seit Lutz, Bense und Enzensberger hat die ›Computerdichtung‹ Einsendeadresse:
erheblich aufgerüstet und zwar nicht allein technisch: Lyrik-Bots peter.risthaus@fernuni-hagen.de
und vergleichbare Textgeneratoren laufen jetzt auf Twitter und
in anderen sozialen Medien, von diversen Websites ganz zu
schweigen. Dichtung entsteht heute auch unter Beteiligung von
Algorithmen in mehr oder minder komplexen Kooperation von
Menschen, Maschinen, diverser Programme und verwertbaren
Textquellen aus dem Netz; aber ebenso durch technische Im-
plementierung eines linguistischen und poetologisches Wis-
sens, das zum Teil deutlich älter ist als Konrad Zuses Rechner.
06FernUniversität in Hagen
Die Rektorin
CfP
Universitätsstraße 47
58097 Hagen
des Forschungs-
www.fernuni-hagen.de
schwerpunkts
digtale_kultur
www.fernuni-hagen.de/forschung/
schwerpunkte/digitale-kultur/
Fotos:
Miggy Rivera von PexelsSie können auch lesen