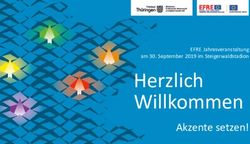Das Wasser der Eifel Text Barbara und Hans Otzen Fotos Heinrich Pützler - GEV (Grenz-Echo Verlag)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Text Barbara und Hans Otzen
Fotos Heinrich Pützler
Das Wasser der Eifel
Flüsse und Bäche – Seen und Maare – Quellen und Geysire
Luftaufnahme vom Rursee – im Vordergrund Einruhr mit dem SchiffsanlegerEin großes Auge, schwermutsvoll und klar,
So liegt vor mir im Abendgold das Maar,
Tief eingebettet in der Ufer Saum,
Ein Schlummerort, ein weltverlor’ner Traum.
aus „Am Weinfelder Maar‟
von Heinrich Kämpchen
© GEV (Grenz-Echo Verlag), Eupen (B), 2021
www.gev.be
buchverlag@grenzecho.be
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-86712-168-2
D/2021/3071/7
Text: Barbara und Hans Otzen
Fotos: Heinrich Pützler; außer Fotonachweise S. 191
Korrektorat: Mareike Lennertz
Layout: GEV, Eupen
Coverbild: Luftaufnahme das Brackvenns © Heinrich Pützler
Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlags ist es nicht gestattet, diese Publikation oder Teile
daraus auf fotomechanischem (Druck, Fotokopie, Mikrofilm, usw.) oder elektronischem Weg zu vervielfältigen,
zu veröffentlichen oder zu speichern.
Printed in EU
4|5 BildtextInhalt
1 | VORWORT 10
Einleitung 12
Die Römische Eifelwasserleitung 15
2 | FLÜSSE und BÄCHE der EIFEL 18
...die zum Rhein entwässern 18
Mit der Erft durch Bad Münstereifel 20
Zum Rotwein an der Ahr 24
Exkurs: Der Uhu an der Ahr 30
Exkurs: Eisvögel im Langfigtal 32
Die Sprachgrenze am Vinxtbach 34
Mit dem Vulkanexpress am Brohlbach entlang 35
Durch das Tal der Nette an Schloss Bürresheim vorbei 40
...die zur Mosel entwässern 42
Die Sauer und die Our – Eifeler Grenzflüsse 44
Die Kyll – ein Paradies für Fliegenfischer 46
Exkurs: Ein Forellenrevier 49
Die Salm – gesäumt von Burgen und Klöstern 50
Die Lieser – zwischen Maaren und Mosel 54
Exkurs: Ein Revier für die Wasseramsel 56
Der Alfbach – umrundet Burg Arras 60
Der Elzbach – im Tal der berühmten Burgen 61
Exkurs: Lebensraum für den bedrohten Feuersalamander 63
...die zur Maas entwässern 64
Die Rur – zum Rursee aufgestaut 66
Exkurs: Die Rückkehr des Bibers 68
6|7 Herbstbeginn im Langfigtal3 | SEEN, MAARE und MOORE der EIFEL 72 Eichholzmaar und Duppacher Weiher –
bei Steffeln und Duppach 136
Talsperren 72
Das Immerather Maar – ein Doppelmaar 137
Der Rurtalsperren Verbund 74
Das Meerfelder Maar – mit dem größten Maarkessel
Die Rurtalsperre Schwammenauel – die größte Talsperre der Eifel 75
der Westeifel 138
Exkurs: Die Wildkatze – das „Leittier“ des vom Rursee umgebenen Nationalparks Eifel 80
Der Obersee – die Trinkwasservorsperre zum Rursee 82 Der Sangweiher – kurfürstliches Erbe 142
Staubecken Heimbach und Obermaubach – zur Abwehr der „Urftwelle“ 86 Moore und wieder vernässte Maare 144
Die Urfttalsperre – die älteste Talsperre der Eifel 87 Das Hohe Venn – eine beeindruckende Landschaft 146
Oleftalsperre – mit einer Staumauer in Pfeilerzellenbauweise 89 Exkurs: Wo die Mooreidechse zu Hause ist 152
Die Dreilägerbachtalsperre – mit Vorsperre zur Wasserreinigung 90 Der Mosbrucher Weiher – von beeindruckender Größe 156
Die Wehebachtalsperre – ein dreiarmiger Talsperrensee 91 Das Booser Doppelmaar – Naturschutzgebiet unter
Die Kalltalsperre – wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere 94 dem Booser Eifelturm 157
Die Perlenbachtalsperre – benannt nach der Flussperlmuschel 95 Exkurs: Neuer Lebensraum für Libellen 160
Exkurs: Die Flussperlmuschel 98 Das Eckfelder Maar – Fundstätte tertiärer Fossilien 162
Exkurs: Eine Heimat für den Schwarzstorch 100 Das Rodder Maar – gibt Rätsel auf 166
Der Kronenburger See – ein beliebtes Ausflugsziel 101
Lac d'Eupen – die Wesertalsperre 102 4 | QUELLEN und GEYSIRE 168
Der Stausee Bütgenbach – im Süden der Deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgiens 106
Mineral- und Thermalquellen 168
Die Steinbachtalsperre – vom kleinen Bach zum großen Freibad 107
Heilwasser aus der Tiefe 170
Der Freilinger See – ein kleines Freizeitparadies 108
Exkurs: Bad Neuenahr –
Waldsee Rieden – ein kleiner Ferienstausee 109
ein Winzer gründet einen Kurbetrieb 172
Der Stausee Bitburg – mit einer Fontäne in seiner Mitte 110
Exkurs: Ringelnattern an der Prüm 111 Geysire 174
Andernach – der höchste Kaltwassergeysir der Welt 176
Maare 112
Wallender Born – im Volksmund „Brubbel“ genannt 178
Der Laacher See – Abbatia Mariae ad Lacum 114
Der Geysir im Wehrer Kessel 179
Das Ulmener Maar – der jüngste Vulkan der Eifel 118
Die Dauner Maare – Gemündener, Weinfelder und Schalkenmehrener Maar 122 Wasserfälle 182
Exkurs: Ein Paradies für Haubentaucher 130 Der Dreimühlenwasserfall – künstlich angelegt 184
Das Pulvermaar – das tiefste Auge der Eifel 132 Wasserfälle Reinhardstein und Bayehon 186
Das Holzmaar – bildet mit dem Dürren Maar und der Hitsche eine Dreiermaargruppe 133
Der Windsborn Kratersee – kein Maar, 5 | NACHWORT 188
sondern tatsächlich ein Kratersee 135 Fotonachweis 191Einleitung Rumpfflächen, die durch mehr oder weniger tief
eingeschnittene Täler strukturiert werden. Eine
Die Eifel ist eine geschichtsträchtige Mittelge- Oberfläche der Eifel. Als sich im Übergang zur Kar- geologische Besonderheit der Eifel stellt der vor 50
birgsregion. Im Norden wird sie durch den Übergang bonzeit vor 350 Millionen Jahren durch plattentek- Millionen Jahren einsetzende Vulkanismus dar. Die
zur Zülpicher Börde, im Osten durch den Rhein, im tonische Vorgänge der damalige Afrikanische Konti- letzte Eruption, die des Ulmener Maares, die noch
Süden durch die Mosel begrenzt. Der Übergang im nent dem Eurasischen Kontinent annäherte, wölbte nach der des Laacher Sees erfolgte, liegt kaum mehr
Westen ist fließend – hier setzt sie sich in den bel- sich der Meeresboden auf, die Fluten des Devon- als 11.000 Jahre zurück. Die erste Welle der Vulkan-
gisch-luxemburgischen Ardennen fort. Lange galt meeres flossen ab und das Variskische Gebirge fal- ausbrüche erfolgte in der Hocheifel. Die vulkanische
die von rauem Klima gekennzeichnete Eifel als „Ar- tete sich über weite Teile Mitteleuropas zu einem Aktivität ebbte dort vor 15 Millionen Jahren wieder
menhaus“ oder „Sibirien“ Deutschlands, lag sie doch 5.000 Meter hohen Plateau auf. In den Jahrmillionen ab. Viel jünger ist der Vulkanismus der West- und
wirtschaftlich und politisch weit abseits. Das war des folgenden Erdmittelalters erodierte die variski- Osteifel, der eine von Südosten nach Nordwesten
aber nicht immer so. Schon früh machte dieses Berg- sche Hochfläche zu einer Rumpffläche aus den de- verlaufende Reihe von Aschevulkanen, Schlackeke-
land die Menschen neugierig. Vor 100.000 Jahren vonischen Gesteinen, in deren Nord-Süd-Senke sich geln, Kratern und Maaren hinterließ. Gerade diese
drangen die ersten Jäger und von der Trierer Bucht bis Maare sind es, die die Landschaft der Eifel so einzig-
Sammler in ihre klimatisch Lange galt die Eifel mit ihrem rauen Klima als zur Zülpicher Börde die artig machen. Das auch Totenmaar genannte Weinfelder Maar
weniger benachteiligten Tä- „Armenhaus‟ oder „Sibirien‟ Deutschlands. sogenannten Eifeler Kalk-
ler ein. Die Kelten lernten mulden entlangziehen, Die Namensgebung der Maare geht auf den latei- hat er durch Anlage von Fischteichen sowie durch
ihre Bodenschätze zu nutzen. Die Römer übernah- wo sich ein Meereskanal am längsten halten konnte. nischen Begriff mare (= Meer) zurück und bezeich- Trockenlegung und Wiedervernässung von Maaren
men ihre handwerklichen und landwirtschaftlichen Mit der alpinen Gebirgsfaltung, die vor 100 Millio- net trichterförmige Vulankessel, die durch Wasser- typische Landschaftsformen verändert. Im Großen
Fähigkeiten. Zu dieser Zeit setzte die erste Blüte der nen Jahren einsetzte und die erst seit 5 Millionen dampf-Eruptionen in den Untergrund eingesprengt förderte er einerseits durch die Besiedlung der Tal-
Eifel ein. Auch strategisch war den Römern die Ei- Jahren abflacht, wurde das devonische Grundgebir- wurden. Diese Kessel entstehen, wenn aufsteigen- auen schwerste Schäden durch Überschwemmun-
fel wichtig, erstreckte sie sich doch zwischen ihren ge zum Rheinischen Schiefergebirge aus Bergischem des Magma auf Grundwasser im Gestein trifft. Das gen und Flutkatastrophen, andererseits erbrachte
Städten Aachen, Köln, Koblenz und Trier. Besonders Land und Taunus sowie aus Hunsrück und Eifel em- Wasser verdampft explosionsartig und schleudert der Talsperrenbau nachhaltige Veränderungen, die
schätzten sie das Wasser der Eifel. Angesichts des in porgehoben. Die tektonischen Kräfte neigten dabei das dadurch in kleinste Bestandteile zerfetzte Ge- heute so prägend für die Eifel sind.
ihren Städten durch Unrat beeinträchtigten Wassers die vormalige Oberfläche der Eifel zu einer leicht stein in die Atmosphäre. Übrig bleibt der Maartrich-
bauten sie eine große Wasserleitung, um das frische, welligen, nach Norden abflachenden Hochebene. ter. Insgesamt gibt es über 70 solcher Maarvulkane Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts wurden die
kalkhaltige und klare Wasser der Eifel bis nach Köln in der Eifel. Zwölf dieser Maartrichter sind mit Was- ersten Flüsse der regenreichen Rureifel aufgestaut,
zu transportieren. In der nun einsetzenden Eiszeit begann das Was- ser gefüllt, die von der Eifeldichterin Clara Viebig als wo jährlich über 1.250 Millimeter Regen fallen. Die
ser seine gestaltende Kraft auszuüben. Vor allem „Die Augen der Eifel“ bezeichnet wurden. Zwecksetzung bestand im Hochwasserschutz, der
Die geologische Geschichte der Eifel beginnt im in ihren Warmperioden, als die Feuchtigkeit große Brauch- und Trinkwassergewinnung und der Ener-
Erdaltertum, als ein großes Meer Mitteleuropa be- Regenmengen über die Eifel ergoss, gruben sich Bä- Doch letztlich veränderte der Mensch das Bild der gieerzeugung – alles vor allem zur Versorgung des
deckte. Die Sedimente dieses Meeres aus Schiefer, che und Flüsse immer tiefer in die Oberfläche ein Eifel durch Eingriffe in die Landschaft, wobei das Aachener Ballungsraums. Es begann mit der Urfttal-
Kalkstein, Quarzit und Sandsteinen bilden heute die und hinterließen die heutige Gestalt der Eifel aus Wasser eine entscheidende Rolle spielte. Im Kleinen sperre. Später wurde die Rur in zwei Phasen zu einer
12 | 13der größten Talsperren Deutschlands aufgestaut. Ein So zeigt sich die Eifel heute in vielfältiger Weise vom
Verbundnetz entstand mit zusätzlichen Sperren der Wasser geprägt. Strukturbildend sind die Bäche und
Olef, Kall, des Dreilägerbachs und des Wehebachs. Flüsse, landschaftsprägend die Maarseen, einzigartig
Weitere kleinere Sperren entstanden in weniger die sumpfige Hochfläche des Hohen Venns oder die
niederschlagsreichen Gebieten, vornehmlich zum verlandeten Maare. Dass der Vulkanismus der Eifel
Hochwasserschutz. Die aus den Sperren entstande- noch immer aktiv ist, zeigen die Mineralquellen und
nen Seen prägen inzwischen in entscheidender Wei- in ganz besonderer Weise die Mofetten des Laacher
se das Erscheinungsbild der Eifel, sind sie doch gut Sees. Wann der nächste Vulkanausbruch zu erwar-
in die Landschaft eingebunden und als Teil des Le- ten ist, wissen selbst die Wissenschaftler nicht...
bensbildes der Eifelbewohner sowie als touristische
Anziehungspunkte nicht mehr wegzudenken.
Die Römische Eifelwasserleitung
Die Römische Eifelwasserleitung, die Wasser aus fassung „Grüner Pütz“ bei Kall. Bei Keldenich führt
der Eifel nach Köln führte, zählt zu den längsten des die Leitung über die Wasserscheide zwischen Urft
gesamten Imperiums und ist ein Musterbeispiel an- und Erft. Unterhalb von Kreuzweingarten überquert
tiker Ingenieurskunst. Eine Vorläuferleitung bestand die Leitung dann die Erft in einem fünf Meter ho-
seit 30. n. Chr. Sie bezog ihr Wasser aus dem Vorge- hen Viadukt. Weiter führt sie an Flamersheim vor-
birge. Doch der Bedarf der rasch wachsenden Pro- bei und nördlich des Schornbuschs entlang, durch
vinzhauptstadt Niedergermaniens stieg so stark an, Rheinbach, in einem Aquädukt über die Swist, um
dass die Leitungskapazität nicht mehr ausreichte. Im bei Buschoven in den Kottenforst einzuschwenken.
Jahr 80. n. Chr. begann dann der Bau der eigentli- Von dort senkt sich die Leitung am Vorgebirge ent-
chen Eifelwasserleitung, die Köln bis in das 3. Jahr- lang, an Brühl vorbei, um letztendlich in der Colonia
hundert mit Frischwasser versorgte. Claudia Ara Agrippinensium (= Köln) zu enden.
Die 96 Kilometer lange Eifelwasserleitung wurde als Die Leitung wurde zum Schutz vor Frost weitge-
reine Gefälleleitung vom römischen Militär errich- hend etwa einen Meter unterhalb der Erdoberfläche
tet – schon damals konnte die Vermessungstechnik verlegt. Der Unterbau bestand aus einer losen Lage
Gefälle von 0,1 Prozent einhalten! Um rasch voran- Steine, auf die eine Rinne aus vermörtelten Mau-
zukommen, wurde der Bau in zwanzig Baulose auf- ersteinen gesetzt wurde. Der Corpus bestand aus
geteilt. Sie hatte ihren Ausgangspunkt in der Quell- zugehauenen, ebenfalls vermörtelten Natursteinen,
14 | 15 Luftaufnahme von der Wehebachtalsperre, deren Verzweigungen deutlich zu erkennen sind.Aufschluss der römischen Eifelwasserleitung im Kottenforst bei Buschhoven
auf dem ein Gewölbe aus gleichermaßen vermörtel- tuation änderte sich, als im Karolingerreich wieder
ten Steinen auflag. Die Innenmaße der Wasserlei- vermehrt Steinbauten errichtet wurden. Angesichts
tung betrugen siebzig Zentimeter in der Höhe und der schwierigen Beschaffung von Baumaterial fand
einem Meter in der Breite, sodass sie von innen be- die längst ruinöse römische Eifelwasserleitung durch
gangen werden konnte. Das Innere der Leitung war die niederrheinischen Kirchen-, Klöster- und Bur-
mit einem rötlichen Putz versehen, der neben Kalk genbaumeister eine zweite Verwendung. Sie nutz-
auch zerstoßene Ziegelsteine enthielt. Dieses Mate- ten nicht nur das Steinmaterial, sondern vor allem
rial erhärtete unter Wasser und diente zur Abdich- auch den Kalksinter, der sich in der Leitung durch das
tung der Leitung gegen Wasserverluste. von den Römern so geschätzte kalkhaltige Eifelwas-
ser abgesetzt hatte. Der bis zu 30 Zentimeter dicke
Im Jahr 260 n. Chr. wurde Köln von einfallenden Kalksinter wurde wie Marmor verwendet – daher
Germanen geplündert. Dabei nahm auch die Eifel- auch sein Name „Eifelmarmor“. Diese Kalkablage-
wasserleitung so großen Schaden, dass die Römer rungen sind in dem Aufschluss der Römischen Was-
sie nicht wieder in Betrieb nahmen. Nach dem Über- serleitung bei Kreuzweingarten besonders deutlich
fall blühte die Stadt wieder auf, bezog aber jetzt wie- zu sehen. Seit 2012 führt übrigens ein Wanderweg
der ihr Wasser aus dem Vorgebirge. In den Wirren entlang der Eifelwasserleitung. Dieser „Römerka-
der Völkerwanderungszeit war die Kenntnis von der nal-Wanderweg“ bietet an 53 Stationen umfangrei-
Eifelwasserleitung weitgehend verloren gegangen. che Informationen über die Leitungstrasse und die
Bautätigkeit aus Steinen erfolgte kaum noch. Die Si- Sehenswürdigkeiten der Umgebung.
16 | 17 Die Swist heute zwischen Meckenheim und LüftelbergFLÜSSE und BÄCHE
der EIFEL
...die zum Rhein entwässern
18 | 19 Das Hohe Venn von obenMit der Erft durch Bad Münstereifel 1966 beim Straßenbau zufällig entdeckt wurden und
heute Besuchern als Museum zugänglich gemacht
In Holzmühlheim auf 414 Meter Höhe oberhalb Der Mensch hat der Erft im Laufe der letzten Jahr- wurden.
von Bad Münstereifel entsteht die Erft gleich aus hunderte arg zugesetzt, ihren Verlauf eingeengt und
zwei Kuhbächen. Der eine so bezeichnete Kuhbach begradigt, was sich angesichts der Flutkatastrophe Ein Kleinod unter den Wasserburgen des Erfttals
entspringt am Osthang des Harzbüchels (537 m), im Juli 2021 besonders nachteilig auswirkte. Doch ist Burg Kirspenich. Die Anlage, deren Gräben vom
der andere südlich des Himbergs (550 m). Über 100 trotz der Eingriffe in den Flusslauf ist die Erft land- Holzbach kurz vor seiner Einmündung in die Erft
Kilometer verläuft die Erft weitgehend nordwärts, schaftlich prägend geblieben. In ihrem Oberlauf gespeist werden, entstand ab dem 13. Jahrhundert.
um bei Neuss in den Rhein zu münden. Das erste durch die Eifel wechseln sich reizvolle Talabschnitte Ihr Zentrum wird von einem mächtigen viereckigen
Viertel ihres Laufs vollzieht sie durch die Eifel, weist mit innerstädtischen und innerörtlichen Verläufen Wohnturm gebildet, der um eine Vorburg und ein
hier aber mit der historischen Stadt Bad Münsterei- wie in Bad Münstereifel oder Arloff-Kirspenich ab. barockes Wohnhaus ergänzt wird.
fel, den römischen Kalköfen von Iversheim und nicht Insbesondere in Bad Münstereifel ist es gelungen,
zuletzt mit dem in Arloff-Kirspenich einsetzenden das ummauerte Flussbett architektonisch in das Eine Wasserburg der ganz besonderen Art findet
Wasserburgenareal herausragende kulturgeschicht- Stadtbild zu integrieren. Der Ursprung dieser Stadt man im Erfter Eifelvorland auf den Höhen der Hardt.
liche Höhepunkte auf. Das Eifelvorland verlässt die liegt in einer Klostergründung des 9. Jahrhunderts, Dieser im Mittelalter wichtige Standort der Kurköl-
Erft östlich des Bergrückens der Hardt, um ihren der ihr auch den Namen, abgeleitet von monasteri- ner gegen die Grafen von Jülich wurde massiv mit
Weg durch die Zülpicher Börde bis zur Mündung um, verdankt. Bis heute hat Bad Münstereifel seinen großer Vorburg ausgebaut und von ausladenden
fortzusetzen. mittelalterlichen Charakter mit einer fast vollständig Wassergräben umgeben, die aus unterirdischen
erhaltenen Stadtmauer, vier Stadttoren, der Burg Quellen gespeist werden. Im Bergfried der Burg sind
Aufwändig bunt bemalte Schnitzereien am Haus und einem großen Bestand an vorbildlich restauri- auch Steine der römischen Eifelwasserleitung einge-
Windeck in Bad Münstereifel erten Fachwerkhäusern erhalten. Drei Bauten ragen baut, die in der Nähe vorbeiführt.
neben der romanischen Stiftskirche St. Chrysanthus
und Daria besonders heraus: das Romanische Haus Die zufällig entdeckten und ausgegrabenen römi-
aus dem Jahr 1167 als einem der ältesten Wohn- schen Kalkbrennöfen bei Iversheim
häuser des Landes mit drei Fenstersäulen aus dem
Kalksinter der Römischen Eifelwasserleitung, das
Windeckhaus in der Orchheimer Straße mit aufwän-
dig geschnitzter Fassade sowie das gotische Rathaus
aus dem 14. Jahrhundert.
Wenig unterhalb von Bad Münstereifel stehen in
Iversheim am Rand des Erfttals sechs von den Rö- Das Zentrum der Wasserburg von Kirspenich
mern nebeneinander errichtete Kalkbrennöfen, die stellt der weithin sichtbare Wohnturm dar.
20 | 2122 | 23 Die Eisenbahnbrücke oberhalb von Walporzheim wurde im Juli 2021 durch die Flutkatastrophe zerstört
Sie können auch lesen