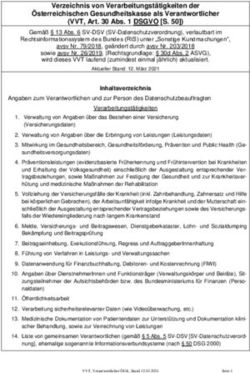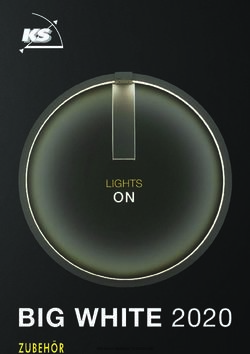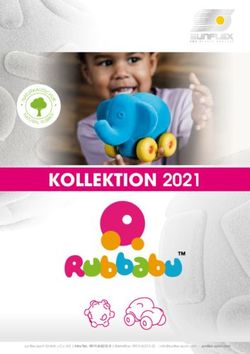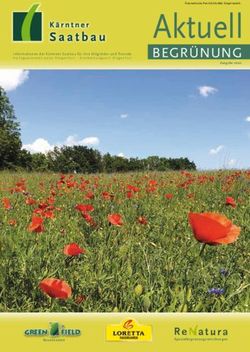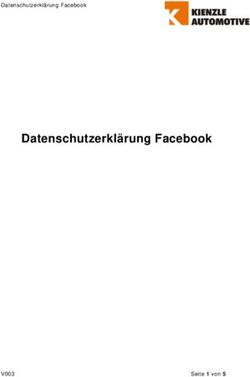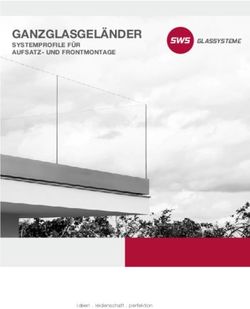DER EUROPÄISCHE HAFTBEFEHL IM LICHTE RECHTSSTAATLICHER DEFIZITE - JKU ePUB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Eingereicht von
Kevin Schönfelder-
Kickinger
Angefertigt am
DER EUROPÄISCHE Institut für Europarecht
Beurteiler
HAFTBEFEHL IM Univ.-Prof. Dr. Franz
Leidenmühler
LICHTE März 2021
RECHTSSTAATLICHER
DEFIZITE
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Magister der Rechtswissenschaften
im Diplomstudium
Rechtswissenschaften
JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Österreich
jku.at
DVR 0093696EIDESSTATTLICHE ERKLARUNG lch erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch. Theresienfeld, 31 .03.2021 Kevin Schönfelder-Kickinger / d
Danksagung Zuerst gebührt mein Dank Herrn Institutsvorstand Univ.-Prof. Dr. Franz Leidenmühler, der diese Diplomarbeit betreut und begutachtet hat. Meiner Mutter Alexandra danke ich für die finanzielle Unterstützung und den stets bestärkenden Zuspruch in schwierigen Zeiten. Ohne sie wäre mir das Studium in dieser Form nicht möglich gewesen. Darüber hinaus gilt mein Dank meinem Stiefvater Christian, meiner Schwester Jacqueline, meiner Oma Johanna, meinem Freund Paul und allen namentlich hier nicht genannten Personen. Sie alle haben mich durch einen materiellen und / oder immateriellen Beitrag auf diesem Weg unterstützt.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung ............................................................................................................... 1
II. Hauptteil ................................................................................................................ 3
A. Historische Entwicklung der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen........ 3
B. Rechtliche Grundlagen ................................................................................... 5
1. Primärrecht ............................................................................................................ 5
2. Sekundärrecht ....................................................................................................... 7
a) Rahmenbeschluss 2002/584/JI .............................................................................. 8
b) Rahmenbeschluss 2009/299/JI .............................................................................. 8
c) Beschluss 2002/187/JI ........................................................................................... 9
d) Beschluss 2007/533/JI ........................................................................................... 9
C. Problemfelder ............................................................................................... 10
1. Ausstellung .......................................................................................................... 10
a) Organisatorische Anforderungen an den Aussteller ............................................. 10
2. Vollstreckung ....................................................................................................... 13
a) Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung ......................................................... 13
b) Aussetzung des Mechanismus ............................................................................ 14
c) Ablehnung ........................................................................................................... 15
(1) Fakultativ ............................................................................................................. 15
(2) Obligatorisch........................................................................................................ 17
(3) Grundrechte und allgemeine Rechtsgrundsätze .................................................. 18
(a) Zweistufige Prüfung (Aranyosi-Formel) ................................................................ 18
i. Systemische oder allgemeine Mängel ...................................................... 19
ii. Individuelle Gefahrenprognose ................................................................. 24
(b) Kritik und alternatives Prüfungsmodell ................................................................. 25
i. Strukturunterschiede Art 4 und Art 47 Abs 2 GRC .................................... 25
ii. Selektiver Grundrechtsvorbehalt ............................................................... 26
iii. Verlagerung der Grundrechtsverantwortlichkeit ........................................ 27
iv. Notwendigkeit einheitlicher Auslegung des systemischen Mangels .......... 28
v. Art 19 Abs 1 UAbs 2 EUV als Prüfungsmaßstab....................................... 29
III. Resümee und Ausblick ........................................................................................ 30
IV. Literatur-, Judikatur- und Materialienverzeichnis .................................................. 33Abkürzungsverzeichnis
ABl ............................................ Amtsblatt
Abs ........................................... Absatz
AEUV ........................................ Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
aF ............................................. alte Fassung
Art ............................................. Artikel
Aufl ........................................... Auflage
Bd ............................................. Band
BGBl ......................................... Bundesgesetzblatt
bspw ......................................... beispielsweise
bzw ........................................... beziehungsweise
dh ............................................. das heißt
EGMR....................................... Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGV .......................................... Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaften
EMRK ....................................... Europäische Menschenrechtskonvention
EnzEur ...................................... Enzyklopädie Europarecht
EU ............................................ Europäische Union
EuGH ........................................ Europäischer Gerichtshof
EuHb ........................................ Europäischer Haftbefehl
EuR .......................................... Zeitschrift Europarecht
EUV .......................................... Vertrag über die Europäische Union
f ................................................ folgende
ff ............................................... fortfolgende
GA ............................................ Generalanwalt
ggf ............................................ gegebenenfalls
GRC ......................................... Charta der Grundrechte der Europäischen Union
hM ............................................ herrschende Meinung
Hrsg .......................................... Herausgeber
HS ............................................ Halbsatz
idF ............................................ in der Fassung
idR ............................................ in der RegeliSd ............................................ im Sinne des
iVm ........................................... in Verbindung mit
iZm ........................................... im Zusammenhang mit
Jud............................................ Judikatur
EU-JZG..................................... Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in
Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union
lit ............................................... littera
Ms............................................. Mitgliedstaat
Nr.............................................. Nummer
ÖJZ........................................... Österreichische Juristenzeitung
RB ............................................ Rahmenbeschluss
RFSR ........................................ Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechtes
Rs ............................................. Rechtssache
Rsp ........................................... Rechtsprechung
Rz ............................................. Randziffer
S ............................................... Satz
SIS............................................ Schengener Informationssystem
sog............................................ sogenannte
ua ............................................. unter anderen
UAbs ......................................... Unterabsatz
verb .......................................... verbundene
vgl ............................................. vergleiche
vs .............................................. versus
Z ............................................... Ziffer
ZStW ........................................ Zeitschrift für die gesamte StrafrechtswissenschaftenI. Einleitung
„Wenn es in Polen Rechtsverletzungen gibt, dann werden diese vor allem von den
Gerichten selbst begangen und es gibt dafür unzählig viele Beispiele.“1 Dieses Zitat
stammt vom Vorsitzenden der polnischen Regierungspartei PiS (Prawo i
Sprawiedliwość), Jarosław Kaczyński, der damit das Gesetz zur Richterdisziplinierung
zu rechtfertigen versuchte. Mit Beschluss vom 08.04.20202 gewährte der EuGH
vorläufigen Rechtsschutz und trug der Republik Polen auf die Anwendung der
Bestimmungen über die Befugnisse der Disziplinarkammer beim Obersten Gericht, im
Hinblick auf Disziplinarverfahren gegen Richter, auszusetzen.
Polen hat bereits im November 2015 Justizreformen eingeleitet, welche die gesamte
Struktur des Justizsystems betreffen und zwar neben den Verwaltungsgerichten und
dem Verfassungsgerichtshof auch die ordentliche Gerichtsbarkeit, einschließlich dem
Obersten Gericht. Besonders hervorzuheben ist die Justizreform von 2018, mittels
welcher das Verfahren zur Ernennung der richterlichen Mitglieder des Landesjustizrates
geändert wurde. Diese werden nun direkt vom Parlament (Sejm) ernannt und nicht mehr
von ihresgleichen. Der Landesjustizrat ist für die Unabhängigkeit der Gerichte von
fundamentaler Bedeutung, zumal er dem Präsidenten der Republik Kandidaten für die
Ernennung als Richter vorschlägt und auch die richterlichen Mitglieder der
Disziplinarkammer auf seinen Vorschlag hin ernannt werden. Dieser Kammer wiederum
kommen weitreichende Befugnisse zu, denn sie ist nicht nur ermächtigt die Immunität
von Richtern aus Anlass eines Strafverfahrens aufzuheben, sondern bildet auch die
letzte Instanz in Disziplinarverfahren.3
Mit Beschluss vom 17.02.2020 hat zum ersten Mal ein deutsches Gericht, das
Oberlandesgericht Karlsruhe, Zweifel geäußert, ob aufgrund der Justizreformen Polens
die Unabhängigkeit der polnischen Justiz und der Anspruch des zu Übergebenden auf
ein faires Verfahrens iSd Art 47 Abs 2 GRC im Zuge des Übergabeverfahrens, nach dem
Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl, gewährleistet ist. Die
1 https://orf.at/stories/3152188/, abgefragt am 12.02.2021.
2 EuGH 08.04.2020 Rs C-791/19, Kommission/Polen, ECLI:EU:C:2020:277.
3 Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 2020, Länderkapitel Polen, 1-9.
1Übergabehaft wurde in dieser Rechtssache aufgehoben, im Verfahren selbst ist jedoch
noch keine abschließende Entscheidung ergangen.4
Auch in Ungarn ist die Kritik in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz nicht vollends
verstummt. So kritisiert der Bericht über die Rechtsstaatlichkeit die untergeordnete
Stellung des Landesrichterrates im Vergleich zum politisch gewählten Präsidenten des
Landesrichteramtes, welcher wesentliche Entscheidungen hinsichtlich der Verwaltung
des Gerichtssystems zu treffen hat und daher einer zureichenden Kontrolle unterliegen
sollte. Darüber hinaus steht die Beeinträchtigung der Stellung von
Vorabentscheidungsersuchen durch die Gerichte in Kritik, sowie das leistungsabhängige
Bonussystem für Richter.5
Diese Diplomarbeit setzt sich mit einem wichtigen Instrumentarium der europäischen
Strafrechtspflege, dem Europäischen Haftbefehl, auseinander, dessen Mechanismus
vor dem Hintergrund des Justizumbaus in Polen, aber auch aufgrund der
Haftbedingungen in Ungarn und Rumänien, auf eine besondere Probe gestellt wurde
und wird. Er war mehrfach Gegenstand von Vorabentscheidungsersuchen, weil die
Gefahr von Grundrechtsverletzungen im Raum stand.
Die besondere Relevanz des EuHb resultiert letztlich aus dem Abbau der
Grenzkontrollen in der Union, zumal die Erleichterung und Beschleunigung des
Personenverkehrs auch der grenzüberschreitenden Kriminalität zu Gute kommt.
Ausgehend vom Prinzip der gegenseitigen Anerkennung war die Abschaffung des
zweigliedrigen förmlichen Auslieferungsverfahrens im Verhältnis der Unionsstaaten6
zueinander folgerichtiger Schritt, wiewohl diese Anerkennung auf dem Vertrauen eines
Mitgliedstaates in die Einhaltung des Unionsrechtes und der Grundrechte durch den
anderen Mitgliedstaat fußt.7
Ich gehe nun im Vorfeld auf die rechtshistorischen und rechtlichen Grundlagen ein, um
sodann die Problemfelder im Rahmen von Ausstellung und Vollstreckung aufzuzeigen.
Bei Ausstellung eines Europäischen Haftbefehles muss stets eine Justizbehörde im
Sinne des Art 6 Abs 1 RB-EuHb handeln, wobei ich anhand der Rechtsprechung des
EuGH die Anforderungen an diese Behörde herausstreichen möchte. Der Schwerpunkt
4 https://www.lto.de/recht/justiz/j/olg-karlsruhe-ausl301ar156-19-ausliefung-polen-faires-verfahren-
justizreform/, abgefragt am 16.02.2021; https://oberlandesgericht-karlsruhe.justiz-bw.de/pb/,Lde/6096769/,
abgefragt am 16.02.2021.
5 Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 2020, Länderkapitel Ungarn, 1-9.
6 Vgl Erwägungsgrund 1 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI.
7 Vgl EuGH 18.12.2014 Gutachten 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454 (Rz 191-192).
2der gegenständlichen Arbeit liegt aber jedenfalls im Bereich der Vollstreckung. Es wird
hier die zweistufige Prüfungsformel erörtert, welche die außergewöhnlichen Umstände
iZm den Grundrechten darlegt, die letztlich ein Abgehen vom Grundsatz der
gegenseitigen Anerkennung erlauben. Im Anschluss daran möchte ich die wesentliche
Kritik an dieser, von der Judikatur entwickelten, Formel dartun.
II. Hauptteil
A. Historische Entwicklung der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen
Da die Justizpolitik als Kernbereich der staatlichen Souveränität betrachtet wird,
bestanden hier seitens der Mitgliedstaaten von Anfang an massive Vorbehalte. Zunächst
gab es Kooperation im Bereich von Kriminalitätsbekämpfung und Strafverfolgung nur im
Rahmen der TREVI-Arbeitsgruppen („Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme, Violence
Internationale“), eingesetzt 1975 und CELAD („Comité Européen de la Lutte
Antidrogue“), einem Komitee zur Bekämpfung der Drogenkriminalität, eingesetzt 1989
jeweils durch den Europäischen Rat.8
Mit dem Inkrafttreten des Vertrages von Maastricht am 03.11.1993 wurde die EU zu
einem aus drei Säulen bestehenden Tempel geformt. Dabei wurde die erste Säule aus
Gemeinschaftsrecht konstruiert, dem supranationaler Charakter zugesprochen wurde.
Die zweite und die dritte Säule waren intergouvernemental geprägt. Die zweite Säule
umfasste die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Die dritte Säule
wiederrum schuf Strukturen für eine staatsübergreifende Kooperation in
Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse. Bemerkenswert ist, dass die Grenzen
zwischen der ersten und dritten Säule teilweise aufgeweicht wurden, als der Gerichtshof
klarstellte, dass strafrechtliche Vorgaben des Gemeinschaftsgesetzgebers im Bereich
der Umwelt insofern zulässig waren, als sie die volle Wirksamkeit von Rechtsnormen
zum Umweltschutz gewährleisten sollten.9
Die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (ZBJI) wurde in den EUV und
damit auch in die dritte Säule überführt. Die justizielle Zusammenarbeit in Straf- und
Zivilsachen war damit einer von neun Politikbereichen, welche Art K.1 EUV (idF des
Maastrichter Vertrages) taxativ aufzählte. Ziel der ZBJI war zudem die Installation eines
Systems zum Informationsaustausch im Rahmen eines Europäischen Polizeiamtes
8
Vgl Hecker, Europäisches Strafrecht, Rz 26-28.
9 EuGH 13.09.2005 Rs C-176/03, Kommission/Rat, ECLI:EU:C:2005:542 (Rz 19).
3(Europol).10 Regelungen des Unionsrechtes bildeten Fundament und Dach der
Tempelkonstruktion.11
Im Bereich der dritten Säule war der Rat der EU gesetzgebendes Organ, welches sich
bezüglich der grenzüberschreitenden Strafverfolgung der Mittel des Art 34 Abs 2 EUV
aF bedienen konnte.12 Das waren der gemeinsame Standpunkt, der Rahmenbeschluss,
der Beschluss und das Übereinkommen.13
Durch das Inkrafttreten des Vertrages von Amsterdam am 01.05.1999 wurde die Basis
für einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts geschaffen, zugleich aber
die ZBJI auf eine polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS)
reduziert, dh der RFSR auf einen supranationalen und intergouvernementalen Bereich
zerteilt.14
Als Handlungsform der dritten Säule wurde das Rechtsinstitut des Rahmenbeschlusses
installiert, wobei dieses seiner Natur nach der Richtlinie gem Art 249 Abs 3 EGV aF
ähnelte, zumal Verbindlichkeit hinsichtlich des zu erreichenden Zieles bestand, den
innerstaatlichen Stellen aber Spielraum bei Wahl von Form und Mittel überlassen
wurde.15 Nach Inkrafttreten eines Rahmenbeschlusses mussten die Mitgliedstaaten
legislativ tätig werden, zugleich aber auch nationale Vorgaben, also
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und etwaige verfassungsmäßige Schranken bei der
Umsetzung beachten. Rahmenbeschlüsse gem Art 34 Abs 2 lit b EUV aF sollten Rechts-
und Verwaltungsvorschriften angleichen, um die polizeiliche und justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen zu fördern. Für die Annahme von Rahmenbeschlüssen
galt das Einstimmigkeitsprinzip. Eine unmittelbare Anwendbarkeit war explizit
ausgeschlossen.16
Am 01.12.2009 trat schließlich der Vertrag von Lissabon in Kraft, der die bisherige dritte
Säule der EU, also die bereits genannte polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in
Strafsachen, in den vergemeinschafteten Bereich übernahm. Daraus folgt auch, dass
seitdem das Instrument des Rahmenbeschlusses nicht mehr genutzt werden kann,
10 Vgl Hecker, Europäisches Strafrecht, Rz 54.
11 Zur Tempelkonstruktion vgl Feik in Lagodny/Wiederin/Winkler (Hrsg), Probleme des
Rahmenbeschlusses, 9 f.
12 Vgl Schallmoser, Europäischer Haftbefehl und Grundrechte (2012), 16.
13 Vgl Schallmoser, Europäischer Haftbefehl und Grundrechte (2012), 16.
14 Vgl Weiß/Satzger in Streinz (Hrsg), 3. Aufl. 2018, AEUV Art 67, Rz 3.
15 Vgl: Hecker, Europäisches Strafrecht, Rz 67; Von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches
Unionsrecht, 7. Auflage 2015, Vorbemerkung zu den Artikeln 67 bis 76, Rz 9.
16 Vgl Schallmoser, Europäischer Haftbefehl und Grundrechte (2012), 18.
4vielmehr die supranationalen Handlungsformen heranzuziehen sind.17 Bereits erlassene
Rahmenbeschlüsse bleiben gültig bis zur Aufhebung, Nichtigerklärung oder Änderung.18
B. Rechtliche Grundlagen
1. Primärrecht
Art 3 EUV enthält die Ziele der Union, der damit Grundlage aller Unionsakte ist. Dabei
kommt dieser Bestimmung fundamentale Bedeutung zu, weil es sich nicht um einen
bloßen Programmsatz handelt, sondern um eine rechtsverbindliche
Ausrichtungsvorgabe im Gefüge des Unionsrechtes. Adressat dieser nicht unmittelbar
anwendbaren Bestimmung ist alleine die Union.19 Mit Art 3 Abs 2 EUV wurde der RFSR
als eigenes Ziel verankert, welches seine Konkretisierung in Art 67ff AEUV erfährt.20
Gem Art 3 Abs 6 EUV gilt hier das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und der
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.21
Art 67 Abs 1 AEUV spricht von einem RFSR, ohne dass es hierzu eine Legaldefinition
gäbe. Es ist wohl davon auszugehen, dass jedem dieser drei Begriffe „Freiheit“,
„Sicherheit“ und „Recht“ einer der Abs 2-4 zuzuordnen ist.22
Die Kapitel des Titel V enthalten die Regelungsgebiete Asyl, Migration, Grenzkontrolle,
Zusammenarbeit der Zivilgerichte, Zusammenarbeit der Justiz in Strafsachen und
polizeiliche Zusammenarbeit. Bei näherer Betrachtung dieser Bereiche wird klar, dass
der RFSR ein Areal der Reisefreiheit und Personenfreizügigkeit umfasst, in welchem
sich alle Menschen, nicht nur die Unionsbürger, ohne Grenzkontrollen und Gefahr von
Kriminalität fortbewegen können.23 Die gegenseitige Anerkennung wird Grundlage der
justiziellen Kooperation.24
Das Kapitel 4 „Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen“ umfasst die Art 82-86 AEUV.
Basis für die Kooperation im Bereich der Strafverfolgung bildet Art 82 AEUV. Diese Norm
ist auch Grundlage für ein werdendes europäisches Strafverfahrensrecht.25 Aufgrund der
Supranationalisierung in diesem Bereich greift nunmehr der Vorrang des Unionsrechtes
17 Vgl Weiß/Satzger in Streinz (Hrsg), 3. Aufl. 2018, AEUV Art 67, Rz 16.
18 Art 9 des Protokolls (Nr 36) über die Übergangsbestimmungen, ABl. 2010 C 83/322.
19 Vgl Pechstein in Streinz (Hrsg), 3. Aufl. 2018, EUV Art 3, Rz 2-4.
20 Vgl Pechstein in Streinz (Hrsg), 3. Aufl. 2018, EUV Art 3, Rz 6.
21 Vgl Pechstein in Streinz (Hrsg), 3. Aufl. 2018, EUV Art 3, Rz 13.
22 Weiß/Satzger in Streinz (Hrsg), 3. Aufl. 2018, AEUV Art 67, Rz 25.
23 Weiß/Satzger in Streinz (Hrsg), 3. Aufl. 2018, AEUV Art 67, Rz 26-31.
24 Bauer in Weidenfeld, Lissabon in der Analyse, 104.
25 Satzger in Streinz (Hrsg), 3. Aufl. 2018, AEUV Art 82, Rz 1.
5und es stehen alle bekannten Rechtsaktformen zur Verfügung. Das Prinzip der
gegenseitigen Anerkennung soll einen RFSR ermöglichen, wobei auf dieses an späterer
Stelle genauer eingegangen werden wird. Art 82 Abs 1 UAbs 2 AEUV sieht im
Gegensatz zu Abs 2 und Art 83 AEUV keine bestimmte Rechtsaktform vor. Eine
Rechtsangleichung des nationalen Strafprozessrechts im engeren Sinne darf sich nicht
auf diese Grundlage stützen. Sämtliche strafprozessuale Vorschriften sind einer
Harmonisierung auf Basis des Abs 1 UAbs 2 entzogen, sofern diese in einem rein
innerstaatlichen Strafverfahren ohne Auslandsbezug zur Anwendung kommen.26
Richtlinien können jedenfalls Vorschriften enthalten, die im Kern den in Abs 1 UAbs 2
vordringlich angesprochenen Bereich der Kooperation der Mitgliedstaaten bei der
Strafrechtspflege (die Rechtshilfe) betreffen. Somit können auch Nachbesserungen an
Instrumenten wie dem Europäischen Haftbefehl, die nach altem Recht durch einen
Rahmenbeschluss geschaffen worden sind, mittels Richtlinien (konkret auf Grundlage
des Abs 1 UAbs 2 lit a) erfolgen und es muss nicht, was deutlich umständlicher wäre, zu
Verordnungen gegriffen werden.27
Für die gegenständliche Arbeit relevant sind lit a und lit d. Lit a ist die umfangreichste
und wichtigste Rechtsgrundlage, zumal diese das Prinzip der gegenseitigen
Anerkennung betrifft und gleichsam die Königsnorm der strafjustiziellen
Zusammenarbeit darstellt.28 Umfasst sind sämtliche Maßnahmen, welche Regeln
aufstellen für die Gewährleistung der gegenseitigen Anerkennung von Urteilen und
justiziellen Entscheidungen. Lit d normiert eine Generalklausel. Während lit a die
gegenseitige Anerkennung justizieller Entscheidungen betrifft, verbleibt für lit d ein
Anwendungsbereich abseits von gegenseitiger Anerkennung und in Bezug auf andere
Behörden als Justizbehörden, sowie hinsichtlich nichtjustizieller Entscheidungen, etwa
solcher von Steuer- und Vollzugsbehörden. 29
Art 82 Abs 2 AEUV erlaubt eine Mindestharmonisierung des Strafverfahrensrechtes in
einzelnen Bereichen. Dabei ist zu beachten, dass nach UAbs 3 die Mitgliedstaaten nicht
an der Beibehaltung oder Einführung eines höheren Schutzniveaus gehindert werden.
Außerdem besteht eine Pflicht zur Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den
Rechtsordnungen und Rechtstraditionen. Die Vorgabe von Mindestvorschriften durch
den Erlass von Richtlinien wird außerdem an das Erfordernis der Erleichterung der
26 Vgl Satzger in Streinz (Hrsg), 3. Aufl. 2018, AEUV Art 82, Rz 16.
27 Satzger in Streinz (Hrsg), 3. Aufl. 2018, AEUV Art 82, Rz 17.
28 Vgl Meyer in Von der Groeben/Schwarze/Hatje AEUV Art 82, Rz 18.
29 Böse in Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg), Art 82 AEUV, Rz 33;
Vogel/Eisele in Grabitz/Hilf/Nettesheim AEUV Art 82, Rz 79.
6gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen und der polizeilichen und
justiziellen Zusammenarbeit geknüpft, worin Subsidiaritäts- und
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechend Art 5 Abs 1 S 2, Abs 3 bzw 4 EUV zum
Ausdruck kommen.30 Erwähnt sei noch, dass sich die Notbremsregelung des Art 82 Abs
3 AEUV grundsätzlich nur auf Abs 2 bezieht.
Art 83 Abs 1 AEUV bildet eine Kompetenzgrundlage für die Union zur Festlegung von
Mindestvorschriften, soweit dies zur Bekämpfung besonders schwerer,
grenzüberschreitender Kriminalität in bestimmten Deliktsbereichen erforderlich ist. Das
begrenzende Erforderlichkeitskriterium ist hier in Art 67 Abs 3 AEUV zu verorten.31 Abs
2 stellt eine Annexkompetenz dar und erlaubt die Angleichung von strafrechtlichen
Rechtsvorschriften dort, wo es unerlässlich ist für die wirksame Durchführung der Politik
der Union, auf einem Gebiet, auf welchem bereits Harmonisierungsmaßnahmen erfolgt
sind. Abs 3 enthält wiederum einen Notbremsmechanismus.
Am 28.02.2002 wurde auf Basis von Art 31, 34 lit c EUV aF, heute Art 85 AEUV, der
Beschluss des Rates 2002/187/JI32 erlassen und damit Eurojust ins Leben gerufen, eine
zentrale europäische Stelle für die justizielle Zusammenarbeit und gleichsam
Gegenstück zu Europol. Hauptaufgabe von Eurojust liegt gem Art 85 I darin, die
Koordinierung (Art 85 I lit b) und Zusammenarbeit (Art 85 I lit c) zwischen den nationalen
Behörden der Mitgliedstaaten zu unterstützen und zu verstärken. Die in Art 85 Abs 1
UAbs 2 lit a–c AEUV erwähnten Aufgaben sind jedoch nur beispielhaft, wie die
Verwendung des Wortes „kann“ impliziert.33
2. Sekundärrecht
Nach Erläuterung der relevanten primärrechtlichen Grundlagen im Bereich der
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen möchte ich nunmehr auf die
Rahmenbeschlüsse über den EuHb eingehen und aufgrund der besonderen Bedeutung
für den Übergabemechanismus auch auf die Beschlüsse zur Einrichtung des
Schengener Informationssystems der 2. Generation sowie Eurojust.
30 Vgl Satzger in Streinz (Hrsg), 3. Aufl. 2018, AEUV Art 82, Rz 45-46.
31 Vogel/Eisele in Grabitz/Hilf/Nettesheim AEUV Art 83 Rz 45; Meyer in von der Groeben/Schwarze/Hatje
AEUV Art 83, Rz 34.
32 ABl 2002 L 63/1.
33 Dannecker in Streinz (Hrsg), 3. Aufl. 2018, AEUV Art 85, Rz 6.
7a) Rahmenbeschluss 2002/584/JI
Auf Grundlage von Art 31 lit a und lit b EUV aF und Art 34 Abs 2 lit b EUV aF hat der Rat
am 13.06.2002 den Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl und die
Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedsstaaten erlassen. Er soll entsprechend den
Schlussfolgerungen von Tampere34 das förmliche zweigliedrige Auslieferungsverfahren
abschaffen und durch ein rein justizielles Übergabesystem ersetzen.35 Zufolge Art 34
Abs 1 RB-EuHb mussten die Mitgliedsstaaten die Vorgaben bis zum 31.12.2003 in ihre
Rechtssysteme implementieren. Österreich erließ in Umsetzung des
Rahmenbeschlusses das „Gesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
mit den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union“ (EU-JZG).36
Gemäß Art 1 RB-EuHb wird Europäischer Haftbefehl als justizielle Entscheidung
definiert, die in einem Ms ergangen ist und Festnahme und Übergabe einer bestimmten
Person durch einen anderen Staat zur Strafverfolgung oder Strafvollstreckung bezweckt.
Gem Art 2 Abs 1 RB-EuHb besteht das Erfordernis, dass im Ausstellungsstaat bei einem
EuHb zur Strafverfolgung eine Mindesthöchststrafe von 12 Monaten Freiheitsstrafe
droht, sowie bei einem EuHb zur Strafvollstreckung eine Mindest(rest)strafe von 4
Monaten Freiheitsstrafe zu vollstrecken ist. Der Erlass soll im Sinne der
Verhältnismäßigkeit daher bei leichter Kriminalität nicht möglich sein.37
b) Rahmenbeschluss 2009/299/JI
Auf Grundlage von Art 31 lit a und lit b EUV aF und Art 34 Abs 2 lit b EUV aF hat der Rat
am 26.02.2009 diesen Rahmenbeschluss erlassen um damit unter anderem
Rahmenbeschluss 2002/584/JI mit dem Ziel der Stärkung der Verfahrensrechte von
Personen und zur Förderung der Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen
Anerkennung zu ändern. Nach Ansicht des Unionsgesetzgebers gibt es in den
verschiedenen Rahmenbeschlüssen keine einheitliche Behandlung von
Abwesenheitsurteilen, was wiederrum ein Hindernis für die Praxis darstellen könnte.38
In Rahmenbeschluss 2002/584/JI wurde daher ein Art 4a RB-EuHb eingefügt und Art 5
Abs 1 RB-EuHb gestrichen. Man hat einen fakultativen Ablehnungsgrund39 verankert,
auf welchen an späterer Stelle noch einmal eingegangen wird.
34 Nr 35 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Tampere vom 15. und 16.10.1999.
35 Erwägungsgrund 5 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI.
36 BGBl I Nr 36/2004.
37 Sautner, ÖJZ 2005, 330.
38 Erwägungsgrund 2 des Rahmenbeschlusses 2009/299/JI.
39 Erwägungsgrund 15 des Rahmenbeschlusses 2009/299/JI.
8c) Beschluss 2002/187/JI
Dieser Ratsbeschluss ist auf Basis von Art 31 und Art 34 Abs 2 lit c EUV aF am
28.02.2002 ergangen und bildet die Grundlage für die Einrichtung der Dokumentations-
und Clearingstelle Eurojust mit Sitz in Den Haag. Beschluss 2002/187/JI wurde
wiederrum durch Beschluss 2009/426/JI vom 16.12.2008 geändert und erhielt eine
Neufassung.40 Es handelt sich bei Eurojust um eine weisungsunabhängige
Unionsagentur mit Rechtspersönlichkeit, wobei diese von den Mitgliedsstaaten mit
Richtern, Staatsanwälten oder Polizeibeamten beschickt wird. Eurojust soll
insbesondere die effektive Zusammenarbeit der nationalen Strafverfolgungsbehörden
ermöglichen und ist primär für schwere Kriminalität im grenzüberschreitenden Bereich
zuständig.
Gemäß Rahmenbeschluss 2002/584/JI (EuHb) kann Eurojust auf Ersuchen einer
vollstreckenden Justizbehörde hin eine Stellungnahme abgeben, sofern zwei oder
mehrere Mitgliedsstaaten die Auslieferung einer Person begehren (Mehrfachersuchen)
und die vollstreckende Behörde unter Berücksichtigung der in Art 16 Abs 1 RB-EuHb
genannten Umstände eine Entscheidung zu treffen hat (Art 16 Abs 2 RB-EuHb).
Zudem ist Eurojust nach Art 17 Abs 7 RB-EuHb in Kenntnis zu setzen, wenn ein
Mitgliedsstaat die in diesem Artikel vorgesehenen Fristen aufgrund außergewöhnlicher
Umstände nicht einhalten kann. Grundsätzlich ist über eine EuHb-Vollstreckung binnen
10 Tagen nach Festnahme der betroffenen Person zu entscheiden, sofern diese ihrer
Übergabe zustimmt, widrigenfalls binnen 60 Tagen nach Festnahme. Eine
Verlängerungsmöglichkeit von 30 Tagen besteht in Sonderfällen, wobei die ausstellende
Justizbehörde unverzüglich zu informieren ist.
d) Beschluss 2007/533/JI
Der Schengen-Raum41 brachte eine Abschaffung der EU-Binnengrenzen und dadurch
uneingeschränkten Personenverkehr infolge des Entfalls der Grenzkontrollen.42 Vor
diesem Hintergrund erfolgte die Installation des Schengener Informationssystems (SIS
I).43 Die Behörden der Schengen-Staaten konnten mittels diesem grenzübergreifenden,
automationsgestützten polizeilichen Fahndungssystem auf mehr als 32,5 Millionen
40 ABlEU 2009 Nr L 138, 14.
41 Errichtet durch das Schengener Abkommen 1985 und das Schengener Durchführungsübereinkommen
1990.
42 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9.3.2016 über einen
Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex), ABl
EU L 77 vom 23.3.2016.
43
Vgl Esser in Böse (Hrsg), Europäisches Strafrecht (EnzEuR Bd 11), §19, Rz 8.
9Fahndungsdaten (Personen- und Sachfahndungen) zugreifen.44 Aufgrund der EU-
Osterweiterung beschloss man die Weiterentwicklung von SIS I zu SIS II, welches mit
Verspätung erst am 09.04.2013 in Betrieb gehen konnte. Im Gegensatz zu SIS I erfolgt
hier ein zentraler Betrieb durch einen Rechner in Straßburg, der mit den nationalen
Systemen der Mitgliedsstaaten verbunden ist.45
Kapitel V des SIS-B steht unter dem Titel „Ausschreibungen von Personen zum Zwecke
der Übergabe- oder Auslieferungshaft“. Hier ist vorgesehen, dass Personendaten zum
Zwecke der Übergabehaft von per EuHb Gesuchten auf Antrag der Justizbehörde des
ausstellenden Mitgliedstaats eingegeben werden. Diese hat auch eine Kopie des
originalen Europäischen Haftbefehls der Ausschreibung im SIS II beizugeben. Zufolge
Art 9 Abs 1 RB-EuHb kann bei bekanntem Aufenthaltsort der gesuchten Person eine
Direktübermittlung an die vollstreckende Justizbehörde erfolgen. Nach Abs 2 kann die
ausstellende Justizbehörde aber in allen Fällen auch eine Ausschreibung im SIS II
beschließen. Art 8 Abs 1 RB-EuHb nennt jene Informationen welche der EuHb zu
enthalten hat. Diese werden gemäß Artikel 28 SIS II-B im Wege des Austauschs von
Zusatzinformationen an alle Mitgliedsstaaten übermittelt.
C. Problemfelder
1. Ausstellung
a) Organisatorische Anforderungen an den Aussteller
Gem Art 1 RB-EuHb handelt es sich beim Europäischen Haftbefehl um eine justizielle
Entscheidung. Die zuständige ausstellende Justizbehörde richtet sich nach dem Recht
des Ausstellungsstaates. Die Verweisung durch Art 6 Abs 1 RB-EuHb betrifft jedoch
nicht den Begriff „Justizbehörde“ als solche. Bedeutung und Tragweite des Begriffes
können nicht den Mitgliedstaaten überlassen werden. Vielmehr ist eine einheitliche und
autonome Interpretation geboten, die sich an Wortlaut und Kontext zu orientieren hat.46
In der Rs Poltorak stellte der EuGH fest, dass der Begriff Justiz weder nach seiner
gewöhnlichen Bedeutung, noch unter Beachtung des Kontexts, Polizeibehörden erfasst,
denn entsprechend dem Grundsatz der Gewaltentrennung kann damit nur die Judikative
44 Vgl Esser in Böse (Hrsg), Europäisches Strafrecht (EnzEuR Bd 11), §19, Rz 123.
45 Vgl Esser in Böse (Hrsg), Europäisches Strafrecht (EnzEuR Bd 11), §19, Rz 129.
46 Vgl: EuGH 10.11.2016 Rs C-452/16, Poltorak, ECLI:EU:C:2016:858 (Rz 31-32); EuGH 17.07.2008
C-66/08, Kozłowski, ECLI:EU:C:2008:437 (Rz 43); EuGH 16.11.2010 Rs C-261/09, Mantello,
ECLI:EU:C:2010:683 (Rz 38).
10gemeint sein.47 Für die Vollstreckungsbehörde muss die Gewissheit einer justiziellen
Prüfung gegeben sein, was aber bei einer Polizeibehörde nicht der Fall sein kann,
sodass ihre Stellung im Gefüge der Exekutive und das Maß an Autonomie letztlich
irrelevant ist.48 Wenn jedoch eine Polizeibehörde bloß den nationalen Haftbefehl
ausstellt, der wiederrum im Rahmen der Ausstellung des EuHb durch die extern
weisungsunabhängige Staatsanwaltschaft bestätigt wird, so ist dies unproblematisch.49
Der Begriff Justizbehörde erfasst nicht nur Gerichte, sondern darüber hinaus all jene
Behörden, die zur Mitwirkung an der Strafrechtspflege berufen sind.50 Fraglich ist nun,
unter welchen Voraussetzungen dies der Fall ist. Der Begriff Verfahren erstreckt sich
von der Phase vor dem Strafprozess über den Prozess selbst hin zum Vollzug bzw zur
Vollstreckung der Entscheidung. Unterstützt wird diese Auslegung durch den Wortlaut
von Art 82 Abs 1 lit d AEUV, sowie dem fünften Erwägungsgrund.51 In der Rs PF52 hat
der EuGH entgegen dem Ausspruch des Verfassungsgerichtes der Republik Litauen,
wonach die Staatsanwaltschaft nicht zur Mitwirkung an der Rechtspflege berufen ist und
der Tatsache, dass nach der Rechtsordnung dieses Mitgliedstaates die
Generalstaatsanwaltschaft eine von der Exekutive, wie auch strukturell von der
Judikative unabhängige Stelle ist, diese als Behörde im Sinne des Art 6 Abs 1 RB-EuHb
qualifiziert.
Die Verfahrens- und Grundrechte des Betroffenen erfahren eine doppelte Prüfung, und
zwar auf der ersten Stufe im Rahmen der Ausstellung der nationalen Entscheidung, also
dem nationalen Haftbefehl, sowie im Rahmen der zweiten Stufe, wenn der EuHb
erlassen wird.53 Dabei hat die Justizbehörde im Sinne des Art 6 Abs 1 RB-EuHb eine
Voraussetzungs- und Verhältnismäßigkeitsprüfung vorzunehmen.54
Wesentlich ist, dass eine objektive Prüfung unter Berücksichtigung aller be- und
entlastenden Umstände des Falles sichergestellt sein muss. Dies verlangt wiederrum
die Unabhängigkeit der ausstellenden Justizbehörde. Der Gerichtshof fordert hierfür
47 Vgl: EuGH 10.11.2016 Rs C-452/16, Poltorak, ECLI:EU:C:2016:858 (Rz 35); vgl GA Campos
10.11.2016 Rs C-452/16, Poltorak, ECLI:EU:C:2016:782 (Rz 39).
48 Vgl EuGH 10.11.2016 Rs C-452/16, Poltorak, ECLI:EU:C:2016:858 (Rz 45).
49 Vgl EuGH 10.11.2016 Rs C-453/16, Özçelik, ECLI:EU:C:2016:860 (Rz 38).
50 Vgl EuGH 27.05.2019 verb Rs C-508/18 und C-82/19, OG/PI, ECLI:EU:C:2019:456 (Rz 50); EuGH
10.11.2016 Rs C-477/16, Kovalkovas, ECLI:EU:C:2016:861 (Rz 34).
51 Vgl EuGH 27.05.2019 verb Rs C-508/18 und C-82/19, OG/PI, ECLI:EU:C:2019:456
(Rz 54-56).
52 Vgl EuGH 27.05.2019 Rs C-509/18, PF, ECLI:EU:C:2019:457.
53 Vgl EuGH 01.06.2016 Rs C-241/15, Bob-Dogi, ECLI:EU:C:2016:385 (Rz 56).
54 Vgl EuGH 10.11.2016 Rs C-477/16, Kovalkovas, ECLI:EU:C:2016:861 (Rz 47).
11entsprechende Rechts- und Organisationsvorschriften der nationalen Rechtsordnung,
die dies gewährleisten.55
Im Falle der deutschen Staatsanwaltschaften hatte sich der EuGH der Frage zu stellen,
ob ein externes Weisungsrecht des Justizministers, gegenüber der
Generalstaatsanwaltschaft in einem deutschen Bundesland, diese Unabhängigkeit
ausschließt. Er hat dies bejaht, weil die einschlägigen Rechtsvorschriften Weisungen im
Einzelfall, also bei und für die Ausstellung eines EuHb, ermöglichen. Dabei waren die
Einwendungen der deutschen Regierung, dass für die Staatsanwaltschaft das
Legalitätsprinzip gelte und die Nichtbeachtung von Einzelweisungen für die Beamten
keinen Entlassungsgrund bildet. Darüber hinaus bedürfe es im Bundesland Schleswig-
Holstein dem Schriftlichkeitsgebot für solche Weisungen und der Mitteilung der
Ausübung an den Landtagspräsidenten. In Sachsen hingegen hätten sich die
regierenden Parteien im Koalitionsvertrag auf die Nichtausübung geeinigt. Meiner
Ansicht nach hat der Gerichtshof hier folgerichtig die Einwendungen als irrelevant
zurückgewiesen, zumal all dies Hemmnisse für die Ausübung oder gar den Missbrauch
des Weisungsrechtes sein mögen, allerdings keine rechtlichen Garantien.
Im Fall der französischen Staatsanwaltschaften hat der EuGH jedoch entschieden, dass
ein allgemeines Weisungsrecht für die Qualifikation als ausstellende Justizbehörde
unschädlich sein soll. In Frankreich besteht nämlich eine Befugnis des Justizministers
zur Erteilung von Weisungen auf dem Gebiet der Strafrechtspolitik um die Kohärenz
derselben im Staatsgebiet sicherzustellen. Auch Weisungszüge innerhalb der
Anklagebehörde, also ein internes Weisungsrecht, sind unproblematisch.56
In Österreich besteht die Möglichkeit, dass der Bundesminister für Justiz
Einzelweisungen an die Generalprokuratur oder die Oberstaatsanwaltschaft erteilt,
welche wiederrum Weisungen an die untergeordneten Instanzen erteilen können.
Wesentlicher Unterschied zur Rs OG/PI ist, dass vor Übermittlung des EuHb durch die
Staatsanwaltschaft eine gerichtliche Bewilligung einzuholen ist, in deren Rahmen die
Voraussetzungen für den Erlass und die Verhältnismäßigkeit neuerlich geprüft werden.
Gegen diese ist ein Rechtsmittel zulässig. Das Gericht ist weder an die
Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft, noch an die Begründung ihrer Anordnung
gebunden.57
55 Vgl EuGH 27.05.2019 verb Rs C-508/18 und C-82/19, OG/PI, ECLI:EU:C:2019:456 (Rz 74).
56 Vgl EuGH 12.12.2019 verb Rs C-566/19 und C-626/19, JR und YC, ECLI:EU:C:2019:1077 (Rz 54-56).
57 Vgl EuGH 09.10.2019 Rs C-489/19, NJ, ECLI:EU:C:2019:849 (Rz 43-45).
12In der Rs L und P hat der Gerichtshof außerdem festgehalten, dass systemische oder
allgemeine Mängel, wie schwer sie auch immer sein mögen, die die Unabhängigkeit der
Justiz betreffen und im Zeitpunkt der Ausstellung des EuHb bestanden haben oder
danach aufgekommen sind nicht dazu führen können, dass schlechthin allen Richtern
und Gerichten eines Mitgliedstaates, die ihrer Natur nach völlig unabhängig agieren, die
Eigenschaft als ausstellende Justizbehörden aberkannt werden kann. Denn tatsächlich
bedeuten diese Mängel nicht, dass jede einzelne Entscheidung jedes Gerichtes
betroffen sein muss. In weiterer Folge verweist der Gerichtshof auch darauf, dass die
Folge der gegenteiligen Interpretation, die Aberkennung der Gerichts- bzw.
Tribunalsqualität, auch zum Zwecke der Anwendung anderer Normen des
Unionsrechtes wäre.58
2. Vollstreckung
a) Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung
Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung erhöht die Effektivität der justiziellen
Kooperation. Technisch betrachtet stellt er den Treibriemen für die Kriminalpolitik des
Ausstellungsstaates dar, indem er die Reichweite innerstaatlicher Entscheidungen in
strafrechtlichen Belangen über das ganze Territorium der Europäischen Union ausdehnt,
wobei das gegenseitige Vertrauen als Schmiermittel gesehen werden kann.59
Ob man nun die rechtliche Herleitung aus der Gleichheit der Ms60 vornimmt, aus dem
Loyalitätsgebot61 oder aus den gemeinsamen Werten und Zielen (Art 2 EUV iVm Art 3
EUV)62, ändert nichts daran, dass nach hM der Vertrauensgrundsatz die Basis der
gegenseitigen Anerkennung bildet.63 Im Gutachten 2/13 hat der EuGH dazu ausgeführt,
dass ein Ms die Beachtung der Grundrechte durch den anderen Ms zu unterstellen hat.
Weder darf er einen (nach nationalem Recht) höheren Schutzstandard verlangen, als
ihn das Unionsrecht gewährleistet, noch darf er eine Prüfung der tatsächlichen
Einhaltung vornehmen, ausgenommen bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände.64
58 Vgl EuGH 17.12.2020 verb Rs C-354/20 und C-412/20, L und P, ECLI:EU:C:2020:1033 (Rz 44).
59 Vgl Caeiro, Scenes from a marriage: trust, distrust and (re)assurances in the execution of a European
arrest warrant, 20 year anniversary of the Tampere Programme 2019 – EUI, 240.
60 Vgl Lenaerts, la vie après l’avis: exploring the principle of mutual (yet not blind) trust, common market
law, 807.
61 Meyer, Der Grundsatz gegenseitigen Vertrauens – Konzeptualisierung und Zukunftsperspektiven eines
neuen Verfassungsprinzips, EuR 2017, 163.
62 von Danwitz, Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten der EU. Eine
wertebasierte Garantie der Einheit und Wirksamkeit, EuR 2020, 79.
63 Vgl: EuGH 25.07.2018 Rs C-216/18, LM, ECLI:EU:C:2018:586 Rz 36; EuGH 10.08.2017 Rs C-270/17,
Tupikas, ECLI:EU:C:2017:628 (Rz 49).
64 Vgl EuGH 18.12.2014 Gutachten 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454 (Rz 192).
13Im Bereich des Binnenmarktes besteht eine Verpflichtung der Ms ihre
binnenmarktbezogenen Vorschriften und die hiernach ergangenen Entscheidungen als
wirksam anzusehen.65 Auch der RFSR sollte auf vertrauensbasierten
Anerkennungspflichten aufgebaut werden, dabei hat man die gegenseitige Anerkennung
für das Strafrecht in Art 82 Abs 1 S 1 AEUV primärrechtlich verankert.
Der RB-EuHb stellt nach Erwägungsgrund 12 die erste konkrete Verwirklichung des
Prinzips der gegenseitigen Anerkennung dar, welches vom Europäischen Rat zum
Eckstein strafjustizieller Zusammenarbeit erhoben wurde. Dementsprechend ordnet Art
1 Abs 2 RB-EuHb an, dass jeder EuHb nach diesem Grundsatz zu vollstrecken ist.
Die gegenseitige Anerkennung von strafjustiziellen Entscheidungen im Rahmen des
Übergabemechanismus wird teils auch sehr kritisch gesehen, denn klar ist, dass es sich
hierbei um normative Konstrukte handelt mit ganz eigentümlichen Charakteristika und
eben nicht um Waren iSd Warenverkehrsfreiheit.66 Eingewandt wird auch, dass man eine
Unfreiheit durch die Erweiterung der Strafverfolgungsmöglichkeit verkehrsfähig machen
würde.67 In sich geschlossene Strafverfahrensmodelle mit einer wohlüberlegten Balance
zwischen Eingriffen und Rechtsschutzmöglichkeiten würde man zudem sprengen.68 Das
Absehen vom Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit bei Vorliegen eines Listendeliktes
iVm einer Mindeststrafandrohung zieht eine Unterwerfung unter fremde
Strafrechtsordnungen, sowie die Gefahr der Durchsetzung der punitivsten
69
Rechtsordnung, nach sich. Heftig kritisiert wird vor allem die mangelnde
Determinierung dieser enumerierten Delikte bzw Deliktsgruppen. 70
Von der Verankerung einer Grundrechtsklausel wurde Abstand genommen. Die
Grundrechte finden lediglich in Erwägungsgrund 12 und Art 1 Abs 3 RB-EuHb
Erwähnung.71
b) Aussetzung des Mechanismus
Zufolge Erwägungsgrund 10 darf der Übergabemechanismus nach RB-EuHb nur dann
allgemein ausgesetzt werden, wenn eine schwere und anhaltende Verletzung der in Art
6 Abs 1 EUV enthaltenen Grundsätze durch einen Mitgliedstaat vorliegt und diese vom
65 Vgl EuGH 20.02.1979 Rs C-120/78, Cassis de Dijon, ECLI:EU:C:1979:42 (Rz 8).
66 Vgl Schallmoser, Europäischer Haftbefehl und Grundrechte (2012), 71f.
67 Vgl Schallmoser, Europäischer Haftbefehl und Grundrechte (2012), 72f.
68 Vgl Schallmoser, Europäischer Haftbefehl und Grundrechte (2012), 73f.
69 Vgl Schallmoser, Europäischer Haftbefehl und Grundrechte (2012), 76f.
70 Vgl Schallmoser, Europäischer Haftbefehl und Grundrechte (2012), 77f.
71 Vgl Schallmoser, Europäischer Haftbefehl und Grundrechte (2012), 79f.
14Rat gemäß Art 7 Abs 1 EUV des genannten Vertrags mit den Folgen von Art 7 Abs 2
EUV festgestellt wird.
Der Verfahrensabschluss benötigt demnach einen einstimmigen Beschluss des
Europäischen Rates, woraufhin der Rat mit qualifizierter Mehrheit die Anwendung des
Mechanismus im Verhältnis zu dem betroffenen Ms aussetzen kann. Ein Teil der Lehre
vertritt, dass schon bei Erfüllung des Art 7 Abs 1 RB-EuHb eine Aussetzung erfolgen
kann.72 Mangels politischem Konsens im Rat ist es zur Aussetzung bisher nie
gekommen. Im März 2014 hat die EU-Kommission dem Art 7 Verfahren einen
(informellen) Rechtsstaatsdialog vorangestellt.73
c) Ablehnung
Die Vollstreckung des EuHb stellt den Regelfall dar, während die Ablehnung restriktiv zu
handhabende Ausnahme bleibt74 und grundsätzlich an die fakultativen Gründe des Art 4
RB-EuHb und Art 4a RB-EuHb oder die obligatorischen Gründe des Art 3 RB-EuHb
gebunden ist. Auf diese möchte ich an dieser Stelle möglichst kurz eingehen.
(1) Fakultativ
Zunächst kann eine Ablehnung nach Art 4 Z1 RB-EuHb erfolgen, wenn die Strafbarkeit
im Vollstreckungsstaat nicht gegeben ist, sohin keine beidseitige Strafbarkeit vorliegt.
Dies erfolgt jedoch unter der Voraussetzung, dass es sich um kein Listendelikt handelt.
Eine Prüfung der beidseitigen Strafbarkeit hat nämlich bei Vorliegen eines Deliktes gem
Art 2 Abs 2 RB-EuHb iVm einer Strafandrohung von mindestens 3 Jahren zu
unterbleiben. Art 4 Z1 RB-EuHb normiert weiter, dass in Steuer-, Zoll- und
Währungsangelegenheiten, das Fehlen gleichartiger Steuern nach dem Recht des
Vollstreckungsstaates keinen Ablehnungsgrund darstellen kann.
Z2 normiert, dass eine Strafverfolgung wegen derselben Handlung75 im
Vollstreckungsstaat zur Ablehnung berechtigt. Dem Wortlaut der Bestimmung nach wäre
auch der Fall erfasst, dass die Strafverfolgung erst nach Erhalt des EuHb aufgenommen
wird.76
72 https://verfassungsblog.de/rule-of-law-retail-and-rule-of-law-wholesale-the-ecjs-alarming-celmer-
decision, abgefragt am 05.03.2021; https://verfassungsblog.de/the-cjeu-in-the-celmer-case-one-step-
forward-two-steps-back-for-upholding-the-rule-of-law-within-the-eu, abgefragt am 05.03.2021.
73 Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 11.03.2014 (IP/14/237).
74 Vgl: EuGH 29.06.2017 Rs C-579/15, Popławski, EU:C:2017:503 (Rz 19); EuGH 10.08.2017 Rs C-
270/17, Tupikas, EU:C:2017:628, (Rz 50-51); EuGH 23.01.2018 Rs C-367/16, Piotrowski,
ECLI:EU:C:2018:27 (Rz 48).
75 Zum Begriff vgl EuGH 16.11.2010 Rs C-261/09, Mantello, ECLI:EU:C:2010:683.
76 Vgl Schallmoser, Europäischer Haftbefehl und Grundrechte (2012), 31.
15Z3 1. HS erlaubt die Ablehnung, wenn die Justizbehörden des Vollstreckungsstaates
entschieden haben, dass kein Verfahren eingeleitet wird oder ein solches einzustellen
ist.
Z3 2. HS regelt den Fall, dass in einem anderen Ms als dem Vollstreckungsstaat wegen
derselben Handlung eine rechtskräftige Entscheidung erging, welche der weiteren
Strafverfolgung entgegensteht. Das bedeutet Einstellung des Strafverfahrens durch ein
Gericht oder eine Staatsanwaltschaft, bei letzterer will Schwaighofer jedoch den vom
EuGH in der Rs Gözütok und Brügge77 aufgestellten Kriterien entsprochen wissen. Der
Gerichtshof stelle nämlich seiner Ansicht nach auf eine Ahndungswirkung ab.78
Nach Z4 kann eine Ablehnung erfolgen, wenn Strafverfolgung oder Strafvollstreckung
nach dem Recht des Vollstreckungsstaates verjährt wäre, sofern dieser Jurisdiktion
besessen hätte.
Z5 verankert das drittstaatliche Doppelbestrafungsverbot (ne bis in idem). Es greift, wenn
in einem Drittstaat eine rechtskräftige Aburteilung wegen derselben Handlung erfolgte.
Falls eine Verurteilung erfolgte, muss die Sanktion vollstreckt worden sein, sich in
Vollstreckung befinden oder darf nach dem Recht des Drittstaates nicht mehr
vollstreckbar sein.
Z6 normiert die sog Vollstreckungsverweigerung. Es handelt sich dabei um einen
speziellen Ablehnungstatbestand, welcher nur Haftbefehle zur Strafvollstreckung betrifft.
Demnach wurde bereits eine Strafe oder Maßregel im Ausstellungsstaat verhängt und
es besteht ein entsprechendes Naheverhältnis des zu Übergebenden zum
Vollstreckungsstaat, also Aufenthalt, Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz. Wobei der
EuGH „sich aufhält“ interpretiert als beständiges Verweilen von gewisser Dauer, sodass
Bindungen ähnlicher Intensität wie zu einem Wohnsitzstaat bestehen.79 Der
Vollstreckungsstaat muss sich aber jedenfalls zur Übernahme des Vollzuges
verpflichten.
Z7 lit a erlaubt die Ablehnung, wenn die Tat ganz oder zum Teil im Hoheitsgebiet des
Vollstreckungsstaates begangen wurde. Ob dies der Fall ist bestimmt sich aber nach
nationalem Recht desselben. Nach Z7 lit b wurde die Tat weder im Ausstellungs- noch
77 Vgl EuGH 11.02.2003 verb Rs C-187/01 und C-386/01, Gözütok und Brügge, ECLI:EU:C:2003:87.
78 Vgl Schwaighofer in Lagodny/Wiederin/Winkler (Hrsg.), Probleme des Rahmenbeschlusses, 82.
79 Vgl EuGH 17.07.2008 Rs C-66/08, Kozłowski, ECLI:EU:C:2008:437.
16im Vollstreckungsstaat begangen, sondern außerhalb davon und zudem fehlt die
Gerichtsbarkeit des Vollstreckungsstaates.
Art 4a ermöglicht dem Vollstreckungsstaat die Ablehnung, falls dem EuHb zur
Strafvollstreckung ein Abwesenheitsurteil zugrunde liegen sollte. Zugleich werden aber
zahlreiche Ausnahmen normiert.
Eine Ablehnung soll nicht möglich sein, wenn die betroffene Person rechtzeitig
persönlich geladen wurde, sowie dabei von Ort und Termin der Verhandlung in Kenntnis
gesetzt wurde. Ebenso wenn sie auf andere Weise tatsächlich offiziell in Kenntnis
gesetzt wurde, und zwar auf eine solche, die einen zweifelsfreien Nachweis ermöglicht.
Eine Ausnahme ist auch dann gegeben, wenn der Betroffene ein Mandat an einen
Rechtsbeistand erteilt hat und auch tatsächlich vertreten wurde. Ebenso nicht wenn der
Betroffene erklärt, dass er die Entscheidung nicht anficht oder innerhalb geltender Frist
kein weiteres Verfahren beantragt hat.
Zuletzt besteht die Möglichkeit, dass zwar keine persönliche Zustellung der
Entscheidung erfolgte, jedoch die Person diese unverzüglich nach der Übergabe
persönlich erhalten wird und diese über das Wiederaufnahmerecht oder das Recht auf
ein Berufungsverfahren, sowie die im EuHb genannte Antragsfrist in Kenntnis gesetzt
werden wird.
(2) Obligatorisch
Die Übergabe hat nach Art 3 Z1 im Falle einer Amnestie zu unterbleiben. Der ersuchte
Staat hat die Vollstreckung demnach abzulehnen, wenn die Straftat, die Grundlage des
EuHb ist, einer Amnestie in diesem Staat unterliegt und er nach eigenem nationalem
Strafrecht zur Verfolgung berufen war. Mangels Judikatur und Legaldefinition unklar
bleibt der Begriff der Amnestie.
Ein EuHb ist entsprechend Z2 auch abzulehnen, sofern die betroffene Person wegen
derselben Handlung von einem anderen Unionsstaat bereits rechtskräftig abgeurteilt
wurde (ne bis in idem). Freisprüche werden davon mitumfasst.80 Falls die Person
verurteilt wurde, muss die Sanktion vollstreckt worden sein, gerade vollstreckt werden
oder sie darf nach dem Recht des Urteilsstaates nicht mehr vollstreckbar sein.
80 Vgl Zeder, AnwBl 2003, 376.
17Den dritten obligatorischen Ablehnungsgrund nach Z3 bildet die Strafunmündigkeit bzw
Deliktsunfähigkeit des zu Übergebenden und zwar nach dem Recht des
Vollstreckungsstaates.
(3) Grundrechte und allgemeine Rechtsgrundsätze
Im RB-EuHb findet sich kein Ablehnungstatbestand in Bezug auf die Grundrechte.
Erwägungsgrund 12 statuiert, dass der RB die Grundrechte und die in Art 6 EUV
niedergelegten Grundsätze achtet. Außerdem dürfe keine Bestimmung des RB
dahingehend ausgelegt werden, dass sie es untersagen würde die Übergabe
abzulehnen, wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der genannte
Haftbefehl zum Zwecke der Verfolgung oder Bestrafung einer Person aus Gründen des
Geschlechts, der Rasse, der Religion, der ethnischen Herkunft, der Staatsangehörigkeit,
der Sprache, der politischen Überzeugung oder der sexuellen Ausrichtung erlassen
wurde oder dass die Stellung dieser Person aus einem dieser Gründe beeinträchtigt
werden könnte.
Art 1 Abs 3 RB-EuHb, der sich im Gegensatz zu Erwägungsgrund 12 im normativen Teil
befindet, ordnet quasi neuerlich an, dass die Pflicht zur Achtung der Grundrechte und
der allgemeinen Rechtsgrundsätze, wie diese in Art 6 EUV festgeschrieben werden nicht
berührt wird. Ein ordre public, welcher im Ergebnis einem Grundrechtsvorbehalt
gleichkäme, existiert auch nicht.81
(a) Zweistufige Prüfung (Aranyosi-Formel)
Den Eckstein der (straf)justiziellen Zusammenarbeit bildet das Prinzip der gegenseitigen
Anerkennung.82 Jeder EuHb ist gem. Art 1 Abs 2 RB-EuHb nach diesem Grundsatz zu
vollstrecken. Die Ablehnungsgründe nach Art 3, 4, 4a RB-EuHb sind taxativ
enumeriert.83
Nichts desto trotz hat der Gerichtshof im Gutachten 2/13 die Beschränkbarkeit der
Grundsätze der gegenseitigen Anerkennung und des gegenseitigen Vertrauens
aufgrund außergewöhnlicher Umstände bestätigt.84 Der Gerichtshof sieht die
Rechtsgrundlage für die Ablehnung der Vollstreckung aufgrund außergewöhnlicher
Umstände iZm dem EuHb in Art 1 Abs 3 RB-EuHb85, der deklaratorisch86 klarstellt, dass
81 Vgl Schallmoser, Europäischer Haftbefehl und Grundrechte (2012), 79.
82 Vgl Erwägungsgrund 10 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI.
83 Vgl EuGH 16.07.2015 Rs C-237/15, Lanigan, ECLI:EU:C:2015:474 (Rz 191).
84 Vgl EuGH 18.12.2014 Gutachten 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454.
85 Vgl EuGH 27.03.2018 Rs C-216/18, LM, ECLI:EU:C:2018:586 (Rz 45).
86 Vgl Geneuss/Werkmeister, Faires Verfahren vor systemisch abhängigen Gerichten?, ZStW 2020, 102ff.
18Sie können auch lesen